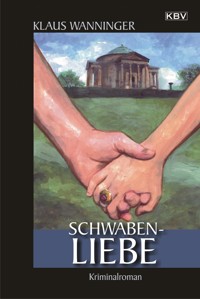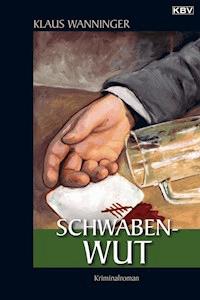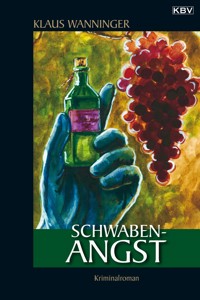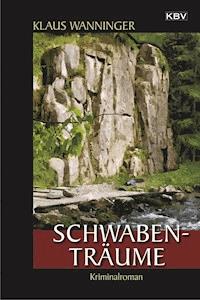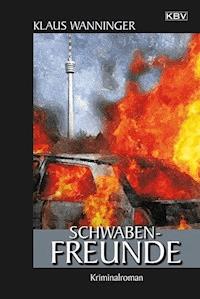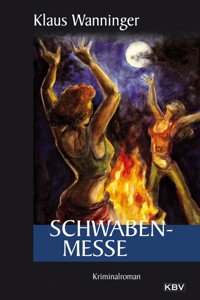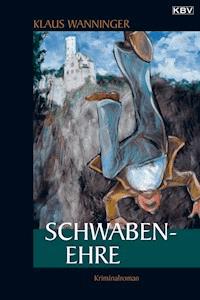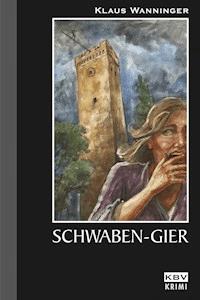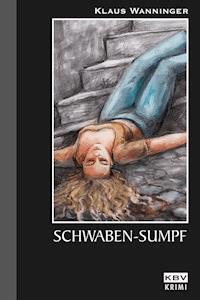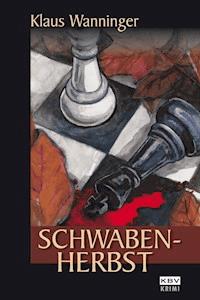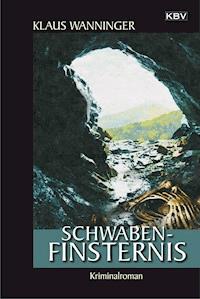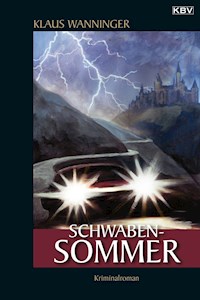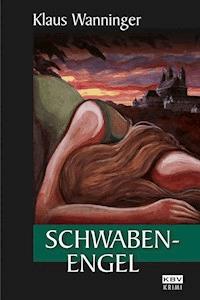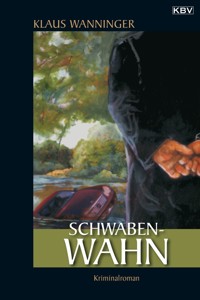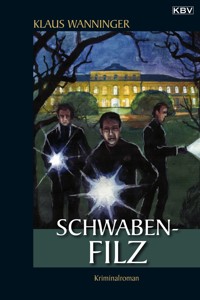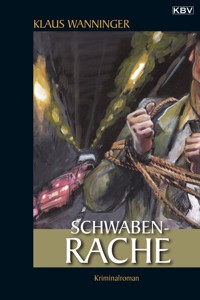Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Braig
- Sprache: Deutsch
Mord im Ländle: Der 22. Fall für Braig und Neundorf Kevin Scheuer liegt tot in der Garage. Überrollt von seinem schönen, neuen Elektro-SUV. Der Mann war ein grandioser Kotzbrocken, da sind sich die Nachbarn einig. Es scheint niemanden zu geben, der ihm nicht das Schlimmste gewünscht hätte. Irritiert nehmen die Kommissare Steffen Braig und Katrin Neundorf die große Freude über das Ableben Scheuers wahr. Alle scheinen ein gutes Motiv für einen Mord zu haben. Sei es, dass er Gartenzäune zu Schrott fuhr, stinkenden Guano-Dünger in die Häuser seiner Nachbarn warf, mit seiner Raserei Hunde und Katzen tötete oder gar eines der Kinder schwer verletzte … Leider sind die Alibis aller Nachbarn genauso wasserdicht wie die Motive handfest. Wer also hat Scheuer auf dem Gewissen? Braig und Neundorf in ihrem 22. Fall!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Schwaben-RacheSchwaben-MesseSchwaben-WutSchwaben-HassSchwaben-AngstSchwaben-ZornSchwaben-WahnSchwaben-GierSchwaben-SumpfSchwaben-HerbstSchwaben-EngelSchwaben-EhreSchwaben-SommerSchwaben-FilzSchwaben-LiebeSchwaben-FreundeSchwaben-FinsternisSchwaben-TräumeSchwaben-FestSchwaben-TeufelSchwaben-Donnerwetter
Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, lebt in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher 38 Bücher. Seine überaus erfolgreiche Schwaben-Krimi-Reihe mit den Kommissaren Steffen Braig, Katrin Neundorf und Harald Loose umfasst nun 22 Romane in einer Gesamtauflage von über 650.000 Exemplaren.
Klaus Wanninger
Schwaben-Nachbarn
Originalausgabe© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Umschlaggestaltung: Ralf KrampLektorat: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-95441-587-8E-Book-ISBN 978-3-95441-596-0
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Die Personen, Namen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen wäre rein zufällig. Selbst innerhalb Stuttgarts gibt es von Vorort zu Vorort teilweise verschiedene Ausspracheformen.
1. Kapitel
Nachbarn.
Ich weiß nicht, welche Gedanken dieser Begriff bei Ihnen auslöst. Angenehme, neutrale oder weniger erfreuliche. Vielleicht müssen Sie erst noch überlegen, welche Erfahrungen Sie bisher mit Nachbarn gemacht haben?
Ich nicht. Ich muss keine Sekunde überlegen. Bei mir sprudeln die Assoziationen sofort.
Nachbar? Dreckskerl, Verbrecher, sadistischer Gewalttäter, verkommener Halunke …
Ich kann Ihnen hier gar nicht alle Schimpfwörter wiedergeben, die mir durch den Kopf schwirren, sonst wären Sie bis zum Ende des Monats mit der Lektüre beschäftigt. Anders aber lässt sich die diabolische Existenz, die mich und meine Familie seit Jahren schikaniert, drangsaliert, bei Tag und oft auch des Nachts in den Wahnsinn treibt, nicht beschreiben.
Religiöse Fanatiker versuchten zu allen Zeiten, Menschen mit der Schilderung einer unvorstellbar bösen Gestalt einzuschüchtern, die im Jenseits auf sie warte, falls sie sich nicht augenblicklich den Vorstellungen der Religiösen unterwarfen. Mich können sie selbst mit den schlimmsten Schilderungen nicht beeindrucken, ich habe die widerlichste Ausprägung dieses Teufels in meiner unmittelbaren Umgebung über Jahre hinweg erlebt. Mein Nachbar. Verglichen mit diesem verkommenen Halunken sind die übelsten von Menschen erfundenen Horrorgestalten harmlose Wesen. Mein Nachbar. Der real existierende Teufel.
»Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben,
wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.«
Was für ein hohles Gefasel, dachte ich früher, wenn mir das Sprichwort zu Ohren kam. Heute urteile ich anders. Besser lässt sich unsere Situation nicht formulieren. Du kannst noch so viel Rücksicht nehmen, deine eigenen Interessen und Rechte so weit zurückstellen, dich fast unsichtbar machen, dem vermaledeiten Halunken gelingt es trotzdem jedes Mal aufs Neue, dich bis aufs Blut zu reizen, dich anzugreifen, fertigzumachen und zu erniedrigen, dir deine menschliche Würde zu rauben, so lange, bis du jede Lust am Leben verloren hast.
Und wenn du längst jede Gegenwehr aufgegeben hast und von seinen Aggressionen zerschmettert wehrlos am Boden liegst, sieht er keinen Anlass, Ruhe zu geben, sondern trampelt selbst dann noch voll sadistischer Häme auf dir herum, um dir endgültig den Rest zu geben.
Es sei denn …
Es sei denn, du begreifst, dass es so nicht weitergehen darf. Dass du es nicht länger einfach so hinnehmen kannst, dass der Kerl aus purer Rücksichtslosigkeit und bösem Willen Tag für Tag die Gesundheit und das Leben deiner Familie gefährdet und auf deine Kritik, deinen Einspruch, deine Drohungen in keiner Weise reagiert. Dass es damit ein Ende haben muss. Und dass dieses Ende nicht in ferner Zukunft, sondern unmittelbar vor dir liegt. Weil der Kerl wegmuss. Weil es sonst keine Ruhe gibt. Und weil du ein gutes Werk tust, wenn du für das Ende dieses Halunken sorgst. Ein gutes Werk? Das beste Werk der Welt!
Und dann raffst du dich auf und wehrst dich. Du stellst dich hin und schlägst zurück. Mit solcher Wucht und Gewalt, dass es ein Ende hat mit all seinen Aggressionen.
Ein endgültiges Ende …
2. Kapitel
Steffen Braig fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Schweißtropfen liefen ihm übers Gesicht, perlten über die Brust und den Rücken. Sein T-Shirt klebte auf der Haut. Die Luft schien zu stehen, das Thermometer zeigte an die dreißig Grad. Normale Temperaturen an einem Sommertag im August, nicht gerade der ideale Zeitpunkt für schwere körperliche Arbeit.
Seit mehr als zwei Stunden waren sie jetzt schon dabei, die zahlreichen mit Kies ausgelegten Flächen des Nachbargrundstücks von ihrem steinigen Ballast zu befreien. Schaufel auf Schaufel des schweren Materials landete in Dr. Genkingers Schubkarre; der Tierarzt bugsierte das schwankende Gefährt an den Rand des Gartens, wo es von ihrer Nachbarin Dr. Nicolette Mander in Empfang genommen und auf einem stetig wachsenden Hügel gelagert wurde. Braigs Partnerin blieb es gemeinsam mit ihrer Tochter und Katharina Mander vorbehalten, auf den Knien über den Boden zu robben, die Überreste der unter den Kieseln gelagerten Folien aufzuklauben und die Oberfläche mit spitzen Hacken mühsam aufzulockern. Mehr und mehr gelang es ihnen, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
Braig hielt einen Moment inne, nahm das Ergebnis ihrer schweißtreibenden Bemühungen erfreut wahr: Das kahle, bisher nur von ein paar Bonsaisträuchern notdürftig aufgelockerte Gelände war endgültig dabei, den Charakter der leblosen Steinwüste zu verlieren. Fehlte nur noch das am Rand des Grundstücks gelagerte Gemisch aus Muttererde und Humus, das im Anschluss an ihre Arbeit verteilt werden musste.
Wenige Jahre erst war es her, dass sie die grundlegende Veränderung des benachbarten Anwesens hatten mitansehen müssen. Im Gefolge des Verkaufs an die neuen Eigentümer war das alte, einen morbiden Charme verströmende Haus seiner Dachgauben und des rechteckigen Erkers beraubt worden, zudem der verwilderte, üppig grüne Garten terrassenförmig voneinander abgesetzten Kieselflächen zum Opfer gefallen. Mit ständig steigendem Verdruss hatte Braig mitsamt seiner Partnerin und ihrem Vermieter den Umbau verfolgt – juristisch ohnmächtig, weil alle vorgeschriebenen Bauleitlinien wie auch die notwendigen Abstände zur Grenze eingehalten worden waren. Der ganzjährig üppig grüne Dschungel vor der Haustür hatte einem kahlen, wüstenähnlichen Areal Platz gemacht.
Höhepunkt seines Missmuts war die Tatsache, dass sich ausgerechnet Söderhofer, der Oberstaatsanwalt, dessen aufgeblähte Geltungssucht und fachliche Inkompetenz Braig seit Jahren beruflich zu schaffen machte, als neuer Nachbar herausstellte. Daran vermochte auch die noch so freundliche Einladung zum Kennenlernen der neuen Eigentümer nichts zu ändern, ganz im Gegenteil. Braig hatte den Abend, obwohl er inzwischen mehrere Jahre zurücklag, noch allzu gut in Erinnerung.
»Das ist ein Magez«, hatte Söderhofer die Gäste begrüßt und auf eine Vitrine im Wohnraum gezeigt. »Ein junger Berliner Künstler. Harmonie des Seins. Wir dachten, wenn wir uns schon hier in der Provinz niederlassen, wollen wir Ihnen wenigstens einen Hauch international anerkannter Kunst zuteilwerden lassen, zu der Sie ja sonst keinen Zugang hätten. Zwei völlig unterschiedliche Materialien – und doch gelingt es dem Künstler in einzigartiger Weise, sie harmonisch miteinander in Beziehung zu bringen, finden Sie nicht auch?«
Braig hatte die beiden annähernd gleich großen, Maulwurfshügeln ähnlichen Ansammlungen betrachtet: links eine helle, am Rand ins Weiße tendierende Masse, rechts dasselbe in schlammig-dunklem, am Ende tiefschwarzem Ton. Sosehr er sich bemüht hatte, einen Zugang zu dem angeblichen Kunstwerk zu finden, es war ihm nicht gelungen. Seine einzige Assoziation war der Matsch der schlammigen Pfütze im Garten, in dem seine Tochter wenige Tage zuvor mit vor Begeisterung strahlenden Augen geplanscht hatte. Die Harmonie des Seins hatte verblüffende Ähnlichkeit mit dem übel riechenden Zeug, das sie ihr anschließend von der Haut und aus den Haaren gewaschen hatten.
Söderhofers neue Lebensgefährtin hatte Braig von der allzu intensiven Beschäftigung mit dem Kunstwerk befreit. Salopp in Jeans und eine bunte Bluse gekleidet, war die Zahnärztin mit leicht geröteter Miene auf sie zugekommen. Dem lauten Schimpfen nach, das kurz vorher zu hören gewesen war, hatte sie wohl eine heftige Auseinandersetzung mit ihrer Tochter gehabt, die den Besuchern mit unübersehbar mürrischem Blick und Kaugummi kauend gegenübergetreten war. Ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, hatte sie sich deutlich in ihrer Aufmachung unterschieden. Blaue Haare mit blutig roten Strähnen, zerrissene, von mehreren Löchern gezeichnete Jeans. Es hatte keiner Erläuterung bedurft, in welcher Lebensphase sie sich befand.
»Das ist unsere Katharina. Sie ist fünfzehn.«
Nicolette Manders Worte waren im Protest ihrer Tochter untergegangen. »Sechzehn«, hatte sie sie angegiftet. »In sechs Wochen bin ich sechzehn.« Sie hatte das Kaugummi vor ihrem Mund zu einer großen Blase anwachsen lassen, es dann mit einem lauten Knall zum Platzen gebracht.
Braig war es gerade noch gelungen, das Nasenpiercing der jungen Dame zu bewundern, da hatte sie sich schon wieder davongemacht.
Das Gesicht des Hausherrn war hochrot angelaufen. »Sie müssen entschuldigen«, hatte er mühsam hervorgebracht. »Katharina …«
»Sie ist in einem schwierigen Alter«, war ihm seine Partnerin zu Hilfe gekommen. Sie hatte sich beeilt, sie auf das außergewöhnlich reichhaltig ausgestattete Büfett aufmerksam zu machen, und darauf gedrängt, sich zu bedienen.
Das Feinste vom Feinen, war es Braig aufgefallen, ein fast unübersehbares, mit Delikatessen aller Art bestücktes Angebot. Er hatte lange überlegt, zu welchem der unzähligen, üppig belegten Fisch-, Fleisch-, Wurst-, Käse- oder Pflanzenhäppchen er greifen und welches Getränk er wählen sollte, hatte sich dann an seiner Partnerin orientiert.
Er war gerade dabei gewesen, eine Käsespezialität zu genießen, als er die Stimme unmittelbar neben sich hörte.
»Ihnen geht dieser saublöde Magez doch voll am Arsch vorbei.«
Überrascht hatte er sich zur Seite gewandt, Katharina Manders Blick auf sich gerichtet gesehen. »Der Magez?«
»Geben Sie es zu. Ich sehe es Ihnen doch an.«
Er hatte sich insgeheim ertappt gefühlt, mühsam nach einer Antwort gesucht. »Hauptsache, Ihrer Mutter gefällt es«, war es ihm stockend über die Lippen gekommen. »Und Ihrem Vater auch.«
»Ach was, mein Vater!« Das blau-rote Haarbüschel vor ihm war heftig in Bewegung geraten.
»Erstens ist der Typ nicht mein Vater, und außerdem: Der tut doch nur so scheinheilig, als würde ihm das gefallen. In Wirklichkeit kotzt der schon aus allen Rohren, wenn er nur den Namen eines dieser Künstler hört.« Ihre Stimme hatte alle Verachtung dieser Welt zum Ausdruck gebracht. »Der macht das nur, um anzugeben.«
»Na ja.« Braig hatte versucht zu beschwichtigen. »So ist das nun mal mit der Kunst. Den einen gefällt’s, den anderen nicht.«
»Das ist keine Kunst. Das ist Scheiße!«
Sie hatte ihre Worte so laut von sich gegeben, dass es weithin zu hören gewesen war. Mehrere Gäste hatten Braig und seine Gesprächspartnerin ins Visier genommen.
Oh Gott, womit habe ich das verdient?, war es ihm durch den Kopf gegangen. Weshalb hat sich das gepiercte Monster gerade mich zum Streiten ausgesucht?
Vor Katharinas Mund war eine neue Kaugummiblase gewachsen. Sie hatte sich immer weiter ausgedehnt, sich seinem Kinn bis auf wenige Zentimeter genähert. Obwohl er den Kopf zur Seite wandte, hatte er die Feuchtigkeit in seinem Gesicht gespürt, als die Blase platzte.
»Sie haben wohl Schiss, was?«, hatte das Monster gepoltert. »Und ich dachte, Sie sind Bulle.«
Braig hatte sich denken können, woher sie seinen Beruf kannte. Er wollte gar nicht wissen, was Söderhofer über ihn erzählt hatte. »Wieso soll ich Schiss haben?«, war er contra gegangen. »Und vor wem?«
»Was weiß ich. Für einen Bullen sind Sie jedenfalls ganz schön lahm.«
Ob seine Tochter sich in wenigen Jahren in ein ähnliches Monster verwandeln würde? Was konnte er tun, das zu verhindern? »Was erwarten Sie denn von mir? Soll ich meine Waffe ziehen und losballern?«
»Haben Sie überhaupt eine?«
»Sie kennen meinen Beruf. Dann wissen Sie doch aus dem Fernsehen, dass sich Verbrecher nur selten ohne Waffeneinsatz festnehmen lassen.«
»Fernsehen, pah!«, hatte sie gezischt, unablässig ihr Kaugummi schmatzend. »Wie abgefahren ist das denn? Glauben Sie, ich weiß nicht, dass diese dämlichen Krimis nichts mit Ihrem Job zu tun haben?«
Braig hatte seine Überraschung nicht verbergen können. »Darüber haben Sie sich schon Gedanken gemacht?«
»Sie halten mich für voll bescheuert, was? Das kleine Baby aus der Nachbarschaft. Hat noch keine Ahnung von der Welt. Soll erst mal erwachsen werden.«
»Das habe ich nicht gesagt«, hatte er sich verteidigt.
»Gesagt nicht, aber gedacht.« Sie hatte ihn mit durchdringendem Blick gemustert. »Geben Sie es zu?«
Er hatte nach Luft geschnappt. »Ich gebe es zu, ja.«
Einen Moment lang war sie ruhig geblieben. Sogar ihr lautes Schmatzen war plötzlich verstummt. Unsicher, wie er ihr Verhalten beurteilen sollte, hatte er sie misstrauisch betrachtet.
Erst nach mehreren Sekunden schien wieder Leben Besitz von ihr ergriffen zu haben. »Sie sind echt ein cooler Typ«, hatte sie erklärt, ihre Aussage mit mehrfachem Kaugummischnalzen bekräftigend.
»Cool? Wieso?«
»Sie sind der erste Erwachsene, der es zugibt.«
»Na ja.«
»Kann ich sie mal sehen?«
»Was?«
»Ihre Waffe natürlich. Also, ob Sie mir die mal zeigen?«
»Ja, wenn Sie wollen … Im Moment habe ich sie aber nicht hier. Ich bin ja privat eingeladen, nicht als Kriminalbeamter. Nehme ich jedenfalls an.«
»Das finde ich irre. Sie sind echt cool.« Das Monster hatte sein Kaugummi mehrmals schnalzen lassen.
Braig hatte sich eine Antwort erspart, weil die Gastgeberin mit fragendem Gesichtsausdruck auf sie zugetreten war.
»Oh, ich hoffe, liebe Nachbarn … Ich sehe schon die ganze Zeit meine Tochter in Ihrer Nähe. Hoffentlich hat sie sich ordentlich benommen …«
Lautes Kaugummischnalzen hatte ihre Worte unterbrochen.
»Kind, wie oft habe ich dir schon … Das gehört sich nicht! Tu das Zeug aus dem Mund!« Ihre Stimme hatte an Schärfe gewonnen.
»Er will mir seine Waffe zeigen«, hatte ihre Tochter erklärt. »Der ist echt cool.«
Nicolette Mander war verlegen zur Seite getreten. »Oh, mein Partner hat mir erzählt, dass Sie als Kommissar beim Landeskriminalamt tätig sind. Als sein bester Mann. Oder wollen Sie das nicht an die große Glocke …«
»Doch, Mama, das dürfen alle wissen, dass er Bulle ist«, war ihr das Monster ins Wort gefallen. »Und er will mir wirklich seine Waffe zeigen.«
»Bu… Katharina!« Die Zahnärztin hatte ihren Mund weit aufgerissen, Sekunden lang um Luft gekämpft. »Oh, Herr Kommissar, Sie müssen entschuldigen! Unsere Tochter ist in einem schwierigen Alter …« Am liebsten wäre sie wohl im Boden versunken. »Nehmen Sie es ihr bitte nicht …«
Braig hatte es ihnen nicht übel genommen. Weder der Mutter noch der Tochter. Er hatte in den folgenden Monaten nur versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen, besonders der Tochter. Was sich aufgrund seiner beruflichen Belastung als nicht allzu schwierig erwiesen hatte. Das Monster war ihm gegenüber, nachdem er ihm seine Dienstwaffe gezeigt und ausführlich deren Aufbau und Bedienung erklärt hatte, zwar überraschend freundlich und geradezu zivilisiert aufgetreten, was er sich in den folgenden Monaten jedoch von Söderhofer über dessen familiäre Situation hatte anhören müssen, kündete nicht gerade von revolutionären Verhaltensänderungen der Heranwachsenden. War der Oberstaatsanwalt anfangs noch peinlich darauf bedacht gewesen, sein Privatleben mit angeblich authentischen Heile-Welt-Schilderungen zu erklären, begann die Fassade bald mehr und mehr zu bröckeln. Kurzen Bemerkungen über vorlaute Gören folgten bald ausführliche Tiraden über missratene Wohlstandsbälger und verweichlichte, zu konsequenten Erziehungsmaßnahmen unfähige Mütter. Wie weit die Situation im Nachbarhaus nach kurzer Zeit eskaliert war, hatte Braig am Rand eines dienstlichen Gesprächs von der Sekretärin des Oberstaatsanwalts erfahren.
»Nehmen Sie sich in Acht«, hatte sie ihm am Telefon zugeflüstert. »Heute ist er überhaupt nicht zu ertragen.«
Braigs Konter: »Ist das nicht immer so?«, hatte sie eine Erklärung angefügt.
»Er schläft seit Tagen im Büro. Der Haussegen hängt schief. Und wie. Seine Tochter. Da herrscht Kriegszustand.«
Er hatte die Information kommentarlos aufgenommen, sich Söderhofer gegenüber nichts von seinem Kenntnisstand anmerken lassen. Mitleid mit dem Mann war selbst dann nicht in ihm aufgekommen, als dem Oberstaatsanwalt mitten in einer beruflichen Unterhaltung eine seine private Situation entlarvende Frage herausgerutscht war.
»Braig, wie oft hat Ihre Tochter Sie schon als Arschloch bezeichnet?«
»Meine Tochter?«
»Vergessen Sie’s!«
Wenige Monate später hatte er das Monster nach einem arbeitsreichen Tag zu Hause im Kreis seiner Familie angetroffen.
»Katha hat mit mir die Igel versorgt«, hatte ihn seine Tochter mit vor Begeisterung leuchtenden Augen empfangen. »Sie will jetzt jeden Tag mithelfen.«
Braigs Überraschung war ihm unübersehbar ins Gesicht geschrieben gewesen.
»Nur, wenn Sie nichts dagegen haben«, hatte das Monster zögernd erklärt.
»Papa hat nichts dagegen«, war ihm Ann-Sophie zuvorgekommen. »Er freut sich.«
In der Tat wurde im Haus Dr. Genkingers jede helfende Hand dringend benötigt. Der Tierarzt, bekannt für seine altruistische Ader, wurde überhäuft mit verletzten, hungernden oder bei ihren bisherigen Besitzern nicht mehr erwünschten Tieren. Alle paar Wochen fanden sich Kartons oder Taschen mit schreienden oder winselnden Geschöpfen im Randbereich des Grundstücks, fast alle anonym entsorgt. Braig, dessen Partnerin in der Praxis mitarbeitete, lebte wie der Veterinär seit Jahren mit einer ständig wechselnden Zahl von Tieren, ein Zustand, der von seiner Tochter mit großer Begeisterung begrüßt wurde. Immer neue Freundinnen und Mitschülerinnen waren im oder ums Haus mit der Betreuung beschäftigt. Was war da gegen zwei weitere helfende Hände einzuwenden?
So skeptisch Braig das plötzliche Auftauchen des Monsters in seinem Umfeld anfangs wahrgenommen hatte, das Verhalten der jungen Nachbarin strafte alle Vorurteile Lügen. Sie half mit bei der Versorgung der Tiere, beteiligte sich bei der Futtersuche im Garten und in der freien Natur, war sogar in der Küche tätig, wenn es galt, nicht nur Braigs Familie, sondern auch den Tierarzt und dessen Partnerin gemeinsam zu verköstigen. Bei immer mehr Mahlzeiten war sie wie selbstverständlich dabei. Braig nahm verwundert wahr, wie sie den Tierarzt mit tiefschürfenden Fragen nach den Bedürfnissen, dem Wohlergehen und der Überlebensfähigkeit biologischer Arten bestürmte, merkte am Verhalten des Veterinärs, wie sehr er sich über das Interesse der Heranwachsenden freute. Dr. Genkinger gab sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden, er versuchte vielmehr, bis ins Detail auf die jeweilige Problematik einzugehen und Katharina Mander zu weitergehendem Nachforschen zu ermuntern, bot ihr sogar an, ihn auf ausgewählte Hausbesuche zu begleiten. Begeistert sagte sie zu.
Kurz darauf sah Braig sie gemeinsam mit ihrer Mutter in einer der mit Kies ausgelegten Flächen vor ihrem Haus arbeiten. Er begriff erst nach einer Weile, womit die beiden Frauen sich da abplagten: Sie schaufelten die Steine aus dem etwa fünf auf sechs Meter großen Areal und füllten es stattdessen mit Erde auf.
»Meine Tochter engagiert sich jetzt bei Fridays for Future für den Klimaschutz. Und zum Zeichen dafür, dass wir es ernst meinen, pflanzen wir unser eigenes Gemüse an. Wir versuchen es zumindest«, erklärte Nicolette Mander.
Braig glaubte, einen stolzen Unterton in ihrer Stimme gehört zu haben.
Die Gurken, Zucchinis und Salate schienen zwar bei Weitem nicht so erfolgreich zu gedeihen, wie sich die junge Gärtnerin das erhofft hatte, ihr Beispiel jedoch wirkte ansteckend.
»Papa, in ein, zwei Jahren, wenn ich etwas älter bin«, eröffnete ihm Ann-Sophie eines Abends, »arbeite ich auch bei Fridays for Future mit. Unser eigenes Gemüse können wir aber jetzt schon anbauen.«
In Absprache mit Dr. Genkinger zimmerten sie in den folgenden Wochen zwei mehrere Meter lange Hochbeete, füllten sie mit Pflanzenresten und Erde und versuchten es mit ersten Salat- und Gemüsesetzlingen.
Dass es sich bei dem überraschenden Engagement der jungen Nachbarin nicht um einen dem Zeitgeist geschuldeten Spleen handelte, merkte Braig, als er Katharina Mander mit Beginn des Sommers mehrere Tage nicht mehr zu Gesicht bekam und dies seiner Tochter gegenüber zum Ausdruck brachte.
»Ferien, Papa«, sagte Ann-Sophie vorwurfsvoll. »Katha ist weg.«
»Sie wollte ans Meer, baden, oder?«
»Oh, du vergisst aber auch alles«, schimpfte seine Tochter. »Katha ist in Tübingen auf einem Seminar.«
Er hatte es nicht glauben wollen, aber Katharina Mander hatte ihre Ankündigungen wahr gemacht. Zwei Wochen, ihre kompletten Pfingstferien opferte sie einem eigens für junge Leute angebotenen Kolleg von Wissenschaftlern der Universität Tübingen. Von alternativen Formen der Landwirtschaft bis zur Verkehrswende – Maßnahmen gegen den Kollaps des Weltklimas.
Es musste sich um eine tiefgründige Einarbeitung in das hochkomplexe Thema gehandelt haben, wurde Braig jedes Mal klar, wenn er sich in der Folgezeit mit der jungen Frau unterhielt. Sie sprühte vor hintergründigem Wissen, war zudem ständig bemüht, es um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern und sich in der Auseinandersetzung mit Gegenargumenten zu schulen. Offensichtlich war sie auch nicht bereit, dem üblichen Gehabe der Erwachsenen gemäß über ihre Erkenntnisse nur zu schwafeln, auf die notwendigen praktischen Konsequenzen aber zu verzichten.
»Braig, das unverschämte Biest verlangt, dass meine Partnerin und ich unsere Autos aufgeben«, schleuderte ihm Söderhofer ein paar Wochen darauf mitten in einer dienstlichen Besprechung mit vor Entrüstung bebender Stimme entgegen. »Wir sollen auf Elektrofahrräder umsteigen oder mit Bus und Bahn fahren. Ich, als Oberstaatsanwalt! Und wissen Sie, wen die verkommene Göre uns ständig als Kronzeugen präsentiert, dass der Schwachsinn machbar sei: Sie, der coole Kommissar mitsamt Familie!« Seine Stimme drohte sich zu überschlagen.
Braigs Konter: »Sie können stolz sein auf Ihre Tochter! Herzlichen Glückwunsch!«, nahm er nur mit unübersehbarem Widerwillen wahr.
Dann, unmittelbar vor den Sommerferien, kam die Idee von der Realisierung eines an ökologischen Leitlinien orientierten Gartens auf dem Nachbargrundstück auf. Braig hörte aus dem Mund seiner Tochter zum ersten Mal davon.
»Da machen wir alle mit, Papa«, erklärte sie. »Ich habe es Katha fest versprochen.«
Ohne eine Sekunde zu zögern, hatte er zugesagt, seiner jungen Nachbarin zuliebe. »Mit dem Risiko, mitten während der Arbeit an irgendeinen Tatort gerufen zu werden. An dem Wochenende habe ich Bereitschaft.«
Braig war gerade dabei, eine neue Ladung Kiesel in Dr. Genkingers Schubkarre zu versenken, als er sein Handy läuten hörte. Der Signalton verhieß nichts Gutes. Der Anruf kam aus dem Amt. Er warf die Schaufel zur Seite, zog sein Mobiltelefon aus der Tasche, nahm das Gespräch an. »Braig.«
»Es ist so, wir haben eine Leiche«, hörte er Stöhrs Stimme.
»Wo?«
»Männlich, sieht übel aus.«
»Wo?«, brüllte er.
Ann-Sophie schaute zu ihm auf, verzog ihr Gesicht.
»Mhm, Stadtrand Stuttgart, Richtung Fellbach. Schwarzrieslingstraße. Sie übernehmen?«
»Ja. Dreißig Minuten. Ich muss zuerst noch duschen. Spurensicherung?«
»Ist informiert«, bestätigte der Kollege. »Es ist so, alle Infos per Mail, wie immer.«
Braig steckte sein Handy weg, hob beide Hände. »Tut mir leid. Ihr müsst es ohne mich schaffen.«
»Ein Toter?«, hörte er Katharina Mander fragen.
Seine Tochter nahm ihm die Antwort ab. »Wenn die Papa rufen, hat es immer jemand erwischt.«
»Einfach cool, dein Vater.«
3. Kapitel
Ein sanfter Wind strich durch die Büsche und Blumenrabatten, als Braig in der Schwarzrieslingstraße anlangte. Der intensive Duft unzähliger Blüten stach ihm in die Nase.
Er bemerkte, dass er keine zwölf Minuten für den Weg benötigt hatte, nahm die völlig veränderte Umgebung wahr. Es musste mehrere Jahre her sein, dass er sich zum letzten Mal hier aufgehalten hatte. Die vom ständig tosenden Autolärm verunstaltete Straße war an ihrer schmalsten Stelle gekappt und in eine verkehrsberuhigte Sackgasse verwandelt worden, ein genialer Schachzug der Stadtplaner und zuständigen Politiker. Zwischen den großen Gewächshäusern zweier Gärtnereien erstreckte sich jetzt ein kleiner, etwa hundert auf dreißig Meter großer Park, der nur von einem asphaltierten, allein Fußgängern und Radfahrern vorbehaltenen Weg durchquert wurde. Der Zucchini-Weg mündete direkt in das Ende der zur Sackgasse umfunktionierten Schwarzrieslingstraße, die von gepflegten Vorgärten und schmucken Einfamilienhäusern gesäumt wurde. Sommerlich grüne Büsche und Bäume, Blumenrabatten in allen Farben, die Wände hochrankende Rosen, akkurat kurz geschnittene Rasenflächen vor hell verputzten, von schmalen Erkern und spitzgiebligen, roten Ziegeldächern geprägten Gebäuden. Eine gutbürgerlich wirkende, auf Ordnung und erträgliches Miteinander bedachte Gegend, in der Kriminalbeamte, zumindest in der Ausübung ihres Berufes, fehl am Platz waren, überlegte Braig.
Das geradezu traumhaft wirkende Panorama, das sich über den Häusern der östlichen Straßenseite auftat, verstärkte diesen Eindruck noch: Eingebettet in ein fast unübersehbares Meer im warmen Licht der Sonne leuchtender, sanfte Hügel erklimmender Weinreben erhob sich die bewaldete Anhöhe des Kappelbergs. Etwas weiter entfernt schien das filigrane Gebäude der Grabkapelle der Königin Katharina im Dunst der mittäglichen Hitze über den Dächern zu schweben. Hier, wo die Ausläufer Stuttgarts und Fellbachs kaum merklich ineinander übergingen, bot sich eine landschaftliche Szenerie, die ihresgleichen suchte. Ein fast überirdisch schönes, pittoreskes Postkartenidyll.
Braig hatte Mühe, sich zu erinnern, dass er sich aus beruflichen Gründen hierher aufgemacht hatte, stieg an der Mündung des Zucchini-Wegs in die Schwarzrieslingstraße von seinem Pedelec. Er sah die mit bunter Kreide auf den Asphalt gemalten Markierungen, die Kinder für ihre Spiele nutzten, erinnerte sich augenblicklich an seine Zeit als Heranwachsender, die er mitten in der Großstadt hatte verbringen müssen. Für Kinder hatte man dort keinen Platz reserviert, weder in der viel zu kleinen Wohnung noch draußen auf dem über und über mit Blechkarossen aller Art vollgeparkten Asphalt. Das Haus ohne Begleitung seiner Mutter zu verlassen, war viel zu gefährlich gewesen, überall hektischer Verkehr. Der schmale, alle paar Meter von Fahrzeugen zugestellte Gehweg kaum passierbar, der nächste Zebrastreifen zum Überqueren der von kreischendem Lärm erfüllten Betonpiste mehrere Hundert Meter entfernt. Was für ein Kontrast zu diesem eigens Kindern gewidmeten Paradies!
Braig passierte einen Vorgarten mit einer auffällig bunten Skulpturenkolonie, die fast bis zur Straße reichte, schob sein Fahrrad an Gruppen sich laut miteinander unterhaltender Leute vorbei. Als er sich einer leichten Rechtskurve der Straße näherte, bemerkte er unmittelbar dahinter die Ansammlung mehrerer Menschen auf der rechten Seite. Kinder, Jugendliche und Erwachsene standen am Rand der Straße, von zwei uniformierten Polizeibeamtinnen nur mühsam ferngehalten. Zwei mit hellen Arbeitsmonturen bekleidete Techniker waren dabei, das Innere der offen stehenden Doppelgarage mit einer großen Plane abzudecken. LKA prangte in dicken Lettern auf ihren Gerätschaften.
Er passierte die Ansammlung laut krakeelender Neugieriger, wies sich den uniformierten Beamtinnen gegenüber aus. Eine der beiden Frauen hob das rot-weiße Flatterband in die Höhe, ließ ihn passieren.
Er stellte sein Fahrrad ab, grüßte die Kriminaltechniker.
»Ideales Wetter zum Radfahre.« Helmut Rössle richtete sich auf, warf einen anerkennenden Blick auf Braigs Gefährt. »Wenn i mi net um die Sauerei do kümmere müsst, wär i au mit meim Drahtesel onderwegs.« Er zeigte hinter die inzwischen stabilisierte, blickdichte Plane.
Braig sah die stark lädierte Rückfront eines klobigen, schwarz lackierten SUVs vor sich, der fast drei Meter aus der Doppelgarage ragte. Die rückwärtige Scheibe war vollkommen zersplittert, in ihrer linken Hälfte gähnte ein großes Loch. Das breite Fahrzeug beanspruchte den größten Teil des Innenraums für sich, ließ nur noch einem guten Dutzend neben- und übereinander gestapelter Kisten und Kartons sowie einem Motorrad Platz. Zwei große Deckenleuchten tauchten die Garage der Tribüne eines Theaters ähnlich in helles Licht. Kein Wunder, dass die Menschenmenge auf der Straße nur schwer zu beruhigen war. Wie neugierige Zuschauer einer Premierenaufführung warteten sie darauf, einen ungetrübten Blick in die Garage werfen zu können. Fehlten nur noch die Ferngläser, überlegte Braig, die lauten Kommentare hinter sich im Ohr.
»Wieso versauet die Dackel ons die Sicht mit der Scheißplane? I han extra mei Handy mitbrocht, weil i den Kerl fotografiere wollt. Wenn der wirklich he isch, müsset mir des doch feiere.«
»Der isch doch völlig zermatscht, du Bachel. Von dem isch nix me übrig.«
»Woher willsch denn des wisse?«
»Weil die Ariane des gsait hat. Ihrn Robert war in der Garasch und hat den entdeckt. Der war so fertig, dass er net amol mehr die Bollizei hat rufe könne. Des hat sei Ariane für ihn do.«
Braig versuchte, das nervende Geschrei nicht an sich heranzulassen. Gaffende und mit ihren Handys ungeniert das notdürftig abgeschirmte Gelände filmende Passanten gehörten inzwischen zu fast jeder Szenerie, an der ein Mensch verunglückt oder getötet worden war. Oft genug hatte er es schon erlebt, dass skrupellose, sensationsgeile Typen die Polizeiabsperrungen durchbrachen und die verunstalteten, wehrlosen Opfer mit ihren Kameras abzulichten versuchten. Das waren die Momente, in denen er jedes Mal aufs Neue Mühe hatte, die Contenance zu bewahren.
Er richtete seinen Blick ins Innere der Garage, bemerkte die dunklen Schlieren auf dem Boden. Sie verliefen unter und neben dem Auto, schienen bis zur Rückwand zu reichen. Er hüllte Schuhe und Hände in Plastiküberzüge, hörte die Stimme Rössles.
»Sei vorsichtig! Des isch koi scheene Sach!«
»So schlimm?«
»Des isch koin Ausdruck«, mahnte der Spurensicherer. »So was g’hört verbote!«
Braig verweilte für den Moment einer Sekunde unmittelbar vor der Rückfront des Wagens, starrte durch das offensichtlich durch den Aufprall eines schweren Gegenstands verursachte Loch ins Innere. Ein scharfer, nach Jauche stinkender Geruch stach ihm in die Nase. Er stellte fest, dass der gesamte Innenraum von unzähligen Glassplittern übersät war, bemerkte die großflächige Verschmutzung, die die meisten Sitze und deren Rückenlehnen verunstaltete. Bräunliche Placken mit dicken, dunklen Rändern, wohin er auch sah. Auf dem rechten Vordersitz entdeckte er eine aufgerissene, grüne Plastikflasche mit ausgelaufener, graubrauner Flüssigkeit, direkt daneben einen klobigen, runden Stein. Angewidert von dem Gestank schob er sich auf die linke Seite des Fahrzeugs.
Der Anblick war unmöglich zu ertragen. Trotz der Warnung des Kollegen sah er sich völlig überrumpelt. Er spürte, wie ihm der Schweiß aus den Poren schoss, rang nach Luft. Seine Atmung schien für einen Moment auszusetzen. Ein Schwindelanfall ließ ihn taumeln. Er klammerte sich an einer großen Kiste fest, wandte den Kopf zur Seite. Der Anblick ging ihm trotzdem nicht aus dem Sinn. Er hatte sich ihm innerhalb einer Tausendstelsekunde eingebrannt.
Der Mann auf dem Boden der Garage. Von den Haaren bis zur Schulter unter dem breiten Auto hervorragend. Seine weit aufgerissenen, scheinbar von Überraschung gezeichneten Augen. Die dunkle, längst vertrocknete Lache um seinen Kopf. Sein Hals. Der Ansatz seiner Brust. Der Rest …
Die Vorderräder des Fahrzeugs jenseits des Körpers. Der größte Teil des Bodens von einer fleischigen Masse bedeckt. Den Teilen des Körpers, die von der schweren Karosse überrollt worden waren …
Braig kramte in seiner Hosentasche, ertastete eines der Hustenbonbons, die er selbst im Hochsommer für Momente wie diesen fast immer bei sich trug, zog es hervor. Es dauerte eine Weile, bis er es endlich aus seiner Umhüllung befreit hatte. Der mentholhaltige Geschmack verschaffte ihm Erleichterung. Er schob das Bonbon auf seiner Zunge hin und her, spürte, wie sich seine Verkrampfung löste. Langsam zwar, quälend langsam, aber immerhin. Nach zwei, drei Minuten fühlte er sich wieder imstande durchzuatmen.
Er wagte einen neuen Blick auf den Toten, versuchte, sein ursprüngliches Aussehen und sein Alter zu erahnen. Es war unmöglich. Die Muskulatur des Gesichts zu verzerrt, die meisten Hautpartien zu stark verformt und verfärbt.
Er richtete seine Augen auf die seltsam verzogene Schulter des Mannes, konnte den Ansatz eines Sweatshirts und einer Jacke erkennen. Viel zu warm für diesen Tag bekleidet, ging es ihm durch den Kopf, der musste ganz schön geschwitzt haben.
Quer über den Hals der Leiche hinweg, fast parallel zu dem Fahrzeug, lagen die beiden jeweils etwa zwei Meter langen Stränge eines zur Schlinge geformten Seils. Neuwertig aussehendes, helles Material, etwa einen Zentimeter dick, die Schlinge nur wenige Handbreit vom Körper des Toten entfernt. Was hatte es mit dem Seil auf sich? Hatte er sich damit gegen seinen Mörder wehren wollen, war aber von dessen schneller Attacke daran gehindert worden?
Es kostete einige Überwindung, über den Kopf des Mannes und die gewaltige eingetrocknete Blutlache zu steigen. Hatte er rücklings auf dem Boden gelegen, als er von dem schweren Fahrzeug überrollt wurde, oder war er von dem Monstrum erst umgestoßen und dann zerquetscht worden? Braig musterte die Frontpartie des SUV, entdeckte vor allem auf der rechten Seite mehrere große Kratzer und eine ganze Menge tiefer Dellen. Die Kratzer zogen sich fast alle quer über die Beifahrerhälfte, einige tief in den Lack reichend, die Dellen … Er sah sich außerstande, ihre Herkunft zu beurteilen, musste die Techniker bitten, sich darum zu kümmern.
Braig wandte sich der Rückwand der Garage zu, entdeckte ein dunkles Kabel. Es ragte in mittlerer Höhe aus einer Steckdose, schlängelte sich dann ungefähr zwei Meter weit über den Boden. Ein Ladekabel, wurde ihm klar. Es schien sich um ein Elektroauto zu handeln.
Er umrundete den SUV, sah sich den Überresten eines Fußes gegenüber. Das rechte Vorderrad hatte den untersten Teil des Körpers überrollt, nicht viel davon übrig gelassen. Er bückte sich nieder, suchte nach dem zweiten Fuß, spürte erneut Übelkeit in sich aufsteigen. Das rechte Bein des Mannes …
»Willsch net wieder an d’ frische Luft?«
Er hörte die Stimme Rössles, ließ von dem Auto ab. Als er ins Freie trat, sah er beide Spurensicherer vor sich.
»Ist ganz schön heftig, wie?«, meinte Dr. Kai Dolde.
Braig war zu keiner Antwort fähig. Er massierte seine schmerzenden Schläfen, deutete ein kurzes Nicken an. Sooft er sich in seinen mehr als zweieinhalb Jahrzehnten Berufserfahrung auch schon mit dem Anblick und der Untersuchung toter Menschen konfrontiert gesehen hatte, zur Routine war ihm dieser Vorgang nicht geworden. Smarte, mit coolem Grinsen von einer Leiche zur nächsten spazierende Kommissare gab es vielleicht in Fernsehkrimis – mit der Realität, wie er sie kannte, hatte das nichts zu tun. Einen Toten zu begutachten, gehörte zu den unerfreulicheren Momenten seines Berufes – auch langjährige Praxis hatte daran nichts geändert. Es handelte sich schließlich nicht um eine aus Kunststoff gefertigte Puppe, deren Überreste er vor sich sah, sondern um einen vor kurzer Zeit mitten aus dem Leben gerissenen Menschen, dem in seinen letzten bewussten Augenblicken übel mitgespielt worden war.
»Das war kein Unfall«, versuchte er, seinen Eindruck auf den Punkt zu bringen. »Der kam nicht aus Versehen ins Rollen.«
»Alle achtzig Deifel von Sindelfinge, danach sieht’s wirklich net aus«, pflichtete Rössle ihm bei. »Der Karre hat vorne mehrere Delle. Der isch mit Karacho uf den druff und hat ihn überrollt. Mir gucket uns das Blech genau a.«
»Der Schlüssel scheint auch zu fehlen«, setzte Dolde hinzu. »Wir haben ihn jedenfalls noch nicht entdeckt.«
»Der Schlüssel?«
»Darüber han i mi au gwundert«, erklärte Rössle. »Damit isch die Sach wohl klar.«
»Was ist mit dem Stein? Wurde er während der Fahrt damit attackiert?«
»Wohl kaum«, meinte Dolde. »Wir fanden einen winzigen Glassplitter, hier, keine dreißig Zentimeter von dem Auto entfernt. Er scheint zu der Scheibe zu gehören. Vielleicht der einzige, der nicht im Innenraum landete.«
»Das heißt, der wurde hier …« Braig spürte, wie es hinter seinen Schläfen pochte, fuhr sich über die schmerzenden Stellen. So schnell würde das nicht nachlassen, dafür kannte er seinen Körper inzwischen gut genug.
»Hier verbringen Sie also Ihren Samstagmittag«, riss ihn eine bekannte Stimme aus seinen Gedanken. »Schöne Gegend, fast wie im Urlaub. Wer macht uns Arbeit?«
Braig sah auf.
Dr. Schäffler, der Gerichtsmediziner, kam auf sie zu, begleitet von erneuter Unruhe hinter dem rot-weißen Flatterband.
»Dän’t Se mol gfälligschd die Plane weg!«, rief eine ältere Frau. »Mir wellet sehe, ob’s den Dreckskerl tatsächlich erwischt hat!«
»Der scheint net bsonders beliebt gwese zu sein«, kommentierte Rössle.
Braig schüttelte angewidert den Kopf, konzentrierte sich auf den Arzt.
»Sie sehen mitgenommen aus«, erklärte der Mann. »Ist es so schlimm?«
Der Kommissar atmete kräftig durch, nickte.
»Leck die Katz am Arsch«, bestätigte Rössle. »Des isch wirklich heftig.«
Der Gerichtsmediziner musterte ihn mit großen Augen, pfiff leise. »Wenn Sie das sagen, Rössle. Und ich dachte, ich hätte das Schlimmste hinter mir.«
»Nicht Ihr erster Einsatz heute?«