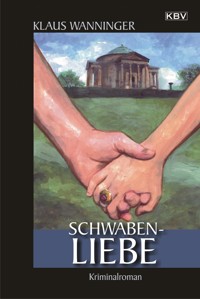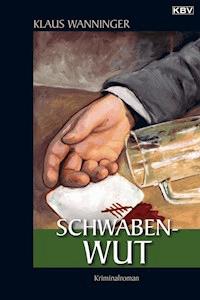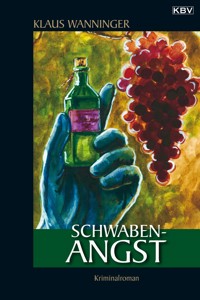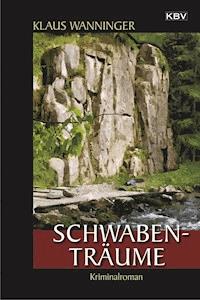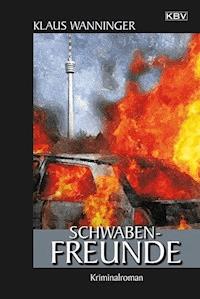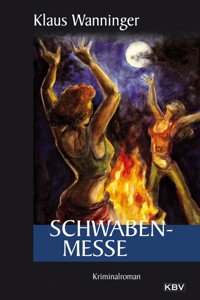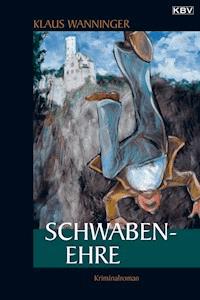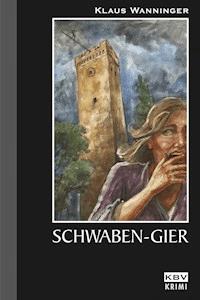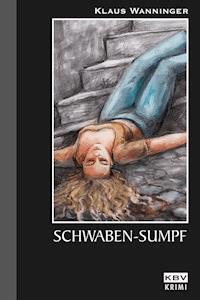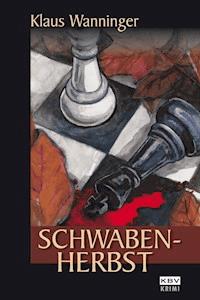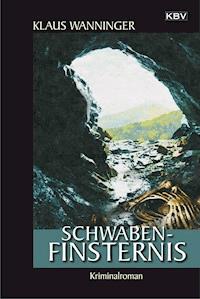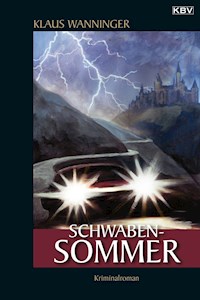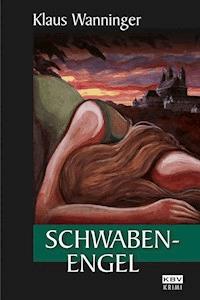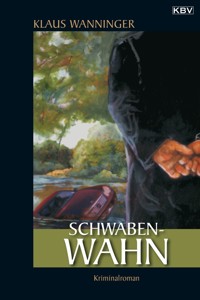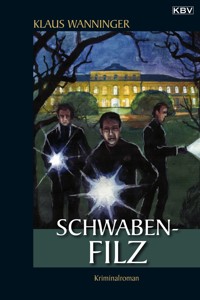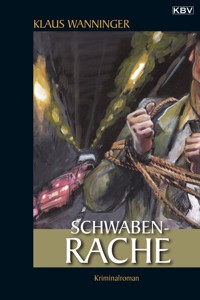Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Braig & Neundorf
- Sprache: Deutsch
Die Verbrechen der Zukunft und die Sünden der Vergangenheit Stuttgart im Jahr 2073: Mitten in einem sintflutartigen Dauerregen, der Teile der Stadt und des Umlands in reißenden Fluten und unter verheerenden Hangrutschen verschwinden lässt, stößt Ann-Sophie Braig auf die sterblichen Überreste eines Mannes, der Jahre zuvor für den Tod unzähliger Menschen als Folge eines havarierten CO2-Speichers verantwortlich gemacht wurde. Weil das Opfer einen migrantischen Hintergrund aufweist, vermutet die erfahrene, seit langen Jahren im Beruf ihres Vaters tätige Kriminalhauptkommissarin, dass das Verbrechen in die Reihe fremdenfeindlicher Morde einzuordnen ist, mit denen selbsternannte Vaterlandsverteidiger auf die wachsende Zahl der Zuwanderer reagieren, die infolge der Klimaveränderung aus ihren Heimatländern vertrieben werden. Nach unermüdlichen Ermittlungen gelingt es Ann-Sophie, die wahren Hintergründe des Verbrechens aufzudecken, und es wird ihr wieder einmal bewusst, dass auch in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts aus dem Gleichgewicht geratene Emotionen oft das Fundament für mörderische Entgleisungen sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Schwaben-Rache
Schwaben-Messe
Schwaben-Wut
Schwaben-Hass
Schwaben-Angst
Schwaben-Zorn
Schwaben-Wahn
Schwaben-Gier
Schwaben-Sumpf
Schwaben-Herbst
Schwaben-Engel
Schwaben-Ehre
Schwaben-Sommer
Schwaben-Filz
Schwaben-Liebe
Schwaben-Freunde
Schwaben-Finsternis
Schwaben-Träume
Schwaben-Fest
Schwaben-Teufel
Schwaben-Donnerwetter
Schwaben-Nachbarn
Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, lebt in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher 40 Bücher. Seine überaus erfolgreiche Schwaben-Krimi-Reihe umfasst nun 23 Romane in einer Gesamtauflage von über 700.000 Exemplaren.
Klaus Wanninger
Schwaben-Zukunft
Originalausgabe
© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-632-5
E-Book-ISBN 978-3-95441-642-4
Treffen sich im Weltall zwei Planeten.
»Wie geht’s?«, fragt der eine.
»Nicht so gut«, antwortet der andere.
»Wieso?«
»Ich habe eine schlimme Krankheit: Homo sapiens.«
»Ach, das hatte ich auch.
Keine Angst, das geht schnell vorbei.«
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, werde ich dennoch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.
(nach Martin Luther)
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Nachwort
Montag, 14. August 2073
Die wichtigsten Nachrichten des Tages in Kürze:
New York endgültig vom Meer überflutet:Zigtausende Tote
Auch die neuen Spezial-Sperrwerke vor der Küste rings um die Stadt konnten den Untergang nicht länger aufhalten. Die von den Ausläufern des Hurrikans Donald ausgelöste Sturmflut riss einen Teil des angeblich unüberwindbaren Bollwerks im Meer aus seiner Verankerung. Eine bis zu 20 Meter hohe Flutwelle schoss daraufhin über die Stadt hinweg und zerstörte einen großen Teil der Infrastruktur. Wie schon bei der Überflutung Bostons im vergangenen Herbst hatten die Behörden nicht mit dem Verlust der Schutzvorrichtungen gerechnet und die Stadt daher nicht evakuiert. Jetzt müssen Zigtausende aus den stabil gebliebenen, aus dem Wasser ragenden Hochhäusern gerettet werden. Wie viele Menschen bisher ihr Leben verloren, ist unklar. Zum Glück hatte ein Großteil der Bevölkerung die Stadt schon in den vergangenen Jahren aufgrund vorheriger Sturmfluten verlassen.
Mutation des West-Nil-Virus:München komplett von der Außenwelt isoliert
Nach mehr als 2500 Todesfällen innerhalb der letzten fünf Tage in München wurde die Stadt von mehreren Einheiten der Bundeswehr von der Umgebung abgesperrt. Aufgrund der extremen Hitze konnten sich Mücken, die die extrem gefährliche Virus-Mutation verbreiten, massenweise vermehren. Die Erreger verursachen bei immer mehr Menschen Hirnhautentzündungen mit meist tödlicher Wirkung.
Kämpfe in Flüchtlingslager in Griechenlandfordern mehrere tausend Tote
Die seit Wochen andauernden Auseinandersetzungen im größten der insgesamt 15 Flüchtlingslager in Griechenland forderten allein am Wochenende über 10.000 Tote. Die Kämpfe in dem mit geschätzt 30 Millionen Flüchtlingen aus Afrika und Asien völlig überfüllten Areal, das sich fast über den ganzen Peloponnes hinweg erstreckt, entzündeten sich aus dem Streit verschiedener Volksgruppen um das begehrte Gut Wasser. Die am Grenzzaun in Nordgriechenland stationierten europäischen Streitkräfte erklärten, für Europa bestehe keine Gefahr. Es herrsche strenger Schießbefehl, um jeden Grenzübertritt zu verhindern. Man habe die Lage im Griff.
Intensive Regenfälle in weiten Teilen Kerneuropas
Bei seit Tagen unvermindert anhaltenden, extrem starken Niederschlägen wurden Teile des Alpenraums, des Alpenvorlands und verschiedener Mittelgebirge überschwemmt und von Murenabgängen, Gerölllawinen und Bergstürzen verschüttet. Allein im bayerischen Alpenraum kamen etwa 500 Menschen ums Leben. In Stuttgart starben bei Hangrutschungen bisher über 100 Menschen.
1. Kapitel
Mitten in der Nacht schreckte Ann-Sophie Braig aus dem Schlaf. Atemlos, mit pochendem Herzschlag und schweißnassen Händen lauschte sie auf Geräusche aus der Umgebung. Das kräftige Prasseln unablässig vom Himmel schießender Wassermassen übertönte nach wie vor alles andere. Zwei volle Tage und – soweit sie es mitbekommen hatte – auch die ganze bisherige Nacht hatte es wie aus Kübeln geschüttet. Wolkenbruchartig waren unübersehbare Kaskaden intensiven Regens über der Stadt und dem Umland niedergegangen, genau wie es die Meteorologen angekündigt hatten. Den Versuchen, Teile der Wolken mit intensiven Gaben von Silberjodid schon vor dem Erreichen dicht bewohnter Gebiete zum Ausregnen zu bringen, war nur bescheidener Erfolg beschieden; sämtliche Bemühungen, die feuchtigkeitsgesättigte, warme Luftmasse, die genau über Stuttgart zum Stillstand gekommen war, wieder in Bewegung zu setzen, waren fehlgeschlagen. So war nichts geblieben, als die Bevölkerung vor den drohenden Gefahren partieller Überschwemmungen zu warnen.
Jetzt aber wurde das Trommeln des Wassers von etwas anderem überlagert. Einem seltsamen, angstauslösenden Geräusch. Es hörte sich an wie ein dumpfes, aus den Tiefen der Erde aufsteigendes Rumoren.
Sie richtete sich eine Hand breit auf, lauschte. Ihr Puls arbeitete dermaßen heftig, dass er für eine Weile alles andere übertönte. Er hämmerte und lärmte, kam erst nach mehreren Minuten wieder zur Ruhe. Ann-Sophie Braig spürte, wie sich die zarten Haare auf ihrem Arm aufrichteten. Ein Rumpeln und Knarzen, als ob sich Teile der Erde bewegten, dann plötzlich eine nicht enden wollende Abfolge ohrenbetäubender Schläge, ein Prasseln und Tosen wie bei einem Erdbeben.
Irgendwo kreischten Menschen; selbst die mehrfach verglasten Fenster vermochten es nicht, ihre Schreie vollkommen fernzuhalten. Sie kamen von weiter her, nicht aus den Räumen oder den Innenhöfen der unweit gelegenen Klinik, deren Geräusche ihr inzwischen zur Genüge bekannt waren. Das ständig bis an seine Kapazitätsgrenze belegte Institut für psychosoziale Rekonvaleszenz, im Volksmund meist als »Psychostall« bezeichnet, beherbergte Menschen, die, vom häufigen Wechsel ihrer Identität in eine der Meta-Welten des Internets überfordert, sich in ihrem realen Alltag nicht mehr zurechtfanden. Weit über 50 Prozent seiner frei verfügbaren Zeit verbrachte der Durchschnittsbürger inzwischen in der Schein-Existenz einer der im Internet angebotenen fiktiven Welten, hatten Wissenschaftler vor mehreren Jahren schon ermittelt; die Anzahl derer, denen der Umstieg in die Realität Schwierigkeiten bereitete, wuchs unaufhaltsam. Ann-Sophie Braig war beruflich oft genug mit den daraus resultierenden Problemen konfrontiert, etwa wenn eine Person es gewohnt war, ihre Interessen mit rücksichtsloser Gewalt in der jeweiligen Meta-Welt durchzusetzen und dieses aggressive Gehabe ohne jede Einschränkung in der Realität fortsetzte. Mehrfach schon hatte man sie zu gewaltsam aus dem Leben gerissenen Opfern solch verwirrter Täter gerufen.
Sie hörte, dass das Schreien draußen kein Ende nahm, kletterte aus dem Bett und lief zum Fenster. Die Umgebung war nur schwer einzusehen; ein dichter Schleier aus intensiven Niederschlägen und nur spärlich vorhandener Straßenbeleuchtung verhüllte die Klinik wie die übrigen benachbarten Gebäude.
Als sie sich zur Seite wandte, um den restlichen Teil des Geländes zu untersuchen, hörte sie die charakteristische Tonfolge ihres Arbeitgebers aufheulen. Jetzt, mitten in der Nacht? Sie war weder zum Dienst noch zur Bereitschaft eingetragen!
Ann-Sophie nahm das Gespräch an, indem sie ihr Geburtsdatum vor sich hin nuschelte, und schleuderte dann dem Anrufer, noch bevor er dazu gekommen war, auch nur ein Wort zu äußern, entgegen: »Falsch verbunden. Ich habe weder Dienst noch Bereitschaft. Klöckner ist dran.«
Der Kollege schien nicht beeindruckt. »Notfall«, erwiderte er nur. »Zwei nicht identifizierte Leichen. In Ihrer Nähe. Keine 500 Meter entfernt.«
Natürlich wusste er, wo sie sich befand. Auch wenn ihm möglicherweise nicht bekannt war, dass sie heute in der Wohn-Gemeinschaft ihres zurzeit abwesenden Sohnes übernachtete, hatte er ihren Aufenthaltsort genau vor Augen. Seit im Rahmen der ersten Notstandsgesetzgebung vor fast zwanzig Jahren die Kennzeichnungspflicht für jeden Bürger eingeführt und mittels der ohnehin im Oberarm implantierten, alle Smartphone-Funktionen ausübenden Chips durchgesetzt worden war, konnten die Mitarbeiter sämtlicher staatlicher Behörden und Ämter den genauen Aufenthaltsort jedes Menschen per Aufruf der Personalnummer sofort ersehen.
»Klöckner«, beharrte sie. »Der hat Dienst.«
»Ist noch beim Grenzschutz. Kommt erst morgen zurück.«
»Der Scheißtyp, der elende!« Der Fluch rutschte ihr unwillkürlich über die Lippen. Sollte der Kollege ruhig mitbekommen, wie sie zu dem Kerl stand, mit dem gemeinsam sie die Leitung des Kommissariats Schwerstdelikte des Landeskriminalamtes innehatte. Ihr zerrüttetes Verhältnis war ohnehin in der ganzen Behörde bekannt.
Klöckner hatte sein Grenzschutz-Wochenende also wieder einmal ohne jede Absprache verlängert, obwohl er die ganze Woche zum Nachtdienst eingetragen war. Seit der Kerl in Scheidung lebte, hatte er endgültig jedes Maß verloren, falls er vorher je darüber verfügt hatte. Ihr war klar, weshalb er seine Zeit meist gemeinsam mit seinem Adlatus Waitz lieber beim Grenzschutz verbrachte als im Amt. Beide hatten ihr gegenüber selbst oft genug damit geprahlt. Niemand kontrollierte, wie viele Pillen oder welche Mengen an Drogen sie dort konsumierten oder wie hoch ihr Alkoholpegel ausfiel; Hauptsache, sie waren draußen im Grenzbereich unterwegs und brachten persönlich oder mithilfe verschiedener Drohnen möglichst viele Illegale zur Strecke, die unerlaubt ins Land einzudringen versuchten. Wobei das zur Strecke bringen durchaus wörtlich zu verstehen war.
»In unserem Abschnitt kommt kein Kanacke ungestraft davon«, brüsteten sie sich ungeniert, sobald das Thema zur Sprache kam. Und seit dem Antritt der neuen rechten Regierung wurden derlei Lappalien ja nicht einmal mehr diskutiert.
»Sie beeilen sich, ja?«, unterbrach der Kollege ihre Überlegungen. »Eine Überwachungs-Drohne ist bereits unterwegs. Sie wird sich in Kürze bei Ihnen einloggen. Aber sehen Sie sich bitte vor. Es regnet wie verrückt. Zum Glück haben Sie es nicht weit.«
»Was ist mit Begleitung? Allein gehe ich nicht raus. Oder glauben Sie, ich bin lebensmüde?«
Der Mann am anderen Ende seufzte laut. »Nein, natürlich nicht. Ich habe Verstärkung angefordert, aber nur einen Beamten bekommen. Hoffentlich schafft es der Personen-Kopter trotz des Wetters, ihn vor ihrem Haus abzusetzen.«
»Nur ein Beamter?«, beschwerte sie sich.
»Tut mir leid. Alle verfügbaren Kräfte sind momentan im Einsatz. Der Notruf steht nicht still. Wir können nur noch den dringendsten Fällen nachgehen. Die halbe Stadt steht unter Wasser.«
»Also gut. Wenn es denn unbedingt sein muss. Aber ich verlasse das Haus erst, wenn der Mann vor der Tür steht. Sollte es der Kopter nicht schaffen, müsst ihr euch anderweitig umschauen«, sagte sie dem Kollegen mit missmutigem Unterton zu.
Die Serie vor allem nächtlicher Überfälle hatte in den letzten Jahren derart zugenommen, dass sich kaum noch jemand allein auf die Straße wagte. Im Gefolge der zunehmenden Arbeitslosigkeit und damit einhergehender sozialer Verarmung und Verwahrlosung war es in weiten Teilen des Landes zu einer Verrohung des allgemeinen Umgangs miteinander gekommen, den man sich wenige Jahrzehnte vorher niemals hätte vorstellen können.
Stuttgart und sein Umland waren von den Problemen in besonders gravierendem Ausmaß betroffen. Während man sonst fast überall begriffen hatte, dass die Produktion irrsinnige Energiemengen verschlingender Luxuskarossen in einer immer mehr von unerträglichen Temperaturen geplagten Welt keine Zukunft mehr hatte, und deshalb seit Jahrzehnten neue Industrien und Forschungsstätten angesiedelt hatte, war man im Raum Stuttgart dabei geblieben, sich nicht um Alternativen zu kümmern, sondern weiter die Produktion dieser ökologisch verantwortungslosen Dinosaurier zu fördern. Ständige Arbeitsplatzverluste, verbunden mit starker Bevölkerungsabwanderung und zunehmender Kriminalität waren die Folge.
Offiziell kam Stuttgart inzwischen gerade noch auf 250.000 Einwohner, aber trotz immer intensiverer Überwachungsmaßnahmen wollte es den zuständigen Sicherheitsorganen einfach nicht gelingen, der immer stärkeren Gefährdung der Unversehrtheit des Lebens vieler Bürger durch die unaufhaltsam steigende Kriminalität Einhalt zu gebieten. Frust und Wut aufgrund der eigenen, zu selten von Erfolg gekrönten Arbeit dominierten immer mehr Polizeibeamte.
Die Probleme wurden durch die Tatsache verschärft, dass Teile der Innenstadt und der Vororte aufgrund der stetig angestiegenen Temperaturen vom April bis in den Oktober hinein unbewohnbar geworden waren. Seitdem in diesen Monaten von wenigen Kälteeinbrüchen abgesehen fast ununterbrochen 45 bis 50 Grad Celsius herrschten, hatten alle, die es sich finanziell leisten konnten, die Flucht in besser durchlüftete und weniger stark von Beton und Asphalt geprägte Gebiete ergriffen. Nach mehreren Hitzesommern mit überhöhten Todesraten waren seit den späten Dreißigerjahren ganze Straßenzüge etwa im früher dicht besiedelten Stuttgarter Westen abgerissen und in anfangs grüne, aufgrund des schwindenden Grundwasserspiegels allerdings meist ausgedörrte Parks verwandelt worden. Autos waren weitgehend verbannt; die meisten Straßen bestanden aus schmalen Fahrspuren für Fußgänger, Radfahrer und den Anlieferverkehr, beidseits von grünen Pflanzstreifen gesäumt. Kreuz und quer in der Stadt verteilt standen unzählige Gebäude zumindest den offiziellen Verlautbarungen nach auch leer; in Wirklichkeit hausten in ihnen Scharen nicht registrierter, großenteils verarmter Menschen, die nirgendwo sonst unterkamen. Dass sowohl illegal im Land lebende als auch kriminelle Existenzen diese Chance nutzten, um unterzutauchen, war ein offenes Geheimnis. Die Personaldecke der Polizei war allerdings viel zu dünn, um ständig Kontrollen durchzuführen. Die alle paar Wochen stattfindenden Razzien vertrieben die Entwurzelten zwar aus ihrer Bleibe – meist jedoch nur für kurze Zeit, bot sich ihnen doch oft keine Alternative. So begann das Spiel aufs Neue und setzte sich ins Unendliche fort.
Polizeiangehörige jeder Couleur sahen sich deshalb immer neuen Vorwürfen von Untätigkeit und Inkompetenz ausgesetzt. Anstelle des lange gewohnten, von überwiegend rationalen Überlegungen geprägten Vorgehens ließen sich viele Beamte infolgedessen verdächtigen Personen gegenüber zu immer brutaleren Verhaltensweisen hinreißen, was die Aggressivität bestimmter Bevölkerungsgruppen gegen Vertreter staatlicher Behörden zusätzlich verstärkte. Ann-Sophie Braig war in den letzten Jahren im Rahmen ihres Berufes mehrfach in Situationen geraten, denen sie ohne die Begleitung ebenfalls bewaffneter Kollegen kaum heil hätte entkommen können. Seit einem Vorfall besonders übler Art vor wenigen Wochen war sie nicht mehr bereit, ihr Leben aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen aufs Spiel zu setzen.
Sie musterte den Monitor auf ihrem linken Unterarm, wartete auf die Bilder der Überwachungs-Drohne. Seit es Wissenschaftlern vor einigen Jahrzehnten gelungen war, den Smartphone-Bildschirm in einer hauchdünnen Folie zu konzentrieren, gab es kaum noch eine Person, die sich die neue Errungenschaft nicht zugelegt hatte. An der Stelle, wo frühere Generationen eine Armbanduhr getragen hatten, prangte jetzt der kaum spürbare Monitor, der gemeinsam mit dem Chip im Oberarm die ständige Verbindung zur Außenwelt realisierte.
Die Überschwemmung sämtlicher Straßen des Zentrums, dazu die Flutung fast aller Stadtbahn- und Autotunnel wurde gemeldet, der Einsatz aller verfügbaren Kräfte zur Rettung vom Wasser eingeschlossener Menschen verfügt. Danach folgte der Hinweis auf die Entdeckung zweier nicht identifizierter Leichen im Bereich des Österreichischen Platzes am Rand der Innenstadt, tatsächlich in ihrer Nähe.
Gleich zwei Tote, ging es ihr durch den Sinn, einer war ja nicht genug. Dazu beide nicht identifiziert. Illegale etwa?
Auf Zehenspitzen eilte sie ins Bad, darum bemüht, die anderen Mitglieder der Wohngemeinschaft nicht aufzuwecken. Sie betätigte den Wasserhahn, versuchte, sich zu erfrischen. Vergeblich, nur ein Rinnsal dunkelbrauner, übel riechender Brühe tropfte ins Becken. Angewidert wandte sie sich ab, suchte nach ihrem Deo. Der Regen war offensichtlich derart ausufernd niedergegangen, dass das Rohrleitungssystem wieder einmal vor den Belastungen kapitulierte. Dabei traten derlei Naturkatastrophen nicht mehr wie in ihrer Kindheit und Jugend alle paar Jahre, sondern mit fortlaufender Temperaturzunahme in immer kürzeren Abständen auf.
Die Versorgung mit Trinkwasser war in weiten Teilen des Landes, aber auch in normalen Zeiten, schon nicht mehr durchgehend gewährleistet. Monatelange Trockenperioden hatten die Grundwasserspiegel vielerorts derart absinken lassen, dass viele Pumpen ohne Nachschub blieben. Daraus resultierende Risse und Verwerfungen in der oberen Erdkruste führten seither immer häufiger zu lokalen Erdbeben, Hangrutschungen und zum Einsturz von Häusern und Fabriken.
Stuttgart war wie der gesamte Südwesten in besonderem Ausmaß mit diesen Problemen konfrontiert, seit im Jahr 2045 ein französisches Atomkraftwerk im nahen Elsass infolge unzureichenden Kühlwasserzuflusses einen GAU erlitten und dabei einen großen Teil seiner radio-aktiven Substanzen freigesetzt hatte. Die von starken Westwinden angetriebene Strahlenwolke hatte weite Teile Baden-Württembergs, der Schweiz, Bayerns und Vorarlbergs kontaminiert, was zur kompletten Evakuierung großer Städte wie Freiburg, Basel und Konstanz sowie ihres Umlandes, aber auch sämtlicher Regionen rund um den Bodensee, der Nordschweiz, Oberschwabens und des Allgäus wie auch Vorarlbergs geführt hatte. Wie viele Menschen dieser Katastrophe damals zum Opfer gefallen waren, sowohl bei den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die die monatelangen Evakuierungsmaßnahmen nach sich gezogen hatten, als auch infolge der dadurch erlittenen Krebserkrankungen – niemand hatte es zählen können. Ann-Sophie Braig erinnerte sich voller Schrecken an die Bilder, die damals die Nachrichtenkanäle dominiert hatten.
Die viel besuchten Urlaubsregionen des Südschwarzwalds, des Bodensees, Oberschwabens, des Allgäus und der Nordschweiz wie auch Vorarlbergs waren von einem Tag auf den anderen für Touristen gesperrt worden; speziell ausgebildete Militärverbände bewachten seither die Grenzen rings um die am schlimmsten radioaktiv belasteten Gebiete. Seit annähernd drei Jahrzehnten stand der Bodensee deshalb auch nicht mehr als Trinkwasserquelle zur Verfügung – eine wichtige Funktion, die er vorher für fast den gesamten Südwesten weit über Stuttgart hinaus immer eingenommen hatte. Seither musste man für jeden Tag, an dem die öffentliche Wasserversorgung einigermaßen funktionierte, dankbar sein.
Ann-Sophie Braig griff nach ihrer regenfesten Kleidung, schlüpfte in ihre alten, robusten Stiefel. Als sie zur Wohnungstür lief, entdeckte sie die neue Nachricht auf dem Monitor. Hangrutsch unterhalb der Weinsteige. Mehrere Häuser zerstört. Weitere gefährdet. Viele Bewohner vermisst. Alle Rettungskräfte im Einsatz.
Die seltsamen Geräusche, die sie aus dem Schlaf gerissen hatten, wurde ihr bewusst, das undefinierbare Knarzen und Rumoren. Sie bemerkte, dass der Bildschirm plötzlich in einen violetten Grundton wechselte, sah ihren Namen aufleuchten. Interne Informationen KHKin Braig. Nicht identifizierte Leichen am Charlottenplatz. Drohne vor Ort.
Im gleichen Moment entdeckte sie die Umrisse zweier seltsam verwinkelter, dunkler Gebilde am Rand eines völlig überfluteten Geländes; beide nur wenige Meter voneinander entfernt, aufgenommen aus großer Höhe. Die Bilder der Drohne, die die Umgebung des Fundortes ausleuchtete.
Was jetzt, überlegte sie, Österreichischer Platz oder Charlottenplatz?
Sie musterte die Aufnahme, bemerkte den reißenden Wasserlauf am Rand, begriff dann, welchen Ort sie vor sich hatte. Den Rand des Straßendeckels unweit des Neuen Schlosses. Die Leichen waren wohl in der Nähe des Österreichischen Platzes entdeckt, dann jedoch von den tosenden Fluten mitgerissen und erst im Bereich des Charlottenplatzes zur Seite geschwemmt worden.
Sie warf einen letzten Blick auf den Monitor, nahm ihre Waffe an sich und folgte der Treppe nach unten. Das Erdgeschoss stand komplett unter Wasser; der Pegel hatte bereits die zweite Stufe erreicht. Eine Gruppe junger, teilweise asiatisch aussehender Menschen hastete hin und her, Säcke und Tüten gefüllt mit Sand und Erde vor den Eingangstüren auftürmend. Sie merkte, dass die meisten barfüßig und mit kurzen oder hoch gekrempelten Hosen unterwegs waren, schob sich vorsichtig an ihnen vorbei. Ihre Bemühungen wirkten teilweise sehr unbeholfen, die dämmenden Materialien lagen an mehreren Stellen nur lückenhaft über- und nebeneinander. Ob das die Wohnungen wirklich vor der Überschwemmung schützte, blieb abzuwarten.
Sie stakste mit großen Schritten zum Eingangsbereich des Hauses, sah plötzlich eine der jungen Frauen vor sich, über deren allzu oft von Verletzungen gezeichnete Gesichter sie sich mehrfach mit ihrem Sohn unterhalten hatte. Sie war tief verschleiert, schien religiösen Fundamentalisten anzugehören. Als ihre Kopfbedeckung für einen Moment zur Seite rutschte, entdeckte sie das Pflaster auf ihrer linken Wange.
»Ich fürchte, die werden misshandelt«, hatte Mattis erklärt. »Ganz schön oft. Fast jedes Mal, wenn mir eine über den Weg läuft, haben die ein blaues Auge oder Pflaster im Gesicht. Das kann doch nicht so weitergehen.«
Ann-Sophie Braig hörte das kräftige Blubbern unter sich, sah immer neue Wassermassen unter der Haustür hindurch ins Innere quellen. Sie öffnete sie vorsichtig, wurde augenblicklich von einer unsichtbaren Kraft zurückgedrängt.
Draußen ging der Regen einem riesigen, tosenden Wasserfall gleich nieder. Der Himmel hatte alle Schleusen geöffnet. Die Straße schien einem reißenden, schmalen Fluss ähnlich, der sich mit unbezähmbarer Gewalt an ihr vorbeiwälzte. Äste und andere Pflanzenteile wurden von der Flut mitgerissen, Kartonagen und Abfallbehälter samt deren vielfältigem Inhalt schossen an ihr vorbei. Außer einem in eine dichte Regenjacke gehüllten, den Hauswänden entlang auf sie zu stapfenden Mann war kein Mensch zu sehen. Die meisten Straßenlampen waren erloschen, nur ab und an warf eine heftig hin und her schwankende Leuchte ein fahles Licht.
»Braig?«, hörte sie den Mann rufen.
Sie winkte ihm zu, wartete, bis er mit kleinen Schritten heftig hin und her schwankend bei ihr angelangt war.
»POM Eckert. Ich soll Sie begleiten. Charlottenplatz.« Obwohl er sich keine zwei Meter von ihr entfernt postiert hatte, musste er laut schreien, um sich verständlich zu machen.
Sie zog die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf, trat vollends ins Freie. Die Strömung des Wassers zerrte an ihren Beinen. Instinktiv griff sie nach der Hauswand, suchte dort Halt. Innerhalb weniger Sekunden war sie völlig durchnässt. Laut vor sich hin fluchend, kämpfte sie sich hinter dem Kollegen her die Straße abwärts.
Das Gelände um den Charlottenplatz war nicht mehr wiederzuerkennen. Das gesamte Areal über der B 14 hatte sich in einen riesigen, von schlammiger Brühe gezeichneten Teich verwandelt. Vor Jahrzehnten schon hatte man die lärmende Piste unter einem breiten, üppig begrünten und von Fahrradstraßen und Gehwegen überzogenen Deckel versteckt. Ann-Sophie wollte nicht wissen, wie es im Moment dort unten aussah. Weder im Straßentunnel noch in den nahen Stadtbahngewölben. Blieb nur die Hoffnung, dass es alle noch rechtzeitig vor der großen Flut an die Oberfläche geschafft hatten.
Sie ahnte die Umrisse des Neuen Schlosses hinter der fast undurchdringlichen Wasserwand, sah die lange Reihe der hier vor ein paar Jahren gepflanzten Orangenbäume. Erst als sie ihre Augen zusammenkniff, bemerkte sie ein diffuses, bläuliches Aufblinken im Dämmer vor sich. Der Fahrradweg stieg an der Stelle sanft an, eine gleichmäßig asphaltierte Fläche ragte aus dem Wasser. Sie sah das Winken des Kollegen, hielt auf das Licht zu. Je mehr sie sich ihm näherte, desto deutlicher erkannte sie die Umrisse der Polizei-Drohne, die ihre Umgebung mit grellen Scheinwerfern ausleuchtete. Kreuz und quer auf dem Boden verteilter Müll, Ansammlungen von Schlamm und Pflanzenresten, die seltsam verzerrten Teile einer Art Schaufensterpuppen.
Sie trat vollends ins Licht, sah, dass es sich bei den im Abstand von mehreren Metern auf den nassen Untergrund geworfenen Gebilden um die sterblichen Überreste von Menschen handelte, nahm eine weibliche Stimme aus dem Lautsprecher der Drohne wahr.
»Ah, Ann-Sophie, du hast Dienst. Ich fürchtete schon, dein Kollege. Scheiß-Nacht heute, was? Das sind die Leichen Nummer vier und fünf, die sie mir präsentieren.«
Marie-Luise Costa, die Gerichtsmedizinerin. Ann-Sophie Braig hatte sie sofort erkannt. Sie blieb vor einem der toten Körper stehen, warf einen Blick zu der Drohne. »Sie haben dich schon zugeschaltet? So schnell?«, wunderte sie sich.
»Ich war gerade dabei, die Aufnahmen einer anderen Drohne zu begutachten, als die neue Meldung kam. Sieht aber nicht gut aus.«
»Sie sind noch nicht identifiziert?«
»Die Chips scheinen nicht zu funktionieren. Oder es handelt sich um Illegale. Beide weiblich, so viel kann ich sagen. Was die Gesichtserkennung betrifft: Keines der Programme reagiert. Schau sie dir an, dann verstehst du, wieso. Vielleicht können wir es über Irisabgleich oder Fingerabdruck versuchen.«
Ann-Sophie Braig trat einen Schritt auf die eine Tote zu, begriff sofort, wovon Marie-Luise Costa sprach. Der Körper sah stark deformiert aus. Vom Gesicht war nicht viel geblieben. Sie schnappte nach Luft, wandte den Blick zur Seite. So oft sie sich in ihren annähernd vier Jahrzehnten Berufserfahrung auch schon mit dem Anblick und der Untersuchung toter Menschen konfrontiert gesehen hatte, zur Routine war ihr dieser Vorgang nicht geworden. Smarte, mit coolem Grinsen von einer Leiche zur nächsten spazierende Kommissare gab es in den Krimis der vielen Streaming-Kanäle – mit der Realität, wie sie sie täglich erlebte, hatte das nichts zu tun. Einen Toten zu begutachten, gehörte zu den unerfreulicheren Momenten ihres Berufes. Dieses Empfinden hatte sie von ihrem Vater geerbt, der ebenfalls als Kriminalkommissar tätig gewesen war und ihr damals mehrfach von seiner jeweiligen Gefühlslage während der Konfrontation mit einer getöteten Person berichtet hatte. Auch ihre langjährige Praxis hatte daran nichts geändert. Ob am Anfang ihrer Berufstätigkeit oder jetzt als altgedienter Profi – sie fühlte sich jedes Mal tief im Innersten getroffen, handelte es sich doch nicht um eine aus Kunststoff gefertigte Puppe, deren Überreste sie vor sich sah, sondern um einen vor kurzer Zeit mitten aus dem Leben gerissenen Menschen, dem in seinen letzten Augenblicken übel mitgespielt worden war.
Sie kramte in ihrer Hosentasche, suchte nach einem der Hustenbonbons, die sie auch im Sommer für Momente wie diesen fast immer bei sich trug, zog es hervor. Auch dieses Ritual hatte sie von ihrem Vater übernommen. Sie erinnerte sich noch genau an den Moment, als er zwei Tage vor ihrem Dienstantritt als junge Kommissarin an sie herangetreten war, mehrere Packungen mentholhaltiger Drops in den Händen.
»Es hilft wirklich«, hatte er ihr erklärt, »lass dir das von einem alten Ermittler versichern.«
Fast vier Jahrzehnte war das jetzt her, ihr Vater wie ihre Mutter waren längst verstorben, die Verfahrensweisen kriminalistischer Untersuchungen mit immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verfeinert, die Emotionen der damit beschäftigten Kommissare jedoch gleichgeblieben.
Ann-Sophie Braig machte sich an dem Bonbon zu schaffen, versuchte, es aus seiner Umhüllung zu befreien. Es dauerte eine Weile, bis sie es sich endlich in den Mund schieben konnte. Der mentholhaltige Geschmack verschaffte ihr Erleichterung. Sie schob es mit der Zunge hin und her, spürte, wie sich ihre Verkrampfung löste. Langsam zwar, quälend langsam, aber immerhin. Nach ein paar Minuten fühlte sie sich wieder imstande, durchzuatmen.
»Die sind aber nicht erst heute Nacht gestorben«, meldete sich Marie-Luise Costa zu Wort. »Auch wenn ich nicht genau beurteilen kann, wie viel das Wasser zur Veränderung beiträgt … Die sind schon mehrere Tage tot. Ohne jeden Zweifel.«
»Beide?«
»Beide. Die andere sieht noch schlimmer aus.«
Ann-Sophie Braig trat zur Seite, umrundete eine mehrere Zentimeter dicke Ansammlung aus Schlamm und Müll, wandte sich der zweiten Leiche zu. »Oh, nein!«, keuchte sie. Das seltsam verformte Gebilde vor ihr ähnelte einer längst verwesten Mumie. Sie schnappte nach Luft, bemerkte die dicken Klumpen lehmiger Erde am Hinterkopf der Toten. »Die ist doch …«
»Mehrere Wochen«, ergänzte die Gerichtsmedizinerin. »Die ist schon eine ganze Weile hinüber. An ihrem Kopf. Was ist das?«
Ann-Sophie Braig beugte sich nach unten, wischte sich das Wasser aus dem Gesicht. »Erde«, erklärte sie.
»Aber kein Schlamm, oder?«
»Erde«, wiederholte sie. »Lehmige Erde. Kein Schlamm, nein.« Als hätte man sie aus ihrem Grab geholt, ging es ihr durch den Kopf.
»Da fällt mir nur eine Lösung ein«, meinte Marie-Luise Costa.
»Friedhof«, erklärte Ann-Sophie Braig. »Die waren schon beerdigt.«
»Du sagst es. Das Unwetter?«
»Ich muss mich erkundigen, ob eine Meldung vorliegt. Mithilfe der Überwachungskameras müsste sich doch detailliert nachvollziehen lassen, wie sie hierherkamen.« Sie wandte sich der Drohne zu, nannte ihre Personalnummer, verlangte nach der Zentrale. »Die beiden Leichen am Charlottenplatz«, sagte sie. »Wer hat sie entdeckt?«
»Moment.« Der Kollege machte sich an einer Tastatur zu schaffen. »PIP«, antwortete er dann.
Wer auch sonst, überlegte sie. In dieser Nacht war kaum jemand freiwillig draußen unterwegs. PIP, das Personen-Identifikations-Programm, mit dem sämtliche im öffentlichen Bereich vorhandenen Kameras ausgerüstet waren, verfügte über die Fähigkeit, den jeweiligen Passanten über dessen Chip zu identifizieren beziehungsweise festzustellen, ob eine Person ohne gültigen Chip unterwegs war. War dies der Fall, wurde in der Überwachungszentrale automatisch Alarm ausgelöst. Das System erstellte selbstständig Bewegungsprofile aller erfassten Menschen, unterzog zudem jeden Passanten einer ausgiebigen Überprüfung auf seine Körperhaltung und seinen Gesichtsausdruck hin. Schon eine als aggressiv oder wütend interpretierte Mimik, genauso eine als drohend oder übergriffig verstandene Bewegung aktivierten ein spezielles Programm, das von besonders intensiver Beobachtung der verdächtigen Person bis zur Verständigung der nächsten Polizeioder Zivilstreife reichte. Weil Städte und Dörfer inzwischen nicht nur im Außenbereich, sondern auch in fast allen öffentlichen Gebäuden mit Kameras ausgestattet waren, ermöglichte das PIP die fast lückenlose Überwachung des gesamten Landes.
Ann-Sophie Braig stand dieser von den Regierungen der vergangenen Jahrzehnte zielbewusst in die Wege geleiteten Entwicklung zwiespältig gegenüber: So sehr sie als Kriminalbeamtin oft von der rigiden Kontrolle profitierte, so sehr war sie sich als mündige Staatsbürgerin und überzeugte Demokratin der Gefahren des Missbrauchs des Systems bewusst. Dass diese Besorgnis auf realen Grundlagen beruhte, konnte sie ständig in ihrem beruflichen Alltag erleben, etwa wenn korrupte Angehörige der regierenden Rechtspopulisten sich unverhohlen der Möglichkeiten des PIP bedienten, um missliebige Konkurrenten auszuspähen und auf etwaige Schwachpunkte hin zu überprüfen. Das Land hatte in den vergangenen Jahren allen Behauptungen zum Trotz immer deutlichere Züge eines totalitären Staates angenommen.
Die Kriminalität einzudämmen, war dennoch nicht gelungen. Trotz aller Überwachungsmaßnahmen hatte sich etwa die Anzahl der Überfälle und Einbrüche kaum nennenswert reduzieren lassen, hatten sich viele Täter der neuen Technik doch angepasst. Sei es, dass es ihnen gelang, mit illegalen Störsendern die Funktion des PIP kurze Zeit außer Kraft zu setzen, sei es, dass Hacker die Identifikation einzelner Individuen über deren persönliche Chips derart manipulierten, dass das System in ganzen Stadtvierteln stunden-, manchmal sogar tagelang nicht mehr zu gebrauchen war. Natürlich versuchten einige ab und an auch auf altbackene Art, Überwachungskameras mit physischen Attacken, mit Schusswaffen etwa oder simplen Steinwürfen auszuschalten – was aber meistens aufgeklärt werden konnte, weil es den Tätern nur selten gelang, sämtliche Geräte gleichzeitig zu zerstören.
Ann-Sophie Braig musterte die beiden Leichen zu ihren Füßen. »Wo wurden sie zuerst erfasst?«, erkundigte sie sich.
Der Kollege hatte die Antwort schnell parat. »Heusteigstraße. Von dort kam der erste Alarm.«
»Beide?«
»Soweit ich sehe … ja.«
»Heusteigstraße.« Sie überlegte einen Moment. »Ist das nicht in der Nähe des alten Fangelsbachfriedhofs?«
Ihr Gesprächspartner schien sich auf einem Stadtplan zu orientieren. »Das ist in unmittelbarer Nähe, ja.«
»Liegen Ihnen Informationen vor, inwieweit der Friedhof von dem Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde?«
»Moment, ich schaue mir kurz die Aufzeichnungen der dortigen Kameras an.«
Sie hörte den Mann kurze Befehle geben, hatte seine Stimme wieder im Ohr. »Oh, nein. Wenn das ein Friedhof war … Das sieht eher aus wie ein See. Mit kleinen Inseln und einem reißenden Fluss.«
»Dann stammen die beiden Leichen wahrscheinlich von dort. Von der Flut aus ihren Gräbern gespült.«
»Die Erdanhaftungen und ihr Zustand sprechen dafür«, stimmte Marie-Luise Costa ihr zu. »Damit ist auch klar, weshalb sie nicht zu identifizieren sind. Die sind schon eine Weile verstorben. Ihre Daten sind bereits gelöscht.«
»Dieselbe Sauerei wie bei der großen Überschwemmung vor zwei Jahren. Da hatten wir mehrere Leichen aus dem Waldfriedhof in der Stadt.« Ein seltsames, scheinbar aus den Tiefen der Erde kommendes Grollen und Donnern ließ sie verstummen. Erschrocken wandte sie sich von der Drohne weg, starrte in die Richtung, aus der sie das unheimliche Geräusch vernommen zu haben glaubte. Die Straße abwärts, am Landtag und der Oper vorbei.
»Was war das?«, erkundigte sich Marie-Luise Costa. »Irgendwas in deiner Nähe?«
Ann-Sophie Braig versuchte vergeblich, etwas zu erkennen. Die Wasserwand rings um sie herum hüllte alles in undurchdringlichen Dämmer. »Keine Ahnung. Der Regen … Drei, vier Meter, weiter kann ich nicht sehen.«
»Es kam vom alten Skandalbahnhof«, mischte sich ihr Begleiter, Polizeiobermeister Eckert, ins Gespräch. »So hat es sich jedenfalls angehört.« Er stand wenige Meter hinter ihr, starrte in die Umgebung.
»Vom alten Skandalbahnhof?« Die Stimme der Gerichtsmedizinerin hatte einen skeptischen Unterton. »Das hörte sich nicht gut an. Selbst durchs Mikrofon der Drohne nicht.«
Ann-Sophie Braigs Augen schmerzten zunehmend. So angestrengt sie ins Dunkle starrte, so ergebnislos blieben ihre Bemühungen. Nichts war zu erkennen, überhaupt nichts. Nur das heftige Prasseln der niedergehenden Wassermassen dröhnte ihr in die Ohren. »Ein größeres Gebäude, das unterspült wurde und einstürzte?«, überlegte sie laut. »Oder noch ein Hang, der ins Rutschen kam?«
»Da wüsste ich einige Stellen in der Stadt, wo ich mir das vorstellen könnte.«
»Gibt es eine Meldung aus der Umgebung?«
Der Kollege war noch zugeschaltet. »Der alte unterirdische Skandalbahnhof«, antwortete er.
»Das Wasser läuft in die Station?«
»Schon seit Stunden. Es besteht die Gefahr, dass die Flut die Fundamente unterspült. Dann kann die gesamte Anlage instabil werden. Genaueres ist noch nicht bekannt.«
Ann-Sophie Braig wusste um die problematische Konstruktion des alten unterirdischen Skandalbahnhofs. Er lag den aus dem Stuttgarter Zentrum abfließenden Wassermassen wie ein unüberwindbarer Riegel im Weg. Schafften es die unter ihm hindurchführenden Leitungen nicht, die gewaltigen Regenmengen aufzunehmen und in kürzester Zeit abfließen zu lassen, drohten Teile der Stadt mitsamt den Tunnelanlagen überschwemmt zu werden. Welche konkrete Gefahr dies beinhaltete, hatte sich vor wenigen Jahren während eines ergiebigen Herbstregens gezeigt: Der Skandalbahnhof war mitsamt den tiefer gelegenen unterirdischen Zulaufstrecken geflutet worden. Es hatte wochenlang gedauert, die massenhaften Schlammablagerungen zu beseitigen und die komplexe Elektronik der Bahnanlagen wenigstens provisorisch wieder instand zu setzen.
Der Zugverkehr selbst hatte zum Glück nicht allzu stark darunter gelitten, wurde der unterirdische Skandalbahnhof doch längst nur noch von einzelnen Zügen des Regionalverkehrs genutzt. Von seiner völlig misslungenen Konstruktion her für viel zu geringe Kapazitäten ausgelegt, war er von Anfang an zur Quelle ständiger Verspätungen und Zugausfälle geworden. Nachdem es wenige Jahre nach seiner Eröffnung mehrfach mitten im Bahnhofsbereich zu teilweise katastrophalen Kollisionen gekommen war, weil sich die von den fast 400 Meter hoch gelegenen Fildern in den 150 Meter tiefer gelegenen Bahnhof rasenden Züge nicht mehr rechtzeitig hatten bremsen lassen, war die Strecke für diese Richtung gesperrt worden. Nicht allein die sämtlichen gültigen Normen widersprechende Schieflage der Station sei daran schuld, vielmehr habe ein schmieriger Film von Herbstlaub die Räder der Züge wie Schlitten auf Eis ins Tal gleiten lassen, weshalb sie nicht mehr rechtzeitig zum Halten gebracht werden konnten, hatten Experten festgestellt – ein Sachverhalt, mit dem unzählige Ingenieure vor dem Bau der Skandalstation gewarnt hatten.
Als dann auch noch ein Zug mitten im Tunnel in Brand geraten und immer wieder aus Anhydrit bestehende Gesteinsschichten an mehreren Stellen der kilometerlangen unterirdischen Anlagen unter Wassereinfluss aufquollen und den Bahnverkehr jeweils für mehrere Monate lahmlegten, war das vorhersehbare Schicksal des von Grund auf völlig vermurksten Komplexes endgültig besiegelt gewesen. Einzig und allein die vier oberirdischen Gleise, die man zur Anbindung der von der Gäu-Hochfläche in die Stadt hinunterführenden Panoramabahn unter größtem Widerstand erhalten hatte, waren heute noch in Betrieb – ein unbezahlbarer Glücksfall, stellten sie in Zeiten des häufig gestörten Tunnelbetriebs neben dem S-Bahn-System doch die einzige Zufahrt ins Zentrum dar.
Alle anderen Züge verkehrten über die alte Verbindungsbahn von Kornwestheim nach Untertürkheim, an der man vor Jahrzehnten schon in Höhe des Cannstatter Kurparks einen neuen kleinen Zentralbahnhof errichtet hatte.