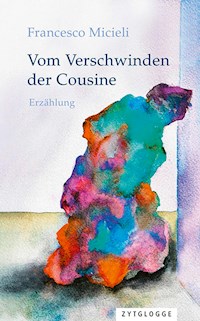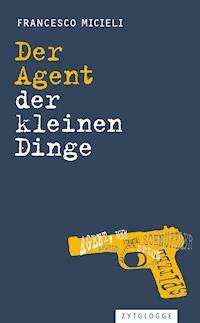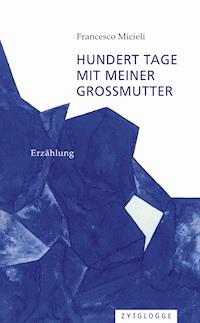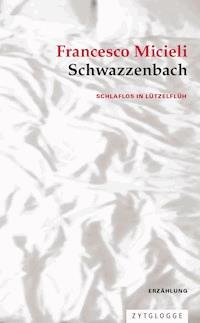
23,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 16. Juni 1970 lehnten die Schweizer Männer die Schwarzenbach-Initiative mit 54 Prozent Nein-Stimmen ab. Der Abstimmungskampf verlief sehr emotional, auch im bernischen Lützelflüh, Schauplatz von Francesco Micielis Erzählung ‹Schwazzenbach›. Die Beatles hatten sich getrennt, Janis Joplin und Jimmy Hendrix waren gestorben, James Schwarzenbach wollte die Italiener dezimieren. Angelo beschloss, seine Haare nicht mehr zu schneiden, und sah aus wie ein Sautschingg. In der Schule musste er auf dem hintersten Platz sitzen, weil sein Afrolook die Sicht auf die Wandtafel versperrte. Vierzig Jahre später: Micielis Alter Ego Angelo ist eingeladen, im Dorf seiner Kindheit, wo er als Migrantensohn aufgewachsen ist, über Gotthelf zu referieren. Den Rahmen der Erzählung bilden die drei Tage, in denen sich der nunmehr arrivierte ‹Emigrant› Zeit nimmt, um sich zu erinnern. Gefühle, Szenen und Bilder tauchen auf, die als ‹nicht eingerichtete Erinnerungen› sein Leben begleiten. Das Falschsein und Fremdfühlen in der eigenen Haut und in der Welt um sich herum: Wir waren Feindgebiet, eine Überwucherung, gefährlich. Wir waren ein unbekanntes Etwas, das den Schweizern die Schweiz wegnahm. Die Mutter, die nie auffallen wollte: Zur Arbeit gehen, ohne im Zug einen Sitzplatz zu besetzen. Nach Hause kommen und sich einschliessen. Die Schweiz sollte gar nicht merken, dass sie da war. Das immer wiederkehrende Gefühl, das Nicht-Wissen, wo zuhause ist. Und schliesslich Heidi, die erste Liebe, bei der Angelo nicht nur damals, sondern auch heute wieder (vergeblich) Zuflucht sucht. Micieli erzählt aus Angelos ganz persönlicher Sicht ein Stück Schweizer Geschichte, die weit über Lützelflüh hinausführt. ‹Schwazzenbach› ist ein eindrückliches, eindringliches und konzentriertes Dokument darüber, welche Spuren gesellschaftspolitische Bedingungen im persönlichen Leben hinterlassen – und dass es dabei kein Entrinnen gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
FRANCESCO MICIELI
SCHWAZZENBACH
Soll demnach Deutsch die Sprache des Tages sein?
Uwe Johnson, Jahrestage
Francesco Micieli
Schwazzenbach
SCHLAFLOS IN LÜTZELFLÜH
ERZÄHLUNG | ZYTGLOGGE
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag, 2012
Lektorat: Bettina Kaelin
Korrektorat: Monika Künzi, Jakob Salzmann
Umschlagsbild: Fotolia.com
ISBN 978-3-7296-0850-4
eISBN (ePUB) 978-3-7296-2161-9
eISBN (mobi) 978-3-7296-2162-6
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
Zytglogge Verlag, Steinentorstrasse 11, CH-4010 Basel
[email protected], www.zytglogge.ch
VORWORT
Jeden Sonntag gehe ich zu meinem Vater nach Lützelflüh. Jeden Sonntag essen wir Pasta. Mein Vater macht den besten Sugo der Welt. Wir essen, prosten uns mehrere Male zu und sagen kaum ein Wort. Mein Vater hört fast nichts. Er fühlt sich wohl in Lützelflüh. Alles hat er in seiner Nähe: den Denner-Satelliten, die COOP, die Drogerie, die Metzgerei, den Arzt und den Coiffeur. Es gäbe auch ein Ristorante-Pizzeria. Würde er etwas hören, ginge er sehr gerne dorthin, denn da trank er schon als starker, junger Mann sein Bier.
Damit er nicht aus der Übung des Zuhörens kommt, erzähle ich ihm, was sich ereignet: dass Italien eine technische Regierung hat, dass Berlusconi nicht mehr Ministerpräsident ist, dass es Menschen gibt, die unvorstellbare Gehälter erhalten, dass der Sohn von Bossi seinen Universitätsabschluss in Albanien (!) gekauft hat, dass der Direktor der Schweizerischen Nationalbank wegen 70 000 Franken, die seine Frau bei einem Devisenhandel verdient hat, zurücktreten musste. Mein Vater schaut mich an und nickt. Er hört nur ein Rauschen und sieht, wie sich meine Lippen bewegen. Einmal fragte ich ihn, ob er sich an die Schwarzenbach-Zeit erinnere. Wir brauchten mehrere Anläufe, bis er das Wort verstand. «Schwazzenbach», sagte er zu mir und meinte: «Habe ich dich richtig verstanden? Was ist das?», um dann zu erklären, er wolle nicht dorthin, er wolle hier bleiben.
An einem solchen Sonntag ist Angelo, der Ich-Erzähler des Buches, erschienen. Vater und ich waren uns gerade am Zuprosten, als er aus dem Nichts auftauchte und mich so stark bedrohte, dass ich vom Tisch fliehen musste. Ich hatte Zuckungen, ein wenig Schaum bildete sich auf meinen Lippen, und Vater schaute mich bekümmert an. Wahrscheinlich zweifelte er an meiner Zurechnungsfähigkeit. So und nicht anders gelangte die vorliegende Erzählung zu mir und nach Lützelflüh. Die Begebenheiten sind alle erfunden, jede Ähnlichkeit mit der Realität ist zufällig. Sogar Lützelflüh entspricht nicht dem real existierenden Dorf im Emmental. Die Geschichte entspricht nur jener Besessenheit, die mich an diesem einen Sonntag übermannte.
ERSTER TAG
I
Zurück.
Zurück in ein Dorf, das, fast unverändert, ein anderes Dorf geworden ist. Wie ein Mensch, der in der Haut des Kleinkindes steckt. Die Brücke ist da, die Kirche ist da, das Schulhaus. Eine Stille, wie im Süden während der Mittagshitze. Oder ist es das Fehlen von Leben? Nicht einmal die Vögel singen – nur der Fluss versucht es mit fliessendem Tönen aus Wasser.
Ich bin eingeladen.
Es soll in drei Tagen ein Kongress zu Jeremias Gotthelf stattfinden. Ich werde über ‹Gotthelf und die Fremden› sprechen. Fremdsein ist mein Job. Ich bin der Pressesprecher der Fremdheit. Ich glaube, man hat mich nicht eingeladen, weil ich hier aufgewachsen bin und zu den einheimischen Fremden gehöre, sondern weil ich an einem Max-Frisch-Kongress an der Technischen Universität Dresden zu ‹Max Frisch und die Migranten› gesprochen habe. Wobei Migranten von meinem veralteten Korrekturprogramm nicht angenommen wird. Migranten gibt es nicht für mein Schreibprogramm. Ich erinnere mich an das sanfte Lächeln von Professor Walter Schmitz in Dresden, als ich ihm erzählte, Migranten sei kein Wort in meinem alten G4. Er trug während der Vorlesungen einen Mantel und sah aus wie eine Figur aus einem Westernfilm.
Plakate mit bedrohlichen schwarzen Schuhen, die auf eine Schweizerfahne marschieren, als wären sie gefährliche Soldaten, hängen an einer Mauer. Ach, die Emme, die Emme, vorwärts und rückwärts die Emme! Stoppt die Masseneinwanderung! In grossen Buchstaben. Viele der heutigen Einwanderer haben andere Waffen. Sie brauchen keine Messer. Sie sind gut ausgebildet, kommen meist aus Deutschland und machen den Einheimischen Angst mit ihrer Schnelligkeit und ihrer selbstsicheren Art.
Die Statue von Gotthelf ist noch unberührt. Immer dieselben Pflanzen, derselbe Blick nach Nirgendwo. Keine Sprayereien.
Als ich damals zur Schule ging, hatte ich mir die Statue des unbekannten italienischen Fremdarbeiters daneben gewünscht.
Bete zu deinem Gott, dass da noch eine Statue hinkommt, flüsterte ich ihm in die steinernen Ohren.
Und heute flüstere ich wieder in sein Ohr. Einen Satz von Arno Schmidt.: «Jeder Revenant musste geführt werden. Zur Austarierung des Zivilisationsgefälles.»
- Weisst du, dass du Mode geworden bist?
- Mode?
- In aller Munde.
- Ach.
- Es gibt sogar ein Musical zu deinem Leben.
- Ein Miusikal?
- Eine Art Singspiel.
Gotthelf entdeckt eine Affiche mit dem Titel ‹Gotthelf-Event›.
Wind kommt auf, Westwind. Ein Hund bellt aus einem der Bauernhöfe, die am Hügel hängen, als habe man sie dort vergessen. Ich denke an Frau R., die gross und stark war und die Brüste hatte, die uns Kindern wie schwere Wolken am Himmel erschienen. Mir kommt es vor, als müsse ich hierher zurückkommen, weil ich etwas ganz Bestimmtes und Wichtiges vergessen habe.
Eine Seele.
Im Schulhaus geht die riesige Türe von selber auf. Hinter meinem Rücken höre ich Gotthelf sagen, dass ihm meine vergleichende Arbeit zwischen ihm und Gottfried Keller gar nicht gefallen habe. Es sei ein schweizerisches Thema und nichts für das deutschsprachige Ausland.
Ich bin immer nur in der Welt der Migranten gewesen, einer Welt mit vielen Sprachen in ständiger Bewegung, andauernd auf der Vorbeireise. Der einzig sichere Wert der Emigration sind die Einheimischen und deren Ämter. Sie stehen da wie tausendjährige Bäume.Ich sage Gotthelf, er müsse auf die Autos aufpassen, die seien sehr gefährlich, und stelle mich vor, «Angelo», und weise dabei stumm auf mich.
Nach meinem ersten Buch wurde ich zu ‹Mon ami étranger› nach Strassburg eingeladen. Sarah Kirsch, Erica Pedretti, Libuse Monikova, Herta Müller, Volker Braun, Milo Dor. Mein Jahrgang: 1946. Wieso solche Ungenauigkeiten? In ‹Le Monde› hiess es, ich sei ein albanischer Flüchtling. Und schon war ich ein Anderer.
Das Schreiben am eigenen Leben entlang ist wie Schauspielern einer immer wieder neuen Rolle und sich dabei daran erinnern, wie man das, was die Rolle tut, selber erlebt hat. Es ist eine Droge, eine Sucht. Für die Rolle erlebe ich mich jedes Mal wieder neu.
«Sprich mal über Gott», lacht Gotthelf, «und nicht über dich. Das gehört sich nicht.»
«Aber dieses Ich bin nicht ich. Es ist wie bei einem Buch. Deine ‹Schwarze Spinne› ist nicht nur deine. Jeder macht aus der Lektüre sein eigenes Werk.»
«Ach so», sagt er gnädig und lächelt verständnisvoll.
Die Tür des Schulhauses schliesst sich, noch bevor ich eintreten kann. Ich frage mich nach der Mechanik dieser Handlung. Wer mag sie programmiert haben? Ich stehe da, schaue auf den Schulplatz und glaube, eine tiefe Einsicht zu haben. Unser Verhältnis zum Anderen ist durch die Ähnlichkeit all unserer Gesichter getragen. Auge, Auge, Nase, Mund.
Mein Zimmer ist in einem Nebengebäude des Gasthofes, es hat die Nummer 65. Das Fenster zeigt auf die Kirche und die Kühe davor.
- Ich bin hier aufgewachsen.
- Ach ja?
- Ja.
- Hm, ja, ja, so vergeht die Zeit.
- Ja, sie vergeht.
- Hier unterschreiben bitte.
- Ich bin mit meinen Eltern aus Italien eingewandert.
- Ah!
- Ja, also, das heisst, ich kam später, als meine Eltern endlich eine Wohnung mieten durften.
- Frühstück im Säli von halb sieben bis zehn Uhr.
- Ich will mich an die Zeit der Überfremdungsinitiative erinnern. Wäre sie angenommen worden damals, hätten 300 000 Italiener das Land verlassen müssen. Und ich würde jetzt kein Zimmer wollen.
- Noch Wünsche?
Das Zimmer ist klein und über dem Bett hängt eine Nachahmung eines Ankerbildes – ein Mädchen mit roten Backen.
Was mache ich hier?
Mutter.
Mutter wollte nicht auffallen. Sie wollte sich verstecken. Zur Arbeit gehen, ohne im Zug einen Sitzplatz zu besetzen. Nach Hause kommen und sich einschliessen. Die Schweiz sollte gar nicht merken, dass sie da war.
Eine solche Frau kann nicht überfremden, dachte sie damals. Vor dem Tod wusste sie aber, dass man überfremden kann, auch wenn man nicht da ist. Es reicht die blosse Möglichkeit.
II
Ich bin ganz bewusst zu früh angereist. Ich will das Dorf für mich einnehmen. Ich will da sein können. Drei Tage gebe ich meinen Erinnerungen Zeit und danach will ich nichts mehr wissen und nur noch für den Vortrag da sein. Ganz leer werden. Für den Vortrag.