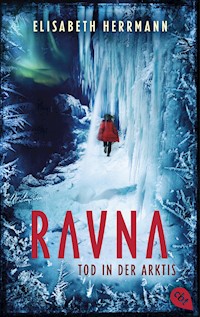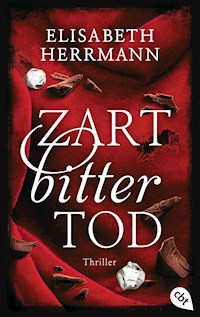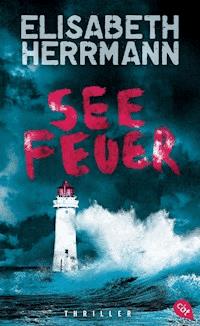
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Meer, so schön – so tödlich!
Marie Vosskamp kann nicht fassen, welchen Freund sich ihre Mutter nach dem Tod ihres Vaters zugelegt hat! Kein Stück traut sie Magnus, der in Windeseile das Kommando über das Vosskamp´sche Familienunternehmen übernimmt - und ihre Mutter auch noch heiraten will! Marie haut ab, um endlich ihre Träume zu verwirklichen, nach Friedrichskoog an die Nordsee, wo sie mit einem begehrten Praktikum ihrem Wunsch, Meeresbiologin zu werden, ein bisschen näher kommt. Dort lernt sie auch den attraktiven Vince kennen, der sich als Schatzsucher für das alte Schiffswrack der Trinity interessiert, das vor der Küste aufgetaucht ist. Mit der Trinity, die in den 50er Jahren in einem schrecklichen Unglück gesunken ist, heben sich dunkle Geheimnisse, die viel mehr mit Marie zu tun haben, als sie sich je hätte vorstellen können. Geheimnisse, die manche lüften und andere um jeden Preis verbergen wollen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Elisabeth Herrmann
Seefeuer
Thriller
What is lost, must be found.
Für Shirin
Schwarzes Kliff, April 1951
Die Blitze zuckten über Himmel und erhellten die bizarrsten Wolken, die Hinner Johansen jemals gesehen hatte. Und er hatte schon viel gesehen mit seinen achtundfünfzig Jahren, von denen er die meisten auf dem Leuchtturm am Schwarzen Kliff verbracht hatte. Wind und Wetter schreckten ihn nicht. Gewitter, Orkane, sogar Windhosen und Schneestürme hatte er hier draußen erlebt. Doch das …
Kilometerhoch türmten sich die nachtschwarzen Wolkengebilde, rollten über das Meer auf die Küste zu wie eine bleigraue Wand, verschluckten die untergehende Sonne und den Horizont.
»Dunkel wie ein Affenarsch«, murmelte er und setzte das Fernglas ab. Er saß an einem der kleinen, runden Fenster seiner Turmwohnung hoch über der Erde, und über ihm befand sich nur noch der Feuerraum, in dem die elektrisch angetriebenen Schweinwerfer standen. Selbst bei diesem Schietwetter schickten sie ihre warnende Botschaft hinaus aufs Meer: Vorsicht, Seeleute, kommt dieser Stelle nicht zu nah!
Aus dem Radio quäkte die Sturmwarnung. Zu spät für die Schiffe draußen. Sie konnten nicht mehr kehrtmachen. Hinner hoffte, dass die Kapitäne der beiden Frachter und des Fischfängers erfahren genug waren, die zackige Küstenlinie zu meiden. Das Schwarze Kliff hatte seinen Namen nicht, weil der sanft geschwungene Hügel über dem Meer so lieblich und vertrauenerweckend wirkte. Es wurde so genannt, weil unter Wasser scharfzackige Felsen lauerten, die eine tückische Laune der Natur direkt vor die Küste geworfen hatte und die für jedes Schiff, das sich bei Ebbe näher als eine halbe Seemeile heranwagte, zur Todesfalle wurden. Der Leuchtturm stand seit Jahrhunderten an dieser Stelle. Erst seit einigen Jahren wurde das Seefeuer elektrisch betrieben. Das erleichterte Hinner die Arbeit so sehr, dass er insgeheim befürchtete, eines nicht so fernen Tages überflüssig zu werden.
Das Grollen des Donners klang durch den Sturm, gefolgt von einer Blitzsalve, dem Artilleriefeuer des aufgewühlten Himmels. Die See antwortete mit einem brüllenden Aufbäumen. Drei, vier, fünf Meter hoch waren die Brecher bereits. Steil aufragende Wasserwände, gekrönt von brodelnder Gischt. Sie rollten auf die Klippe zu, schlugen donnernd auf und schäumten so hoch, dass sie fast bis an Hinners Fenster spritzten. Kochend zog sich das Wasser zurück, um mit der nächsten Dünung anzuschlagen, als ob das Land ein Feind wäre, den diese Urgewalt in die Knie zwingen müsste.
Das Seefeuer leuchtete waagrecht in den Regen. Auch wenn Hinner im vorbeifliegenden Licht nicht viel erkennen konnte, wusste er, dass es draußen auf See meilenweit wahrgenommen werden konnte. Er überlegte gerade, ob er für die armen Seelen auf den drei schutzlosen Schiffen ein Gebet sprechen sollte, als ein Donnerschlag über die Küste und gegen den Leuchtturm krachte, der die Wände wackeln ließ. Hinner zuckte zusammen. Im nächsten Moment spürte er etwas, das er später »elektrisch« nennen würde, auch wenn das nicht stimmte und sein Gefühl nur unzureichend beschrieb. Es war, als ob sprühende Funken in der Luft knisterten. Es roch … nach Feuer. Auch das war falsch. Feuer roch nach Holz, nach Kohle, nach Teer oder Tannenzapfen. Also nach dem, was gerade Raub der Flammen wurde. Dieses Feuer hingegen verbrannte … Wasser. Hätte Hinner sagen sollen, es hätte nach brennendem Wasser gerochen? Aber in diesem Moment wusste er ohnehin noch nicht, was sich über seinem Kopf zusammenbraute. Er ahnte es vielleicht. Später würde er sagen, er hätte den Blitz gespürt, noch bevor er herunterkam. Aber auch das würde ihm niemand glauben.
Instinktiv warf er sich auf den Boden. Keine Sekunde zu früh. Ein loderndes Zischen erfasste und umhüllte den Leuchtturm. Milliarden Watt erleuchteten den nachtschwarzen Himmel. Helles, gleißendes Licht tobte in wildem Zucken um ihn herum. Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten, in denen nur noch Gedankenfetzen durch Hinners Kopf flogen. Gummimatte, zum Beispiel. Dielen. Flammen. Treppe. Raus hier. Nichts wie raus.
Mit einem gewaltigen Schlag erlosch das Licht. Noch bevor der Leuchtturmwärter registrierte, dass es stockdunkel war und sogar das Seefeuer seinen Geist aufgegeben hatte, zersprangen die dicken Scheiben des Leuchtfeuers über ihm, und der Wind schleuderte das schwere Glas auf den Fels weit unten am Fuße des Turms. Es zerbarst mit einem dumpfen Knall. Ein letzter Blitz zuckte spielerisch von der Spitze des Turms hinaus in die Dämmerung, dann war das Phänomen vorüber.
In Hinners Ohren rauschten sein Blut und das Heulen des Orkans, der von diesem Blitzschlag neu belebt zu sein schien und zu noch größerer Form auflief. Durch die leeren Fensterhöhlen über ihm pfiff der Wind. Wasser sprühte herab, als ob jemand mit gewaltigen Gießkannen draußen stände. Mühsam kam Hinner auf die Beine und stützte sich auf dem Ringgeländer ab. Er sah nach oben, in den Feuerraum, zu dem eine Eisenleiter hinaufführte, und sah – nichts.
Der Blitz musste sogar das Notlicht erwischt haben. Fluchend tastete Hinner sich an der Wand entlang bis zu der Kiste, in der die Leuchtpatronen, das Sturmfeuerzeug, eine kleine Axt und Streichhölzer lagen. Dabei warf er einen Blick aus einem der runden Fenster, die anders als die Scheiben oben im Turm keinen Schaden erlitten hatten.
Es war das Fenster nach Osten. Eigentlich ging der Blick über die Küstenlinie weit hinaus bis an die Mündung der Elbe. Kleine Dörfer schmiegten sich an die Deiche, Laternen beleuchteten die Straßen, und weit entfernt, dort, wo das Licht der Stadt Cuxhaven von den Wolken eingefangen wurde, stand sonst ein heller Schein am Himmel. Nun war alles dunkel. Hinner presste einen Fluch zwischen den Zähnen hervor. Offenbar hatte der Blitz nicht nur den Leuchtturm, sondern auch die gesamte Stromversorgung der Küste lahmgelegt. Da hatten sie den Salat. All das Gerede um Elektrizität, und wenn es darauf ankam, war es …
»Dunkel wie ein Affenarsch«, presste er hervor. Er musste das Seefeuer so schnell wie möglich wieder in Gang bringen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Finsternis. Er ahnte weit unten die schaumgekrönten Wellenkämme, die ans Ufer und gegen die Deiche schlugen. Hoffentlich halten sie, dachte er. Hoffentlich keine Sturmflut.
Noch immer zuckten Blitze übers Firmament und erleuchteten die gewaltigen, schwarzen Wolkengebirge. Der nächste Donner war nicht mehr so heftig wie der, der dem Einschlag vorausgegangen war. Hinner bewaffnete sich mit der Taschenlampe, warf den Regenmantel über und machte sich an den mühsamen Abstieg. Dreißig Meter führte die Wendeltreppe von seiner kleinen Wohnung hinab zum Fuß des Leuchtturms. Mühsam stemmte er die schwere Eisentür auf und verfluchte die Baumeister, die den Zugang zum Keller in schwer nachzuvollziehender Absicht genau auf die andere Seite des Turmeinganges gelegt hatten.
Der stürmische Wind blies ihn beinahe aus den Stiefeln und riss ihm den nachlässig mit einem Gürtel zugeknoteten Mantel auseinander. Nach drei Schritten, in denen er sich am Geländer entlang den Böen entgegenstemmte, war er nass bis auf die Knochen. Die See brüllte, der Sturm heulte. Die wenigen Meter bis zur Kellertür waren so anstrengend, dass Hinner nach Luft rang, als er endlich den schweren Schlüssel ins Schloss steckte und umdrehte. Die Riegel forderten seine letzte Kraft. Endlich konnte er die Tür aufziehen. Dabei musste er sich gegen den Wind stemmen, der sie immer wieder mit seiner eisernen Hand zustoßen wollte. Schnell schlüpfte er hinein. Der Knall, als sie hinter ihm ins Schloss fiel, klang fast leise in seinen sturmtauben Ohren.
Instinktiv legte er den Lichtschalter um. Es blieb dunkel. Was zu tun war, hatte Hinner schon mehrmals erledigt. Im Keller stand ein Dieselmotor, den er anwerfen musste und der dafür sorgte, dass das Seefeuer oben im Turm wieder brannte und die Notbeleuchtung anging. Der Brennstoff reichte für acht Stunden, danach musste er den Tank wieder befüllt haben. Mehrere große Blechkanister standen an der Wand. Er war gerüstet für einen mehrtägigen Stromausfall, doch den hatte es noch nie gegeben. Spätestens morgen früh würden die Elektriker aus der nahen Kaserne anrücken und den Schaden beheben. Hinner hoffte, dass keine Kabel verschmort waren oder ein größerer Ausfall entstanden war. Er musste das Feuer zum Brennen bringen. Drei Schiffe waren auf See, gefährlich nahe am Schwarzen Kliff. Sie hatten Radar und Echolot – doch was, wenn der Sturm auch die Elektrik an Bord schachmatt gesetzt hatte? Dann waren es die Seefeuer, die den Weg wiesen. So wie in uralten Zeiten.
Hinner ging zu dem Generator, den er liebevoll Emma nannte, was er natürlich auch niemals jemandem erzählen würde. Wer wie er schon seit Jahren einsam in einem Turm lebte und nur zu seltenen Gelegenheiten einmal ins Dorf ging, empfand eben eine persönliche Zuneigung zu den Dingen, mit denen er sich umgab.
Emma hatte nur wenig Staub auf dem Rücken. Alle vier Wochen schaute er kurz bei ihr vorbei, prüfte, ob sie mit zwei Handgriffen zu starten war und lauschte ihrem beruhigenden Brummen, als wäre es das Schnurren eines Kätzchens. Auch jetzt dauerte es nur wenige Sekunden und der Generator sprang an. Die Notbeleuchtung flackerte auf – zwei Glühbirnen hinter vergittertem Schutzglas. Ihr trüber Schein erhellte den Raum gerade so sehr, wie es nötig war. Hinner nahm das aufatmend zur Kenntnis. Er prüfte die Spannung und den Tank, befand beides für ordnungsgemäß und machte sich auf den Rückweg. Als er die Tür öffnete, verschwand gerade der Schein des Seefeuers hinter dem Turm, um im nächsten Moment auf der Rückseite wieder aufzutauchen und über ihn hinwegzugleiten.
Gut, dachte Hinner. Die alten Methoden sind doch die zuverlässigsten. Er überschlug, wie lange das Seefeuer ausgefallen war – er kam auf eine Zeit zwischen fünf und zehn Minuten, keinesfalls länger. Fast vergnügt machte er sich an den Aufstieg. Auf halber Höhe der Wendeltreppe spähte er hinaus Richtung Cuxhaven. Die tiefe Dunkelheit wurde hier und da von kleinen, flackernden Lichtern durchbrochen. Krankenhäuser, Polizeistationen, vielleicht auch der eine oder andere vorsorgende Privatmann hinter dem Deich, der einen Generator im Hause hatte.
In seiner Wohnung angelangt, verriegelte er als Erstes die Luke zum Feuerraum, damit nicht noch mehr Wasser von oben eindringen konnte. Dann zog er seinen Regenmantel und die Stiefel aus. Er prüfte, ob das Wasser im Kessel noch heiß genug für einen Grog war, fand es lauwarm vor und entzündete die Gasflamme seines kleinen Herdes. Dann holte er die Flasche Rum aus dem Regal, öffnete sie und goss sich eine Handbreit ins Glas. Da der Kessel seine Zeit brauchte, nahm er das Fernglas und trat wieder ans Fenster.
Der Orkan hatte sich zu einem schweren Unwetter abgeschwächt. Hinner suchte das Wasser ab und fand den Frachter in sicherer Entfernung von mindestens drei Seemeilen. Nicht weit entfernt Richtung Nord Nordost pflügte der Fischfänger mit eingeholtem Netz über die aufgewühlte See. Hinner drehte sich mit dem Fernglas mehr nach links und hielt Ausschau nach dem dritten Schiff, da stieß die Kesselpfeife einen hohen, schrillen Ton aus. Er wandte sich ab, goss sich seinen Grog auf und wollte sich in seinen Lehnstuhl zurückziehen, die kalte Pfeife noch einmal in Brand setzen und es sich gemütlich machen. Aber der fehlende Frachter ging ihm nicht aus dem Sinn. Die Position der drei Schiffe hatte er noch klar vor Augen: Erst der Fischer, dann die beiden anderen. Schön brav hintereinander. Das dritte konnte nicht weit weg sein.
Er ging wieder ans Fenster. Dieses Mal suchte er sorgfältig und methodisch. Fischer. Frachter. Nichts. Das dritte Schiff war verschwunden. Mit einem Fluch stellte er das Funkgerät laut, lauschte auf das atmosphärische Knistern und kaum verständliche Wortfetzen. Und dann gefror ihm das Blut in den Adern.
Drei Mal kurz, drei Mal lang, drei Mal kurz. SOS. Save our Souls. Der Notruf, eingesetzt in höchster Lebensgefahr. In fliegender Hast setzte er die Kopfhörer auf. War denn sonst außer ihm niemand in Bereitschaft? Die Küstenwache? Der Seenotrettungsdienst?
Er morste zurück. Hier Seefeuer Schwarzes Kliff. Wie ist eure Position? Was ist passiert?
MS Trinity, kam es zurück. Havarie. Schlagseite. Rettet uns. Rettet uns. Gott sei uns gnädig. Das Schiff sinkt.
Hinner griff zum Telefon,aber die Leitung war tot. SOS, kam es wieder aus dem Funkgerät. SO … Er wartete auf das S, doch es kam nicht. Er funkte zurück, doch die Trinity meldete sich nicht. Mit zitternden Händen schrieb er die letzte Position auf. Dann versuchte er, die nächste Küstenstation zu erreichen. In diesem Moment drang ein dumpfer Schlag an seine Ohren. Er sprang zum Fenster, riss es auf und sah hinaus. Nichts. Wieder ein Schlag. Ganz nah. Von unten. Er holte seinen Stuhl, schob ihn an die Wand, stieg hinauf und lehnte sich, so weit es ging, aus dem Fenster.
Es war ein Rettungsboot, das an den Felsen zerschellte. Es war leer.
1.
»Marie?« Pia tauchte in der offenen Tür der Futterküche auf. Sie hielt Maries gelbe Regenjacke in der Hand und warf sie ihr zu. »Einsatz auf Wilhelmswacht!«
Marie Vosskamp fing das Teil gerade noch auf, bevor es im Futtereimer landen konnte. Besser gesagt: in einem Brei aus püriertem Fisch, Milchpulver, Fett und Lezithin. Nicht gerade das, was sie gerne mit einem kräftigen Wasserstrahl von ihren Ärmeln gespritzt hätte. Ehrlich gesagt auch nicht das, womit sie gerechnet hatte, als sie vor knapp zwei Monaten ihr Praktikum in der Seehundaufzuchtstation von Friedrichskoog begonnen hatte.
»Du gewöhnst dich dran«, hatte Pia ihr damals gesagt. Richtig. Angenehmer machte es den Geruch trotzdem nicht.
Worüber Menschen die Nase rümpften, war für die Neuzugänge der Aufzuchtstation überlebensnotwendig. Oft hatten sie die Seehunde und Kegelrobben so geschwächt vorgefunden, dass sie noch nicht einmal mehr fressen konnten. Dann flößten Marie und ihre Kollegen ihnen die Mischung ein. Vor allem die Heuler, von ihren Müttern getrennt und deshalb oft dem Verhungern in freier Wildbahn preisgegeben, legten mit dieser hochkalorischen Mischung innerhalb kürzester Zeit ordentlich zu. Zurzeit befanden sich vier Kegler, alles junge Robben, auf der Station. Ein Blick in Pias ungeduldige Miene verriet, dass es schon heute mehr werden könnten.
»Wer übernimmt die Fütterung?«
Pia Müller grinste sie an. Ihr roter Haarschopf schien sogar im Dunkel der Futterküche zu leuchten. Sie hatten die Jalousien heruntergelassen, denn draußen schien die Sonne, und es war ein ungewöhnlich warmer Tag. »Die Ladies, die auch die Führungskommentierung machen. Komm jetzt. Anne und Jensen sind schon im Hafen.«
Marie verstaute den Eimer unter der Spüle. Sie schlüpfte schnell in ihre Jacke, ein leichter gelber Friesennerz, und folgte Pia hinaus. Im Laufen zog sie den Haargummi von ihrem Pferdeschwanz und band sich ihre schulterlangen hellbraunen Haare zu einem Knoten. Sie wusste, dass ihr diese Frisur nicht stand. Ihre Augen waren zu klein, der Mund war zu groß und die Nase – irgendwie zu schmal mit einem leichten Drall nach links. Früher hatte sie die Haare am liebsten wie einen Vorhang ins Gesicht frisiert getragen. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, dass sie niemals eine wilde, üppige Haarpracht haben würde. Dass selbst Make-up diesem Gesicht keine Schönheit, sondern nur maskenhafte Künstlichkeit verlieh. Sie verzichtete weitgehend darauf, halb aus Trotz, und halb, weil sie keinen rechten Glauben in all die Farbtöpfe und Buntstifte hatte. Blicke in den Spiegel vermied sie, soweit es ging. Sie war zwischen schlank und kräftig, etwas mehr mittel als groß, irgendwie in allem mittel – also nichts Halbes und nichts Ganzes, so redete sie es sich in schlechten Momenten ein, nur in der Schule war sie gut gewesen.
Da Seehunde überwiegend auf anderes als das Aussehen ihres Pflegers achteten, fühlte Marie sich wohl in Friedrichskoog. Zumindest wohler als in den alleenartigen, stillen Straßen ihrer Heimatstadt weiter unten an der Elbmündung. Wohler als auf der Privatschule, in der sie sich all die Jahre vorgekommen war wie ein roher Flusskiesel unter strahlend geschliffenen Diamanten. Und sogar wohler als zu Hause, in diesen leeren, fast unbewohnt wirkenden Räumen, aus denen seit der Sache mit ihrem Vater jedes Leben gewichen zu sein schien.
Bis der Fremde kam.
Sie verbot sich, den Gedanken weiterzuverfolgen. Vielleicht war es ein Segen, dass ihre Mutter nicht mehr allein war. Aber Marie war sich nicht sicher. Die Veränderungen in ihrem Leben waren zu plötzlich und zu krass geschehen. Manchmal kam ihr Friedrichskoog ebenfalls vor wie eine Insel. Ein Ort, der ihr Schutz bot und ein Zuhause war, wenn auch nur auf Zeit. Aber an dem sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit angenommen fühlte.
Die Aufzuchtstation selbst war für Besucher gesperrt. Im öffentlichen Bereich befanden sich jedoch mehrere Freibecken mit Unterwasserfenstern, das Dokumentationszentrum und eine kleine Cafeteria. Im Moment wurden die Dauerhaltungstiere gefüttert. Kegelrobben und Seehunde, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr ausgewildert werden konnten. Sophies helle Stimme klang über den Lautsprecher. Sie erklärte gerade den staunenden, kichernden, interessierten oder auch gelangweilten Schulklassen, wie man sich den Tieren gegenüber verhielt.
»Erstes Gebot: Nicht anfassen! Seehunde und Robben sind Raubtiere, vergesst das nicht. Ein verletztes Tier kann aggressiv werden, also zweites Gebot: Abstand halten! Hunde sofort an die Leine! Dann hat das Tier vielleicht noch die Chance, zu seinen Artgenossen zurückkehren zu können und nicht ausgestoßen zu werden.«
Marie sah, wie das blonde Mädchen einer Robbe mehrere einfache Zeichen vor die Schnauze hielt: Kreuz, Viereck, Kreis. Zielsicher suchte das Tier das richtige Zeichen aus und wurde dafür zur Belohnung mit einem Fisch gefüttert. Damit sie genügend Bewegung bekamen, durften die Dauerhaltungstiere mehrmals am Tag in die Außenbecken. Die Vorführungen kamen ihrer munteren Natur sehr entgegen. Sie sprangen durch Reifen, verschoben Klötzchen und zeigten unter Wasser eine mal verspielte, mal atemberaubende Eleganz, während sie an Land eher tollpatschig wirkten. Genau das eroberte die Herzen der vielen Besucher im Sturm. Selbst die mauligsten Schüler stießen entzückte Ausrufe aus und klatschten begeistert, wenn einer der Robben ein Kunststück geglückt war. Doch eine Aufzuchtstation war kein Zirkus. Sophie trug ein Mikrofon. Sie und ihre Helfer – Buftis und Praktikanten wie Marie – gaben Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit, zu der viel mehr gehörte als Showeffekte.
»Drittes Gebot, falls ihr am Strand einen allein liegenden Seehund oder eine Kegelrobbe findet: Seehundjäger, Seehundstation und Polizei benachrichtigen!«
Und dann machen wir uns auf den Weg, dachte Marie.
Sophie hatte sie entdeckt und warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu. »Gerade haben wir so einen Notruf bekommen«, fuhr sie fort. Ihre Stimme klang etwas verzerrt durch das Mikrofon, trotzdem hingen die Besucher an ihren Lippen und wollten sich kein Wort entgehen lassen. »Marie und Pia sind auf dem Weg zum Schiff. Der Vogelwart hat zwei Seehunde gemeldet.«
Alle Köpfe wandten sich zu ihr um. Marie wurde feuerrot. Sie spürte die bewundernden Blicke der Schulkinder. Achte, neunte Klasse? Für einen kurzen Augenblick tauchte ein Bild in ihrem Inneren auf: sie selbst, zwölf, vielleicht dreizehn Jahre alt. Wandertag. Ausflug an die Friedrichskoog-Spitze. Watt. Aufzuchtstation. Fasziniert hatte sie den Führern zugehört. Helden waren sie gewesen, Retter kleiner Seehunde, die, von den Müttern getrennt oder verletzt, sonst gestorben wären. Die Station war ihr wie eine Insel des Guten in einer feindlichen Welt erschienen. Dass sie jetzt dazugehörte, wenigstens für diese kurzen Wochen des Praktikums, erfüllte sie mit einem unbändigen Stolz.
Maries Herz machte einen schmerzhaften Sprung. Sie liebte ihre Arbeit. Und sie wünschte sich nichts mehr, als dass man sie im Anschluss für ein freiwilliges ökologisches Jahr übernehmen würde. Danach wollte sie Wildbiologie studieren und maritime Meeressäuger erforschen. Aber im Moment war am wichtigsten, dass es gelang, Jack Sparrow auszuwildern. Ihren Liebling, den ersten Heuler, den sie gefunden und gerettet hatte und der mit seinen knapp acht Kilo eigentlich chancenlos gewesen war. Wie gerne wäre sie noch dabei, wenn er weit draußen auf See mit einem aufmunternden Klaps wieder in sein freies, wildes Leben entlassen werden würde.
»Sag mal, brauchst du eine Extra-Einladung?« Pias Stimme riss sie aus ihren Träumen in die Gegenwart.
»Nein. Sorry.«
Sie liefen zum Tor, wo schon die nächsten Schulklassen und Urlauber darauf warteten, eingelassen zu werden. Im Sommer herrschte hier Hochbetrieb. Und an einem Tag wie diesem, mit strahlend blauem Himmel und einem fast südlich warmen Wind, war der Ansturm manchmal kaum noch zu bewältigen. Marie und Pia drängten sich durch die geordneten Klassenaufstellungen, die die Lehrer gerade zustande gebracht hatten, und entschuldigten sich mit hastigen Worten.
»Ein Notfall. Sorry. Dürfen wir mal?«
»Was für ein Notfall?«, fragte eine absurd hochgestylte, kaugummikauende Neuntklässlerin.
»Zwei verwaiste Seehunde auf Wilhelmswacht«, antwortete Marie.
»Gott, wie süß!«, rief das Mädchen aus. »Können wir mitkommen?«
»Nein«, zischte Pia genervt und zog Marie aus dem Pulk weiter.
Sie erreichten den Parkplatz, der bereits hoffnungslos überfüllt war und auf dem herumirrende Geländewagen für weiteren Stress sorgten. Dann liefen sie über die Straße und hinüber zum Rugendorfer Loch, dem Dorfhafen, wo die schlanken Masten der Krabbenkutter schon von Weitem zu sehen waren. Ganz vorne lag die Seerose. Sechs Meter lang, mit einem niedrigen Steuerhaus, schnell, wendig und jederzeit einsatzbereit. Marie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Noch zwei Stunden bis zum Gezeitenwechsel. Auslaufen konnten sie nur bei Flut.
»Nach Wilhelmswacht?«
»Jep«, antwortete Pia knapp.
Eine Insel zwischen Trischen und Tertiussand, mitten in der Meldorfer Bucht. Eine Wanderinsel. Wenn die Ebbe die Gezeitenküste von der Elbe bis zur Eider in ein Wattenmeer verwandelte, sich Sandbänke erhoben, Ton, Sand und Schluff mitgerissen wurden, Wasserströmung, Seegang und Wind unglaubliche Kräfte in Bewegung setzten, entstanden solche Gebilde. Auf Trischen, einer halbmondförmigen Erhebung, hatte vor langer Zeit einmal ein Bauernhof gestanden. Doch das Eiland wanderte langsam aber stetig jedes Jahr dreißig Meter Richtung Festland und würde, wenn es seine derzeitige Geschwindigkeit beibehielt, in vierhundert Jahren an Büsum andocken. Eine Bewirtschaftung war unmöglich. Man hätte alle fünf Jahre sein Haus verschieben müssen. Der Gedanke, dass irgendwo unten auf dem Meeresgrund dieser längst versunkene Bauernhof lag, hatte für Marie etwas Romantisches und Unheimliches zugleich.
Wilhelmswacht hingegen war noch jung, erst vor ein paar Jahrzehnten aufgetaucht, eine Insel ohne Kern, ein Sandhaufen im Meer. Auf der Nordseite ein Marschrücken, der in der Mitte durchbrochen war und an der Kante eine Art Kliff bildete, dahinter ein weites, flaches Geest aus Mergel, Sand und Kies. Struppige Vegetation krallte sich hier tapfer fest. Geschaffen aus See- und Brackmarsch, eine unbedeichte Insel, die in regelmäßigen Abständen überflutet wurde. Vielleicht würde sie beim nächsten Sturm untergehen, vielleicht weiterwandern – wer wusste es? Im Moment jedoch war sie da, trügerisch und unbewohnt, und genau deshalb ideal für brütende Vögel oder Seehunde, die ihren Nachwuchs zur Welt bringen wollten.
»Schaffen wir das denn noch?« Marie keuchte ein wenig. Sie liefen schnell, um keine kostbare Sekunde zu vergeuden.
»Frag Jensen. Und wenn nicht, liegen wir eben ein paar Stunden im Wattenmeer auf Grund und müssen warten, bis die Flut das Schiff wieder freisetzt. Es gibt Malefiz an Bord.«
Pia war die abgekochteste Malefiz-Zockerin, die Marie jemals untergekommen war. Das waren keine schönen Aussichten. Außerdem knurrte ihr Magen. Nach den Seehunden wären nämlich die Pfleger mit dem Essen an der Reihe gewesen.
Die Seerose war ein umgebauter Fischkutter. Dort, wo früher die Netze entleert worden waren, hatte man eine tiefe Wanne in das Deck eingelassen. In ihr wurden die Seehunde transportiert. An der Reling stand Anne Rickenberg, die Leiterin der Station. Sie war eine schlanke, braun gebrannte Frau Anfang vierzig, mit sonnengebleichten kurzen Haaren und dem frischen Blick all jener, die sich viel unter freiem Himmel aufhielten. Sie sprach mit Jens Jensen, dem Käptn, der ruhig wie ein Fels in der Brandung am Kai stand und darauf wartete, dass die beiden Nachzügler endlich eintrafen. Auf einem Poller daneben saß sein Ferienkind Gottfried, eine Leseratte, die sogar jetzt noch mit der Nase in einem Buch steckte und so aussah, als ob alles um sie herum versunken wäre. Gottfried würde – hoffentlich! – die Leinen lösen, sobald die Seerose startbereit war.
»Beeilt euch!«, rief Anne den Mädchen zu.
Pia enterte das Schiff als Erste und half dann Marie an Bord.
Jensen kletterte als Letzter zu ihnen. »Leinen los!«
Ein kurzer Pfiff und Gottfried klappte das Buch zu und sprang auf. Während er das dicke Tau von dem Poller löste und Pia und Marie sich die Schwimmwesten anlegten, klärte Anne sie über die Hintergründe der kleinen Expedition auf.
»Wilhelmswacht ist schwer zu erreichen«, berichtete sie. »Die Sandbänke unter Wasser wandern ständig. Nehrungen tauchen auf und verschwinden wieder. Schuld ist die Gezeitenbewegung. Jensen kennt das Gebiet zwar wie seine Westentasche, aber auch er sagt, die Ecke ist tückisch. Die Insel liegt mitten im Nationalpark, Besucher gibt es da nicht. Deshalb wissen wir auch nicht, wie lange die beiden Seehunde schon dort liegen.«
»Der Vogelwart hat uns alarmiert?«, fragte Marie und kämpfte mit dem Gurtverschluss.
»Ja. Er ist der Einzige, der die Insel betreten darf. Bei seiner Runde hat er die beiden entdeckt. Es sieht nicht gut aus.«
Annes Augen bekamen einen mitfühlenden Schimmer. Ihr Blick wanderte kurz zu Jensen, der gerade in den Steuerstand ging und so tat, als hätte er nichts gehört. Marie wusste, was das zu bedeuten hatte. Jensen war früher einmal Fischer gewesen. Jetzt war er Seehundjäger. Sie hatte nicht gewusst, dass es diesen Beruf hierzulande noch gab. Und wenn, hätte sie ihn instinktiv verabscheut und verurteilt. Erst ihre Zeit in Friedrichskoog hatte sie umdenken lassen. Es gab Tiere, für die kam jede Hilfe zu spät. Wie lange sollte man sie leiden lassen? Bis jetzt hatte Marie glücklicherweise kein einziges Mal erlebt, dass es zum Äußersten gekommen war. Auch Anne konnte sich angeblich nicht erinnern, wann Jensen das letzte Mal von seinem Gewehr Gebrauch gemacht hatte. Es lag in einer Kiste im Steuerhaus, in der Sitzbank verstaut, gesichert mit einem Vorhängeschloss, zu dem nur Jensen den Schlüssel hatte.
Sie kann oder sie will sich nicht erinnern, dachte Marie. Keiner redete gerne über eine solche Erfahrung. Das waren die Schattenseiten. Eines Tages würde sie selbst so eine Entscheidung treffen müssen. Dann würde sie froh sein, jemanden wie Jensen an ihrer Seite zu haben, der ihr die schreckliche Aufgabe abnahm, ein Tier von seinem Leiden zu erlösen.
»Sind sie verletzt?«, fragte Pia. Der Wind wehte ihr die roten Haare immer wieder ins Gesicht. Sie hatte lustige Sommersprossen, und Marie fand, dass es ein Segen war, sich mit ihr ein Zimmer zu teilen. Zwei Chaotinnen auf zwölf Quadratmetern … »Passt!«, hatte Pia mit einem frechen Grinsen gesagt. Außerdem kam sie aus Harrislee bei Flensburg. Marie mochte Pias trockenen Humor und die bodenständige, zupackende Art.
Der Motor tuckerte. Die Luft roch nach Diesel und Salz. Über ihnen schrien die Möwen. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonnenstrahlen ließen das Wasser funkeln wie Milliarden Diamanten. An Land war es fast windstill gewesen, doch sobald der Trawler die Schleuse passiert und den kleinen Hafen von Friedrichskoog verlassen hatte – begleitet von einem halben Dutzend hoffnungsvoller Möwen –, würde es ziemlich ungemütlich werden.
Anne checkte die Schwimmwesten ihrer Mitarbeiterinnen. »Nein, von Verletzungen war nicht die Rede. Aber sie wirken sehr geschwächt. Möglich, dass sie schon vor längerer Zeit dort gestrandet sind. Der Vogelwart ist erst heute Morgen eingetroffen und hat vor den Zählungen nur einen Rundgang gemacht. Dabei hat er sie entdeckt. Setzt euch.«
Zwei Seehundjungen, vielleicht Heuler. Das waren von ihren Müttern verlassene Jungtiere, die tatsächlich so etwas Ähnliches wie weinende Klagelaute ausstießen. Im Sommer kamen solche Sichtungen beinahe täglich vor. Wenn die Leute von der Seehundstation gerufen wurden, mussten sie als Erstes die Lage checken und oft genug die Tiere von ihren Rettern fernhalten. Meistens waren es Urlauber, Familien mit Kindern, die die kleinen Heuler am liebsten sofort adoptiert hätten. Dabei konnten Seehunde und Kegelrobben ziemlich gefährlich werden. Vor allem, wenn sich die Mutter der Jungtiere noch in der Nähe aufhielt. Dann sperrten die Helfer den Strand ab und versuchten, das Findelkind zurück ins Wasser und zu seiner Mutter zu bringen. Wenn es aber weit und breit keine Mutter gab, dann nahmen sie die Kleinen mit.
Das Ziel der Station war, sie so fit wie möglich für ein Leben in freier Wildbahn zu machen und sie, sobald sie ein anständiges Kampfgewicht hatten, wieder auszusetzen. Maries Herz klopfte schneller, wenn sie an Jack Sparrow dachte. Sie hatte den Heuler auf eine ganz und gar unprofessionelle Weise lieb gewonnen. Am liebsten hätte sie ihn auf der Station behalten. Doch das war unmöglich und sehr, sehr egoistisch gedacht. Die Robben und Seehunde wollten in der Nordsee leben, jagen, auf Sandbänken in der Sonne liegen, die Freiheit spüren.
Marie und Pia nahmen auf den Bänken an der Reling Platz. In dem Becken lagen Köcher, Stangen und ein Netz. Es war nicht das erste Mal, dass sie auf einer Bergung mit dabei waren. Trotzdem war Marie aufgeregt. Sie sah zu Pia. Ging es ihr ähnlich? Ihre Mitchaotin streckte gerade die Nase in die Sonne und machte einen schwer relaxten Eindruck.
»Denn man tau!«, rief Jensen.
Der Motor brüllte und stieß eine schwarze Dieselwolke aus. Die Möwen zogen sich zeternd zurück. Nicht für lange, wusste Marie. Sie verließen Friedrichskoog und nahmen Kurs auf die Inseln. Schon nach wenigen Minuten zerrten die Böen an Maries Anorak und zerzausten ihre Haare. Tief atmete sie die salzige Luft ein. Als Ufer und Strand immer kleiner wurden und das Meer sich vor ihr ausbreitete wie ein riesiger, graugrüner Teppich, stand sie auf und ging nach vorne.
Der brüllende Dieselmotor pflügte das kleine Schiff durch die Nordsee. Sie fühlte sich mindestens wie Kate Winslet in Titanic.
Fragt sich nur, wann Leonardo endlich auftaucht.
Sie grinste und hielt sich an der Reling fest. Jedes Mal, wenn die Seerose in ein Wellental hinabfuhr, sackte ihr Magen nach unten und sie ging leicht in die Knie. Glücklicherweise wurde sie nicht seekrank. Dafür löste sich ihre Frisur jetzt völlig auf und die Haare peitschten ihr ins Gesicht. Natürlich könnte sie zu Jensen in den Steuerstand schlüpfen. Sie drehte sich um und winkte ihm zu. Der knurrige Seebär kniff die Augen zusammen, weil ihn die Sonne blendete, und konzentrierte sich auf den Kurs. Anne saß neben ihm auf dem zweiten Steuersitz. Sie hatte eine Seekarte in der Hand und beugte sich gerade darüber, wahrscheinlich, um eine Vorstellung von der Lage der kleinen Vogelinseln zu bekommen.
Jensen drosselte den Motor. Der Wind drehte sich und trieb eine Wolke Dieselgestank nach vorne. Marie hob ihr Fernglas und ließ den Blick über den Horizont wandern. In der Ferne konnte sie ein Stück flaches Land erkennen – Wilhelmswacht. Sie sah auf die Uhr und rechnete nach. Noch eineinhalb Stunden Zeit bis zur Ebbe. Vielleicht hatten die Seehunde die Flut zur Flucht genutzt. Wenn nicht … Die Aufzuchtstation hatte Platz genug. Aber sie wunderte sich, dass Jensen jetzt schon langsamer wurde.
Vorsichtig hangelte sie sich an der Reling entlang in den Steuerstand. Der Wind auf See war kräftig, fast hätte er ihr die Tür aus der Hand gerissen. Jensen saß auf seinem Stuhl und drehte sich nicht nach ihr um. Etwas fesselte seine ganze Aufmerksamkeit. Die Seekarte. Anne schreckte hoch. Sorge stand in ihrem Gesicht.
»Was ist los?«, fragte Marie und verschloss die Tür sorgfältig hinter sich. Der alte Seebär runzelte die Stirn. Seine wettergegerbten Züge und die tief ins Gesicht gezogene Mütze ließen ihn aussehen wie jemanden, dem die See so schnell nichts vormachen konnte. Mit einem knappen Nicken wies er nach vorne.
»Ja?« Das Meer sah aus wie immer. Ein graugrüner, kabbeliger Wellenschlag mit Schaumkronen.
»Es ist anders.«
Marie sah genauer hin. »Wie anders?«
Jensen zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich war es schwer zu erklären, worin sich die Nordsee an diesem Tag von der Nordsee anderer Tage unterschied. Marie sah zu Anne. Die Leiterin der Station vertraute ihm. Wenn jemand sich auskannte mit dem Meer, dann er.
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht …« Jensen schüttelte missbilligend den Kopf und änderte den Kurs. Sie hatten Wilhelmswacht eigentlich von Südwest aus erreichen wollen. Nun zog er nach steuerbord. Sie würden also Nordost an Land gehen.
»Hier?«, fragte Anne und deutete auf die Karte.
Jensen nickte.
Besorgt sah Marie auf die Messinguhr an der Tür. Es war schon halb fünf am Nachmittag. Wilhelmswacht war nicht groß, keine zwei Quadratkilometer. Aber die Insel war Naturschutzgebiet. Das hieß: keine Wege und ein naturbelassener Strand, an dem sich das Treibgut stapelte. Wer einmal versucht hatte, sich durch so eine Wildnis zu kämpfen, lernte, selbst den schmalsten Trampelpfad zu schätzen. Noch nicht mal den gab es da.
»Wie anders?«, fragte Marie noch einmal.
»Halt anders«, brummte er.
Sie nickte und ging wieder nach draußen. Pia saß immer noch auf der Bank in der Sonne. Sie setzte sich neben sie. Es war zu laut, um sich ohne Anstrengung zu unterhalten, also hing Marie einfach ihren Gedanken nach. Dumm war nur, dass sie ständig und immer wieder um ihr Zuhause in Cuxhaven kreisen wollten. Sie war im Streit gegangen, und es schien keinen Weg zur Versöhnung zu geben.
Es bringt nichts. Wenn du die Umstände nicht ändern kannst, musst du sie akzeptieren.
Aber wie akzeptierte man einen Mann an der Seite seiner Mutter, mit dem man so überhaupt nicht klarkam? Der tatsächlich die Frage: »Sie oder ich« gestellt hatte? Und ihre Mutter Viola, immer ängstlich, immer irgendwo in ihrem Wolkenkuckucksheim, immer mit dieser Sehnsucht nach der starken Schulter zum Anlehnen und Abladen, ihre eigene Mutter hatte sich für den Mann und gegen die Tochter entschieden. Hatte es wirklich keinen anderen Weg gegeben?
Nein.
Das Schiff wurde langsamer. Pia stand auf und ging nach vorne. Marie folgte ihr. Wilhelmswacht lag, einen halben Kilometer entfernt, wie eine sanft begrünte Sandbank vor ihnen.
»Zieht eure Wathosen an.« Anne kam aus dem Steuerstand. Sie war schon in die hüfthohe Schutzkleidung geschlüpft, die so unvorteilhaft wie ein Sack aussah, aber alles, was man darunter anhatte, vor dem Wasser schützte. Wenn man vorsichtig war und nicht im Überschwang vom Boot ins Wasser sprang, wie Marie das einmal gleich zu Anfang getan hatte. Nordseewasser war selbst im Hochsommer nicht gerade badewannenwarm.
Jensen fuhr noch zweihundert Meter näher an den Stand und ließ dann den Anker hinunterrasseln. Skeptisch starrte Marie in die Fluten.
»Es ist nur knapp einen Meter tief. Steigt langsam runter, dann werdet ihr auch so schnell nicht nass.« Anne warf ihnen einen aufmunternden Blick zu und schob die Außenleiter über die Reling. »Beeilt euch. Wir haben nicht viel Zeit.«
Anne ging als Erste von Bord. Dann kam Pia an die Reihe. Als Letzte folgte Marie. Jensen reichte ihnen zwei Korbkisten mit Deckel herunter, groß genug, um je ein Jungtier zu transportieren. Die Temperatur des Wassers war durch den langen Sonnentag erträglich. Marie warf noch einen schnellen Blick zurück auf die Seerose, die in der seichten Dünung dümpelte. Jetzt kletterte auch Jensen von Bord und nickte ihr zu. Aus irgendeinem Grund gab ihr diese kleine Geste Zuversicht. Wenn wir zwei Heuler finden, dachte sie, werden wir auch mit beiden zurückkommen.
Das Ufer war flach und nur leicht ansteigend, sodass sie kein Problem hatten, an Land zu kommen. Ab da wurde es mühsam. Der Sand war nass und gab unter jedem Schritt nach. Wilhelmswacht war flach wie eine Flunder. Dennoch gab es ein paar sanfte Dünen, die den Blick auf den Nordstrand verstellten. Am liebsten wäre Marie geflogen. Stattdessen keuchte sie vor Anstrengung. Der Wind war fast genauso stark wie auf offener See und blies ihr die Haare in die Augen. Es war ein kräftezehrender Marsch.
»Geht es?«, fragte Anne, die vorausging und sich kurz nach den beiden Mädchen umwandte.
Marie und Pia schleppten gemeinsam eine Kiste, Jensen trug die zweite.
»Ja!«, antworteten alle drei wie aus einem Mund.
Nach einer Viertelstunde erreichten sie den Nordstrand der kleinen Insel.
»Da!« Anne blieb stehen. »Bleibt hinter mir!«
Marie blinzelte gegen die Sonne. In gut hundert Meter Entfernung lagen zwei Seehunde. Sie reagierten nicht, als der kleine Trupp näher kam und die Kisten absetzte. Anne gab ihnen ein Zeichen zurückzubleiben, während Jensen sich Anne anschloss. Vorsichtig näherte sich die erfahrene Biologin den beiden Tieren, die immer noch reglos dalagen. Marie ließ sie nicht aus den Augen.
»Sie leben!«, rief Anne in ihre Richtung. »Ihr könnt kommen!«
Marie lächelte Pia erleichtert an. Sie nahmen die Kisten und eilten, so schnell sie konnten, den Strand entlang.
»Der eine ist verletzt.« Anne deutete auf den kleineren der beiden Seehunde. Er lag mit geschlossenen Augen da, als ob er schlafen würde. Sein Atem ging flach. Marie schätzte ihn auf acht, neun Kilo. Quer über den Rücken verlief eine hässliche, blutverkrustete Wunde.
»Hat ihn jemand angegriffen?«, fragte Marie entsetzt. Sie ging in die Knie. Der Heuler versuchte, die verklebten Augen zu öffnen und blinzelte sie an. Impulsiv streckte sie die Hand aus und zog sie gerade noch rechtzeitig zurück. Sie hatte kein Kuscheltier vor sich.
»Nein.« Jensen schüttelte den Kopf. »Sieht mir eher so aus, als ob er sich an einer scharfen Kante geschnitten hätte.« Mit gerunzelter Stirn sah er hinaus aufs Meer. »Aber hier gibt es keine scharfen Kanten. Das schwarze Kliff ist viel zu weit entfernt.«
»Es sieht so aus, als wäre er irgendwo hängen geblieben«, sagte Marie. Erst jetzt bemerkte sie, dass auch seine linke Vorderflosse einen hässlichen Schnitt aufwies.
Jensen nickte. »Fragt sich bloß, wo. Vielleicht ein altes Ölfass, das irgendein Mistkerl heimlich über Bord geworfen hat. Oder …« Er brach ab.
»Oder was?«, fragte Pia. Sie stellte eine der Kisten neben Marie und Jensen ab.
Der kräftige Mann bückte sich und gab den Mädchen ein Zeichen. Zu dritt hoben sie den Heuler vorsichtig hoch und ließen ihn in die Kiste gleiten. Anne verschloss sie sorgfältig. Dann gingen sie zu dem zweiten Seehund. Das Jungtier schien ein wenig kräftiger zu sein. Es machte ein paar schwache Bewegungen mit den Vorderflossen, aber der klägliche Fluchtversuch misslang.
»Der hier ist unverletzt«, stellte Anne fest. »Jedenfalls hatten sie großes Glück, dass der Vogelwart uns alarmiert hat. Noch ein, zwei Tage länger und sie wären verhungert.«
»Werden sie es schaffen?«, fragte Marie.
»Wir sollten uns beeilen. Jensen möchte die Seerose bestimmt nicht vor Friedrichskoog auf Grund setzen.«
Jensen brummte zustimmend. Wieder sah er hinaus aufs Meer. Irgendetwas schien ihn nach wie vor zu beunruhigen.
»Ist was?«, fragte Marie.
Aber Jensen schüttelte nur den Kopf.
2.
Die Kisten lagen in der Wanne. Anne war bei Jensen. Pia streckte ihre Nase der Sonne entgegen. Marie stand an der Reling. Sie spürte den Wind im Gesicht und Glück im Herzen. Leben retten war einfach ein verdammt guter Job.
Im nächsten Moment riss sie ein Schlag von den Füßen. Pia fiel mit einem erschrockenen Schrei in die Wanne. Das ganze Schiff bebte. Ein ohrenbetäubendes Geräusch erklang. Ein unheilvolles Krachen, gefolgt von jammerndem Stöhnen. Der Boden unter ihren Füßen vibrierte. Marie wollte sich an der Reling hochziehen, als der nächste Aufprall sie wieder von den Füßen riss. Sie rutschte über Deck hinein in die Seehundwanne zu Pia. Hektisch klammerten sie sich aneinander fest.
»Was ist das?«, schrie Marie. Panik kroch in ihr hoch. Hatte Jensen nicht gesagt, die nächsten Klippen wären meilenweit entfernt?
Noch ein Schlag. Knirschen, Quietschen, das Reißen von Eisen und Holz.
»Scheiße!«, rief Pia. »Weißt du, dass ich im Schwimmen immer die Schlechteste war?«
Sie konnten Jensen fluchen hören. Er trieb wohl den Motor hoch und riss das Rad herum. Die Seerose begann, sich um ihre eigene Achse zu drehen. Offenbar hing sie irgendwo fest. Aber das war unmöglich. Sie waren auf dem Meer. Bis auf den schmalen Streifen Land von Wilhelmswacht und die verschwommene Küstenlinie des Festlandes war weit und breit nichts zu sehen.
»Jensen!«, brüllte Marie und kam wieder auf die Beine. Doch er konnte sie nicht hören. In Windeseile kletterte sie aus der Wanne.
Der Dieselmotor röhrte und schickte eine schwarze Wolke in die Luft. Marie hustete. In das Stampfen der Maschine mischte sich ein schrecklicher, eiserner Ton. Eine Art rostiges Wehklagen, wenn es das gab, ein hohles Jaulen wie von einknickenden Stahlträgern. Die Sandrose war aufgelaufen. Aber das war unmöglich! Dies war das Wasser vor einer sanft aus der Nordsee aufsteigenden Insel, ohne Untiefen, ohne Abgründe, ohne Felsen.
In einer fast verzweifelten Anstrengung bäumte sich das kleine Schiff auf. Ein Knirschen zerriss beinahe Maries Trommelfell. Nicht, betete sie, bitte bitte nicht … Das Jaulen schwoll an und endlich schoss das kleine Schiff nach vorne und landete sanft in einem Wellental.
Marie stürzte zur Reling. Dann hangelte sie sich am Steuerstand vorbei nach hinten. Sie sah das aufgewühlte, weiße, gischtige Wasser hinter dem Schiff. Es würde Minuten brauchen, bis es sich wieder beruhigt hatte. Enttäuscht wandte sie sich ab und wollte gerade zu den anderen zurückkehren, da klopfte es.
Als ob jemand mit einer schweren Eisenstange ans Heck des Schiffes schlagen würde. Als ob jemand … zu ihnen wollte und energisch um Einlass bat. Jemand mit gewaltigen Kräften und einem mindestens ebenso gewaltigen Stück Eisen. Marie fuhr herum und sah Pia, die es auch gehört haben musste. Das Mädchen war wachsbleich, die Augen hatte sie vor Schreck weit aufgerissen und den Mund geöffnet zu einem Schrei. Jensen drosselte den Motor. Anne stürzte aus dem Steuerhaus und rief ihnen etwas zu. Wieder ein Schlag. Marie beugte sich vor, so weit es ging, und spähte ins Wasser, in die Richtung, aus der sie dieses fürchterliche Klopfen vermutete. Sie erkannte ein Stück rostiges Eisen. Armdick und verbogen, das sich irgendwie am Rumpf der Seerose verfangen hatte und vom Wellengang hin- und hergeschleudert wurde. Sie hörte die Tür schlagen und Jensens schwere Schritte an Deck näher kommen. Sie stand immer noch so unter Schock, dass sie nur wortlos auf das Eisending deuten konnte. Jensen schob sich die Mütze in den Nacken und murmelte irgendetwas wie gottverdammich. Dann begutachtete er das Schiff, soweit ihm das möglich war. Pia und Anne kamen zu ihnen.
»Was ist das?« Maries Knie waren immer noch weich, ihre Hände zitterten, und am Abend würde sie wahrscheinlich eine Menge blaue Flecken zählen können. Aber das war nichts im Vergleich zu der Höllenangst, die sie gerade ausgestanden hatte.
Jensen setzte die Mütze ab, fuhr sich mit den Händen durch die struppigen, weißen Haare und schüttelte den Kopf. »Wir haben eigentlich zwölf Meter Wasser unterm Kiel.«
»Eigentlich.« Anne, blass unter der Bräune, deutete auf das Teil, das von der nächsten Welle hochgehoben und wieder mit einem Krachen an die Bordwand geschlagen wurde. »Was also kann das sein? Eisen? Das schwimmt doch nicht einfach so im Wasser!« Ihre Stimme klang, als würde sie gerade Jensen persönlich für die Aufhebung sämtlicher physikalischen Gesetze verantwortlich machen.
Jensen kniff die Augen zusammen. »Ich fress ’nen Besen, wenn das mal nicht ’ne Steigleitung war.«
»Eine Steigleitung?«
Etwa eine Leiter vom Meeresgrund an die Wasseroberfläche? Wie konnte das sein?
»Die Ölbohrplattform!« schrie Pia. Dass immer noch mitten im UNESCO-Welterbe Wattenmeer Öl gefördert wurde, erhitzte viele Gemüter.
Wenn das wahr ist …, dachte Marie.
Aber Jensen schüttelte den Kopf. »Von einem Schiff. Kleiner Frachter vielleicht.«
»Ein Schiff? Hier?«, fragte Marie. Unwillkürlich sahen sich alle um, als ob der Rest dieser vermaledeiten Kollision noch irgendwo auftauchen würde. »Das dürfte doch gar nicht in dieser Gegend fahren. Das ist doch Naturschutzgebiet. Die Wasserstraße ist viel weiter weg!«
Jensen brummte zustimmend. »Richtig. Aber die Gezeiten sind eine ziemliche Kraft. Wer weiß, wie lange der Kahn schon auf dem Meeresboden gelegen hat. Vierzig, fünfzig Jahre vielleicht. Vor England, vor Dänemark? Und ganz langsam wird er nach Wilhelmswacht getragen.«
Pia hustete. »Zur Insel? Warum hat das denn niemand bemerkt?«
»Weil alle einen weiten Bogen um sie machen, min Deern. Marie hat recht. In dieser Zone darf kein Schiff fahren. Ab und zu kommt das Versorgungsboot für den Vogelwart, aber das legt im Süden an. Von Norden nähern sich nur Verrückte. Und Seehunde.«
Wieder erschütterte das dumpfe Klopfen den Schiffsrumpf. Anne beugte sich vorsichtig über die Reling, als ob sie sich überzeugen wollte, dass nicht doch noch ein halbes Wrack unter Wasser am Ende der Steigleitung hing.
»Und nun?«, fragte Anne. Offensichtlich war sie ebenso besorgt wie die Mädchen.
»Tscha.«
Marie und Pia wechselten einen halb belustigten, halb verzweifelten Blick. Das klang nicht danach, als ob Jensen nun den Notfallplan für unvorhergesehene Katastrophen aus der Tasche ziehen würde.
»Sollte man nicht …«, sagte Marie und verschluckte sich fast. »Also … Müsste das nicht jemand abmachen?«
Rumms. Wieder krachte das Teil an die Bordwand. Die Seehunde wurden wohl gerade verrückt in ihren engen Kisten. Der Transport war schon Strapaze genug, dann kam jetzt auch noch dieser Lärm dazu. Genauso gut könnten sie mit Big Ben übers Wasser schippern.
Jensen schüttelte den Kopf. »Das ist gefährlich bei dem Wellengang. Ich schau mir das an, wenn wir angekommen sind. Dem Kahn schadet es nicht. Ich mach mir eher Sorgen, ob das Ding nicht im Kanal was einreißt.«
Rumms. Marie, Pia und Anne fuhren wieder zusammen. Jensen gab ein Brummen von sich, das sicher keine von den Dreien als besonders tröstlich empfand, drehte sich um und stapfte zurück zu seinem Steuerstand. Fassungslos betrachtete Marie das verbogene Eisenstück, das sich an der Bordwand verklemmt hatte. Jensen hatte recht. Hier auf offener See konnten sie nicht viel tun. Vielleicht, wenn sie Wilhelmswacht erreicht hatten und im seichten Wasser nachsehen konnten, wie viel Schaden entstanden war.
»Kommt auch mit nach vorne«, sagte Anne.
Pia und Marie folgten ihr und setzten sich im Steuerhaus auf die Bank unter dem Aussichtsfenster. Die Seerose war ein kleines Schiff und nicht mehr das jüngste. Sie und ihr Käptn waren quasi zeitgleich in Pension gegangen, und dann hatte Jensen sich und seinen Kahn der Aufzuchtstation ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Der Steuerstand roch nach Diesel und ein wenig nach dem Tabak, den Jensen manchmal in seine Pfeife stopfte, wenn sie von einer längeren Fahrt zurückkamen und wieder ein paar Tieren das Leben gerettet hatten. Eine Weile herrschte Schweigen. Ab und zu schlug das Eisenteil wieder mit voller Wucht an den Rumpf.
Marie konnte schon mit bloßem Auge das Festland ausmachen und die Aussichtsplattform. »Du meinst, das Schiff ist gesunken?«, fragte sie.
Jensen verstand sofort, was sie meinte. Er nickte.
»Wann?«
»Keine Ahnung. Vielleicht noch im Krieg.«
»Aber das muss man doch wissen.«
»Da sind so viele Schiffe verschwunden, von denen keiner weiß, wohin. Da kräht kein Hahn danach.«
»Was wird jetzt geschehen?«, fragte Pia.
»Ich informiere die zuständigen Stellen. Wahrscheinlich wird das Wrack in ein paar Monaten verschwunden sein. Das passiert öfter. Sie tauchen auf und gehen wieder unter.«
»Wie der fliegende Holländer.« Marie schauderte.
Jensen warf ihr einen kurzen Blick zu, als ob er sich überzeugen wollte, ob mit ihr alles in Ordnung war.
»Und die Menschen? Die, die auf dem Schiff waren?«
»Hoffen wir, dass sie es geschafft haben. So weit von der Küste entfernt ist die Schüssel ja nicht untergegangen.«
Marie nickte. Ein Zusammenstoß mit einem Wrack. So was erlebte man ja auch nicht alle Tage. Jensen schien es gelassen hinzunehmen. Aber er kannte die Seerose auch besser als sie. Ihr wurde immer noch kalt bei dem Gedanken an das eiserne Stöhnen aus den Tiefen des Meeres. Es hatte so … menschlich geklungen. So, als ob etwas von ganz weit unten nach ihr gerufen hätte.
3.
Sie erreichten die Einfahrt in den Hafenkanal tatsächlich in letzter Minute. Jensen machte die Seerose vor der Brücke fest und holte dann über Funk Hilfe von den anderen Schiffen. Anne hatte bereits die Station informiert. Obwohl es nur ein paar Schritte waren, stand ein Transporter bereit, in den sie die Kisten einladen konnten.
Als Marie mit aufsteigen wollte, wehrte Anne ab. »Ihr könnt nachher zu ihnen.« Anne bestieg die Ladepritsche und hob die Hand zu einem flüchtigen Abschiedsgruß. »Lasst sie uns erst einmal untersuchen. Okay?«
Schweren Herzens blieb Marie am Kai stehen und sah dem Wagen hinterher. Was, wenn der schwächere der beiden nicht überleben würde?
»Er schafft das«, sagte Pia.
Dankbar drehte Marie sich zu ihrer Freundin um. Freundin, dachte sie. Ja, ich glaube, wir sind hier Freunde geworden.
»Klar.« Sie sah wieder zu Jensen, der sich gerade am Hinterkopf kratzte und die Bescherung an seiner Bordwand begutachtete. Neben ihm standen jetzt drei, vier andere Skipper und diskutierten, worum es sich bei dem Schrott handeln könnte. »Ich glaube, sie holen das Ding raus.«
Gemeinsam gingen die Mädchen zu der kleinen Truppe. Die Nachricht von der Ankunft des demolierten Seehundrettungsschiffes musste bereits die Runde gemacht haben. Immer mehr Leute kamen vom Dorf und liefen in ihre Richtung auf die Hafenbrücke zu, vor der die Seerose lag wie ein gestrandeter Wal.
»Da muss großes Gerät ran«, sagte ein Mann mit Seemannskäppi und den derben Gesichtszügen eines wind- und wettergegerbten Krabbenfischers. Seine Nase erinnerte Marie an eine Kartoffel.
»Nee, schleppen muss man ihn. Der kommt so nich in den Hafen.« Ein anderer, schmal und zäh mit länglichem Gesicht und gelben Zähnen, spuckte eine Portion Kautabak ins Wasser.
Jensen lief ungeduldig ein paar Schritte auf und ab. »Nichts da. Ich geh selber rein. Kröm, hol mir ein Eisen.«
Der Kautabakspucker nickte und setzte sich mit wiegenden Schritten kaiabwärts in Bewegung.
»Und du, hol mir ein Boot.«
Die Kartoffel wollte protestieren, kam aber nicht dazu.
»Ein Boot. Hörst du nicht? Das schaff ich auch alleine. Kannst ja mal den Tauchern Bescheid sagen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben!«
Jensen war wütend. Natürlich: Immer mehr Leute kamen nun dazu. Sie standen auf der Brücke, sahen zu ihnen herab und gaben mehr oder weniger geistreiche Kommentare ab. Einheimische, Touristen, irgendwann wieselte auch sein Ferienkind Gottfried heran und bekam die harsche Anweisung, sich sofort wieder Richtung Heimat in Bewegung zu setzen, was der Junge natürlich geflissentlich ignorierte. Es passierte nicht viel in Friedrichskoog. Dass die Seerose sich ausgerechnet in der Steigleitung eines gesunkenen Schiffes verheddert und die gleich noch mit in den Hafen geschleppt hatte, machte blitzschnell die Runde. Jensen hatte die Koordinaten der Kollision bereits an die Küstenwache weitergegeben.
»Die Taucher sind schon draußen!«, rief Gottfried. Dieses Mal hatte er kein Buch dabei. Manchmal ist das echte Leben spannender, dachte Marie. Ihr kam die Verletzung des Heulers in den Sinn. Das Schiff war auch eine Gefahr für die Tiere. Der Junge kletterte über das Brückengeländer und kam zu ihnen. »Ich soll ausrichten, sie kommen sofort, wenn der Einsatz beendet ist!«
»Jou jou«, knurrte Jensen.
Marie wandte sich ab. »Komm«, sagte sie zu Pia. »Hier passiert erst mal nichts.«
Sie stiegen hoch zur Brücke und dem schmalen Zufahrtsweg. Um zur Aufzuchtstation zu gelangen, mussten sie mitten durch die Schaulustigen hindurch gehen.
»Entschuldigen Sie bitte.«
Alle machten bereitwillig Platz. Nur eine nicht.
Die alte Birte kämpfte sich von der anderen Seite durch die Menschen hindurch. Einheimische machten ihr sofort Platz. Die Touristen schubste sie einfach mit ihrem knochigen Ellenbogen zur Seite. Keiner wusste, wie alt Birte war und ob sie überhaupt noch etwas sehen konnte aus ihren schmalen Augenschlitzen, die fast in den Falten ihres Gesichtes verschwanden. Sie bewegte sich erstaunlich behände auf ihren dünnen Beinen, die selbst im Hochsommer in mehrfach geflickten Strickstrumpfhosen steckten. Die Jacke war zu warm und viel zu groß für diese schmale und sehr kleine Frau, die Marie immer an einen grauen Raben erinnerte. Wenn Birte auftauchte, wurde es interessant. Niemand konnte besser auf plattdeutsch irgendwelche wüsten Beschimpfungen von sich geben als sie. Marie gab Pia einen Wink und blieb erst mal stehen.
»Jensen!«, rief die Alte mit ihrer erstaunlich kräftigen, hohen Stimme. »Hab gehört, du hast was aus dem Meer gefischt?«
Der Käptn sah hoch, suchte mit den Augen, wer ihn da nicht gerade freundlich ansprach, erblickte Birte, unterdrückte einen Fluch und brummte stattdessen unwirsch: »Geh nach Hause. Hier gibt’s nichts zu sehen. Das gilt für euch alle!«
»Ich kann es riechen, Jensen.« Birte streckte ihre kleine Nase in den Wind und tat so, als ob sie schnupperte. »Bis in mein Haus konnte ich es riechen, dass du was mitgebracht hast. Was ist es?«
Marie entging nicht, wie die Einheimischen sich ein paar schnelle, versteckte Blicke zuwarfen. Birte nahm niemand für voll. Trotzdem war sie eine Art Instanz in Friedrichskoog, wenn auch eine ziemlich durchgeknallte.
»Scheint ’ne alte Steigleitung zu sein, von ’nem alten Kahn. Nichts für alte Weiber.«
Ein paar lachten.
Aber nur so lange, bis Birte sich umdrehte und ihnen ins Gesicht blinzelte. »Ich hab’s damals gerochen und ich riech es heute. Draußen vor Wilhelmswacht, stimmt’s?« Sie wandte sich wieder zu Jensen. »Du weißt, was damals passiert ist. Eines Tages kommt sie wieder hoch. Ich hab’s immer gesagt. Sie kommt wieder hoch. Und mit ihr alle, die untergegangen sind.«
Betretenes Schweigen machte sich breit. Marie ahnte, dass es wohl mit einem Unglück zu tun haben musste, das sich vor langer Zeit vor der Küste ereignet hatte. Sie sah sich nach Pia um, doch die war verschwunden. Wahrscheinlich hatte sie sich schon auf den Weg in die Klinik der Aufzuchtstation gemacht. Birte streckte den dünnen Arm aus und deutete auf das Eisenteil am Heck der Seerose. Marie konnte es gut unter der Wasseroberfläche erkennen.
»Die Trinity«, sagte Birte. »Das ist ein Teil von ihr. Jensen, du hast die Toten geweckt.«
»Nun mach mal halblang!« Der Skipper stemmte ärgerlich die Hände in die breiten Hüften. »Erzähl keinen Schiet. Uns hätte es beinahe erwischt. So rum wird ein Schuh draus.«
Etwas in Maries Herzen machte sich bemerkbar. Sie konnte nicht sagen was, aber es kam ihr wie ein Ziehen vor oder wie ein kurzer, heftiger Nadelstich. »Die … Trinity?«, fragte sie. »Was ist mit ihr passiert?«
Langsam drehte Birte sich zu Marie um und musterte sie von oben bis unten. Dann schnupperte sie. »Dich riech ich auch. Wer bist du?«
»Lass das Mädel in Ruhe!«, rief Jensen. Noch wirkte es so, als ob er das im Scherz sagen würde.
»Ich bin Marie Vosskamp. Ich war mit auf dem Schiff, als es passiert ist.«
Die alte Birte schnupperte noch einmal. »Auf welchem Schiff?«
Verwundert deutete Marie auf die Seerose. »Auf dem da.«
»Vosskamp … Vosskamp … Ich rieche, dass mit dir irgendwas …« Birte brach ab. Sie riss die kleinen Augen auf und starrte Marie an, als ob sie sie gerade zum ersten Mal sehen würde.
Marie starrte zurück. Was war bloß mit dieser Frau los? »Sorry. Tut mir leid. Wir haben gerade zwei Heuler geholt. Ich kam noch nicht zum Duschen.«
Ein paar vereinzelte Lacher. Die Situation schien sich wieder zu entspannen.
Aber Birte schüttelte nur missbilligend den Kopf. »Du riechst nicht nach Fisch und nicht nach Seehund.«
»So?« Marie versuchte ein Grinsen, aber es gelang nicht. Die alte Frau beunruhigte sie. Genauso wie das Wort Trinity. »Wonach denn?«
»Du riechst nach dem Meeresgrund.«
»Wie bitte?«
Birte senkte die Stimme. »Nach Algen und Schlick. Nach Seesternen und Sand. Mädchen, hast du es denn nicht gespürt?«
Die Hand der alten Frau umfasste Maries Unterarm. Am liebsten hätte Marie sich losgerissen. Verunsichert sah sie sich um, ob die anderen Birtes Vergleiche auch gehört hatten und sich vielleicht darüber amüsierten. Doch es schien, als ob niemand außer ihr die fast geflüsterten Worte vernommen hatte. Keiner achtete auf sie. Alle hatten nur Augen für das Schiff mit seiner seltsamen Fracht. Jensen schien sogar durch sie hindurchzusehen. Mit einem Kopfschütteln drehte er sich wieder um zu seinem Kahn.
In den Augen der alten Frau funkelte ein belustigtes Glitzern. »Angst?«, fragte sie und kam noch näher.