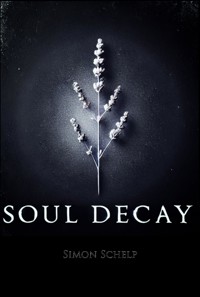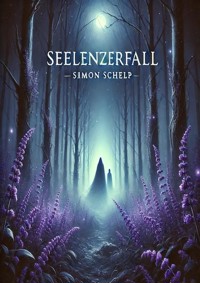
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein tragischer Unfall reißt ein Paar auseinander und wirft den Überlebenden in eine Welt der Trauer und des Schmerzes. Auf der Suche nach seiner verstorbenen Frau findet er sich in einem geheimnisvollen Wald wieder, wo die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. Ein emotional packender Roman über Liebe, Verlust und die unendliche Sehnsucht nach einem Menschen, der nicht mehr da ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Prolog Teil 1: Zweisamkeit
Teil 2: Zeit
Der Wald des Zweifels
Das Licht im Dunkeln
Der Gefallene
Gefangen im Mondlicht
Der letzte Kuss
Lavendel
Ein Ort der Stille
Erinnerungen
Ein anderes Universum
Der Fall
Zwischen den Welten
Die Stimmen des Waldes
Die Gesichter in der Dunkelheit
Der gefallene Engel
Der Kreis der Schuld
Die Schwelle
Das letzte Versprechen
Echo der Vergangenheit
Zerfall
Für Andrea.
Prolog Teil 1: Zweisamkeit
„Wie wäre es mit Sophie?“ Ihre Stimme war sanft, voller Hoffnung, als sie den Namen aussprach. Sie lag neben mir, ihren Kopf auf meinem Brustkorb, und ich spürte, wie ihr Atem leicht gegen meine Haut strich.
Ich lächelte und legte meine Hand auf ihren runden Bauch. „Wir haben doch noch Zeit,“ erwiderte ich und strich ihr sanft über den Bauch. „Es gibt keinen Grund zur Eile.“
Sie seufzte, und ich konnte die Unsicherheit in ihrem Atem hören. „Aber… was, wenn wir keine Zeit mehr haben?“ Ihre Stimme klang so verletzlich, als ob sie etwas ahnte, was wir nicht sehen konnten.
„Shhh…“ flüsterte ich sanft, während ich ihr einen Finger auf die Lippen legte, um sie zu beruhigen. „Wir haben noch genug Zeit…“
Sie schloss die Augen, und für einen Moment schien alles stillzustehen. Wir waren in unserer eigenen kleinen Welt, geschützt vor allem, was da draußen lauerte. Nur wir beide, der Herzschlag in meinem Brustkorb und das leise Schlagen des Lebens, das in ihr wuchs.
Teil 2: Zeit
Zeit – was für ein trügerisches Konzept. Sie schien uns immer als endloser Fluss, der sich ungestört durch die Landschaften des Lebens schlängelte. Unerschütterlich, ewig. Im Moment, wenn man mittendrin steckt, scheint sie dehnbar wie Gummi, zäh und biegsam, als könnte man sie einfach auseinanderziehen und all die kostbaren Augenblicke darin aufbewahren. Aber dann gibt es diese anderen Momente – die, in denen Zeit plötzlich zerfällt, sich zusammenzieht wie ein gespanntes Band, das plötzlich reißt und alles mit sich reißt. Diese Augenblicke, in denen Zeit wie ein scharfes Messer die Illusionen von Sicherheit und Beständigkeit zerschneidet.
„Wir haben noch genug Zeit,“ hatte ich oft gesagt. Es war fast ein Mantra, eine beschwichtigende Phrase, die ich immer wieder wiederholte, um die brennende Angst in mir zu besänftigen - die Vergänglichkeit des Lebens. Wie oft hatten wir uns darauf verlassen? Uns daran festgehalten, als wäre es eine unerschütterliche Wahrheit, morgen wieder aufzuwachen. Wir hatten Pläne gemacht, als könnten wir die Zeit wie ein Gut aufbewahren, als wäre sie etwas, das wir kontrollieren könnten, etwas, das nie vergehen würde. Doch die Wahrheit – diese bittere Wahrheit – ist, dass wir sie nie kontrollieren können. Sie ist nur eine flüchtige Illusion, eine Erfindung, die wir uns geschaffen haben, um uns vor der Realität zu schützen. Der Realität, dass alles, was uns lieb und teuer ist, jeden Moment weggerissen werden kann. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand.
Mein Vater war der Optimist der Familie. Er glaubte fest daran, dass das Leben uns immer noch Überraschungen bereithält. „Im Leben kommt noch einiges auf uns zu,“ pflegte er zu sagen, und jedes Mal lächelte ich über seine ungebrochene Zuversicht. Für ihn war die Zukunft immer voller Möglichkeiten, voller Abenteuer. Doch dann kam die Diagnose. Lungenkrebs. So unvorhergesehen, so erbarmungslos. Es dauerte nur wenige Wochen, bis der Krebs ihn verschlang. Es war, als hätte jemand die Zeit zusammengedrückt, und die unendliche Zukunft, die er sich ausgemalt hatte, schrumpfte auf ein paar Tage zusammen.
Ich erinnere mich oft an seine Worte. „Nur das Leben endet – die Zukunft nicht.“ Diese Worte haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, wie Brandmale, die sich nicht löschen lassen. Doch als er die Diagnose erhielt, veränderte sich alles. Es gab keine „Zukunft“ mehr. Keine Träume, keine Pläne. Nur noch das Hier und Jetzt, jede Sekunde verdichtet in mehrere kostbare Momente. Jeder Atemzug, jeder Augenblick wurde zu einem wertvollen, fast heiligen Ereignis, weil er wusste, dass ihm nur noch wenige davonblieben. „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter“, ein Spruch für ein Wandtattoo, für eine Tasse - ein Motto, welches wir uns vornehmen, jeden Tag, aber tun wir dies wirklich?Und jetzt? Nach alldem? Jetzt stehe ich hier, am Rande des Abgrunds. Unter mir die scharfe Klippe, die wie eine Klinge ins Nichts ragt. Der Wind, kalt und wild, reißt an mir, als wolle er mich in die Tiefe ziehen. Alles in mir fühlt sich schwer an, als ob die Dunkelheit in mir wie Blei wäre, die mich nach unten zieht. Die Gedanken in meinem Kopf wirbeln durcheinander, und der Gedanke, einfach zu springen, um all dem zu entkommen – den Schmerzen, den Erinnerungen, den quälenden Selbstzweifeln – erscheint so verlockend - so verdammt verlockend.
Ich schließe meine Augen, versuche, mich in diesem Moment zu verlieren. Der Wind umschmeichelt mein Gesicht, und plötzlich bringt er einen vertrauten Duft mit sich. Einen sanften, süßen Duft, der mich zurück in die Zeit katapultiert, als alles noch richtig war. Für einen kostbaren Augenblick bin ich wieder bei ihr. Bei Andrea. Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen, als ich ihre Nähe spüre. Es ist fast so, als wäre sie hier, neben mir, ihre Hand in meiner, ihr Lächeln hell und warm wie ein Sonnenstrahl.
Ein Duft – ihr Duft – umhüllt mich, und für einen kurzen Moment fühlt es sich an, als hätte die Zeit einen Riss bekommen, als wäre sie nie gegangen.
Aber sie ist nicht hier. Sie wird nie wieder hier sein.
Der Abgrund unter meinen Füßen wartet, und der Wind flüstert mir Worte zu, die wie Versprechungen klingen. In der Ferne rauscht das Meer leise, als würde es mich rufen, und tief in mir tobt ein Sturm, der nicht zur Ruhe kommen will. Was soll ich tun? Weiterleben, obwohl alles in mir starb an jenem Tag? Oder einfach springen, den Fall akzeptieren und alles hinter mir lassen? Der Abgrund sieht so verlockend aus, so endgültig.
Aber dann ist da dieser Duft – der Duft von Andrea – der mich zurückhält. Für einen Moment scheint es, als könnte ich sie spüren, als würde sie mich sanft zurückziehen, mich daran erinnern, dass da noch etwas ist, das mich an diesen Ort bindet. Eine Erinnerung, eine Hoffnung, ein Versprechen. Der Duft ist der einzige Faden, der mich hält, der mich zurückhält, obwohl alles in mir nach dem Ende schreit. Ich schließe meine Augen - Ihr Gesicht Blitz vor meinem inneren Auge auf. „Ich will doch nur bei dir sein“.
Sie lächelt mich an, ihre Hand auf ihrem Bauch…
Ich öffne meine Augen nicht - nicht jetzt. Ich möchte diesen Moment festhalten, will bei ihr bleiben, auch wenn es nur in meiner Erinnerung ist. Ich will nicht loslassen, nicht jetzt. Bisher nicht.
Und so stehe ich da, am Rande der Klippe, zwischen dem Leben und dem Tod. Die Nacht ist dunkel, die Welt um mich herum still, und doch tobt in mir ein unaufhörlicher Sturm. Das Einzige, was bleibt, ist die Stille und der Hauch einer Erinnerung an das, was ich verloren habe. Die Erinnerungen bleiben bei mir und für einen flüchtigen Moment bin ich nicht allein - Ich gehe einen Schritt vor, greife nach ihrer Hand und greife ins Leere…
Der Wald des Zweifels
Ein kurzes Beben fließt durch meinen Körper. ich liege auf einem Boden.
Es ist dunkel, so dunkel, dass ich nicht sagen kann, ob meine Augen überhaupt geöffnet sind. Der Nachthimmel über mir ist schwarz, ein endloses Nichts, das selbst die Sterne verschluckt hat. Der Boden unter mir ist feucht, kalt, und als ich meine Hände anhebe, sehe ich nur schemenhafte Konturen – kaum mehr als Schatten im Schatten. Mein Atem geht flach, und ich frage mich, ob ich überhaupt noch atme. Bin ich tot? Oder lebe ich noch? Träume ich? War die letzte Nacht ein Traum?
Die Frage brennt in meinem Kopf, während ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Nichts scheint wirklich zu sein. Der Schmerz in meiner Brust, die Leere in meinem Magen – sie sind real, und doch sind sie es auch nicht. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Traum gefangen, einem, aus dem ich nicht erwachen kann. Vielleicht bin ich schon gestorben. Vielleicht ist dies die Dunkelheit, die auf das Ende wartet.
Ich liege auf einem Boden voller Blätter. Ein kühler Wind raschelt durch die Blätter um mich herum. Das leise Rauschen klingt wie ein Flüstern, als ob die Bäume selbst zu mir sprechen würden. Ich lausche, ich konzentriere mich auf die Geräusche. Da ist etwas. Nein, nicht nur der Wind. Stimmen. Flüsternde Stimmen, die durch die Zweige schleichen und meinen Geist quälen. Worte, die ich nicht verstehe, aber die sich schwer in mein Herz legen, als trügen sie die Last all meiner Schuld.
Schuld. Ja, das ist es, was ich fühle. Wie ein Stein in meiner Brust. Ein Gefühl, das mich erstickt. Bilder blitzen in meinem Kopf auf, Erinnerungen, die ich versuche zu verdrängen, aber sie kommen zurück, unaufhaltsam, wie die Flut. Andrea. Ihr Name schießt mir durch den Kopf und durch mein Herz. Meine Frau. Meine tote Frau.
"Andrea..." flüstere ich, meine Stimme kaum mehr als ein heiseres Krächzen. Doch der Wind nimmt es auf und trägt es fort, als hätte der Name keine Bedeutung mehr. Ich spüre, wie meine Beine sich nur schwer bewegen. Als ob jede Schuld, die ich jemals auf mich geladen habe, sich jetzt in meinen Gliedern festsetzt, mich herunterzieht. Doch ich kann nicht hierbleiben, nicht liegen bleiben. Ich muss mich bewegen, muss weg von diesem Ort, von diesen Stimmen, von dieser Dunkelheit.
Mit einem Ruck versuche ich aufzustehen, aber meine Beine sind wie Blei. Jeder Muskel in meinem Körper schreit vor Schmerz, aber ich zwinge mich dazu. Mein Kopf schwindelt, als ich mich aufrichte, doch ich ignoriere es. Ich muss gehen. Ich weiß nicht wohin, aber ich kann nicht bleiben.
Dann höre ich sie. Eine Stimme, die aus der Dunkelheit dringt, die durch die Nacht schneidet wie ein Dolch durch Fleisch. Diese Stimme kenne ich. Tief in meinem Inneren erkenne ich sie, auch wenn ich es nicht will. Es ist Andrea. Ihre sanfte, vertraute Stimme, die meinen Namen flüstert, wie sie es früher oft getan hat, bevor ich eingeschlafen bin. Aber sie ist tot. Sie ist seit Monaten tot.