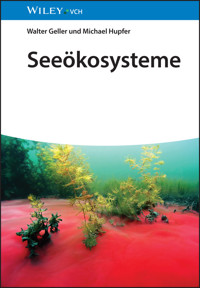
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Seen sind ein zentraler Bestandteil der mitteleuropäischen Landschaften mit einem hohen Nutzwert für Wasserversorgung, Binnenfischerei, Freizeit und Artenschutz. Sie besitzen ein komplexes Ökosystem, das von vielen unterschiedlichen Faktoren wie Temperatur, Nährstoffeintrag sowie der Art und Anzahl der im See lebenden Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere abhängt. Die Kenntnis aller dieser Faktoren und ihres Zusammenspiels ist die entscheidende Voraussetzung, um das Ökosystem See zu verstehen, zu überwachen und ggf. schützend einzugreifen, wenn dieses aus der Balance gerät.
Diese umfassende Übersicht zur Ökologie von Seen basiert auf neuesten Erkenntnissen und zahlreichen wissenschaftlichen Studien aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Zunächst werden die abiotischen Faktoren wie Temperatur, Licht und Sauerstoffverhältnisse und deren Einfluss auf die Gliederung von Seen in unterschiedliche Habitate und ökologische Nischen beschrieben. Weitere Kapitel befassen sich mit den Organismen im See, vom Phytoplankton und Zooplankton bis hin zu höheren Pflanzen und Tieren, deren Populationsbiologie, sowie den daraus entstehenden ökologischen Netzen. Der Einfluss invasiver Arten wird anhand von mehreren Beispielen dokumentiert.
Dieses Standardwerk zur Ökologie von Seen erklärt und dokumentiert anhand von umfangreichem Datenmaterial den Stand des Wissens und ist ein zuverlässiger Begleiter für Ausbildung und Beruf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Seeökosysteme
Cover
Titlebatt
1 Verbreitung, Entstehung und Typisierung von Seen
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tab. 1.1 Seen in Deutschland, Österreich und Schweiz jeweils nach Fl...
Tab. 1.2 Basisdaten der großen tektonischen und ältesten Seen (Me...
Tab. 1.3 Große, glazial entstandene und glazial überformte Seebec...
Tab. 1.4 Die wichtigsten Seen/Maare der Vulkaneifel: Oberfläche, Volumen...
Tab. 1.5 Zahl und Flächen der Kiesbaggerseen, abgeschlossener und laufen...
Kapitel 2
Tab. 2.1 Periodenlängen von Oberflächenseiches und internen Welle...
Kapitel 3
Tab. 3.1 Ursachen, Auswirkungen und wasserchemische Messgrößen an...
Kapitel 4
Tab. 4.1 Sauerstoffzehrung in der Tiefenzone von Seen.
Tab. 4.2 Photosynthese und Biomassekomposition des Phytoplanktons.
Tab. 4.3 Reihenfolge der Redox abhängigen Nutzung von Sauerstoff und von...
Kapitel 5
Tab. 5.1 Primärproduktionsrate (PPR) von Makrophyten, Epi-/Periphyton so...
Kapitel 6
Tab. 6.1 Lokale, regionale und globale Zahl der Arten (S) in Benthos und Pelagi...
Tab. 6.2 Zahl der Operationalen Taxonomischen Einheiten (OTU) bei Prokaryota in...
Tab. 6.3 Beziehungen zwischen der lokalen Artenzahl (S) der Fischgemeinschaft u...
Tab. 6.4 Lokale Taxa-Diversität des Makrozoobenthos in Seen der temperie...
Tab. 6.5 Regionale γ-Diversität der Wasserinsekten in Seen Europa...
Tab. 6.6 Beziehungen zwischen dem regionalen und lokalen Artenbestand (S) der M...
Tab. 6.7 Lokale Arten-Diversität von Epi- und Periphyton.
Kapitel 8
Tab. 8.1 Vorgeschlagene Grenzwerte der O2-Konzentrationen für Fische, be...
Tab. 8.2 Für die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als Standard vorgeschl...
Tab. 8.3 Gewichtsspezifische Größe der Kiemenflächen bei F...
Tab. 8.4 Hämoglobinkonzentration (Hb) im Körper von Daphnien und ...
Tab. 8.5 Anteile an der Primärproduktion (PPR) in Seen unterschiedlicher...
Tab. 8.6 δ13C-Signaturen röhrenbauender Chironomiden aus Litoral ...
Tab. 8.7 Anteilige Nahrungsquellen (%) des Crustaceen-Zooplanktons in kleinen S...
Kapitel 9
Tab. 9.1 In-situ und Labormessungen von Nettoraten (rin-situ) des Populationswa...
Kapitel 11
Tab. 11.1 Dichtefluktuation natürlicher Populationen. Nmax/Nmin: aus Has...
Tab. 11.2 Ontogenetisches Wachstum: Gewichtsrelationen Eier / Adulte
Tab. 11.3 Formen (Ökospezies) der Felchen und Saiblinge in Voralpenseen ...
Kapitel 14
Tab. 14.1 Kennwerte der Makrophytenvegetation des Chautauqua-Sees in New York (...
Tab. 14.2 Makrophytenvorkommen und Umweltfaktoren
Kapitel 15
Tab. 15.1 (a) Gemeinschaften des Makrozoobenthos (b) Gemeinschaften des Meiozoo...
Tab. 15.2 Funktionelle Gruppen des Zoobenthos im Esrom-See (Jonasson 1972, 1984...
Kapitel 16
Tab. 16.1 Fischarten im Bodensee-Obersee 24 Arten in der Reihenfolge ihrer H...
Kapitel 17
Tab. 17.1 Taxonomische Gruppen der eukaryotischen Protisten nach Adl et al. (20...
Tab. 17.2 Taxonomische Gruppen der Protozoen des Süßwassers nach ...
Tab. 17.3 Wasserlösliche Vitamine
Kapitel 18
Tab. 18.1 Taxonomische Gruppen des pro-/eukaryotischen Phytoplanktons nach Reyn...
Tab. 18.2 Saisonale Folge der Phytoplanktongruppen in 9 Voralpenseen in 4 bis 8...
Tab. 18.3 Anpassungsstrategien nach Reynolds (1997)
Tab. 18.4 Dominante Arten der Phytoplankton-Gesellschaften (Reynolds 1997)
Tab. 18.5 Größengrenzen der Nahrungspartikel von Nano-, Mikro- un...
Kapitel 19
Tab. 19.1 Schätzwerte des Trophie-Index nach den Rotatorien-Gemeinschaft...
Tab. 19.2 Vorkommen charakteristischer Rotatorien in Seen unterschiedlicher Tro...
Kapitel 20
Tab. 20.1 ∂13C-Signaturen für CO2, DIC, organisches Material und ...
Tab. 20.2 Charakteristika von Plankton-Ökosystemen (aus: Geller 1991)
Tab. 20.3 Anteile der Futterquellen für die 16 arktisch-borealen Coregon...
Kapitel 21
Tab. 21.1 Zahl der in Binnengewässer eingewanderten Fremdarten in Nord-A...
Tab. 21.2 Einführung von Salmoniden in Regionen der Südhemisph...
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
227
226
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
368
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
Seeökosysteme
Walter Geller und Michael Hupfer
Autoren
Prof. Dr. Walter GellerHelmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Department Seenforschung Brückstr. 3a 39114 Magdeburg Deutschland
Prof. Dr. Michael HupferInstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Müggelseedamm 301 12587 Berlin Deutschland
TitelbildUnter Verwendung einer Fotografie von Patrick Tigges, mit freundlicher Genehmigung.
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, Text and Data Mining sowie Training von KI oder ähnlichen Technologien, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN: 978-3-527-34830-5 ePDF ISBN: 978-3-527-82976-7 ePub ISBN: 978-3-527-82975-0
Umschlaggestaltung WileySatz Newgen KnowledgeWorks (P) Ltd., Chennai, India Druck und BindungGedruckt auf säurefreiem Papier.
Vorwort
In der Darstellung der Seen als Ökosysteme werden unterschiedliche Fachgebiete zusammengeführt. Diese bestehen aus den gewässerbezogenen Anteilen der Geowissenschaften, der Gewässerphysik, der Wasserchemie, der Teilbereiche der aquatischen Mikrobiologie, Botanik und Zoologie. Die Organismen werden auf den Ebenen der Autökologie der Arten, der Demökologie der Populationen und der Synökologie der Gemeinschaften betrachtet (Schwerdtfeger 1963, 1968, 1975). Viele der beobachteten Phänomene werden besser verständlich, wenn die Sichtweisen der Ökophysiologie und der Systemökologie einbezogen werden. In thematischen Kapiteln werden die genannten Fachgebiete von einfachen Grundlagen bis zu komplexen Betrachtungsebenen dargestellt. Dazu wurde ein Gesamtumfang von ca. 17.000 Publikationen gesichtet, davon 1.700 in den Text einbezogen. Die Kapitel wurden in acht Abschnitten über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren für das Handbuch der Angewandten Limnologie vorbereitet, im Jahr 2022 überarbeitet und in 21 Kapitel aufgeteilt.
Danksagungen
Herrn Dr. Matthias Koschorreck (UFZ) und Herrn Prof. Dr. Daniel Hering (Univ. Duisburg-Essen) ist für die kritische Durchsicht der Kapitel zu Lebensräumen und Stoffumsatz und zur taxonomischen Diversität, Herrn PD Dr. Bertram Boehrer für Ergänzungen zur Limnophysik zu danken, Herrn Prof. Dr. Reiner Eckmann für kritische Kommentare zur Diversität der Fische, Frau Dr. Annette Geller und Univ.-Prof. Dr. Thomas Weisse für weitere kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge.
Frau Dr. Jacqueline Rücker (BTU Cottbus), Herrn PD Dr. Bertram Boehrer (UFZ) und Dr. Jörg Lewandowski (IGB) danken wir für die Überlassung von unpublizierten Abbildungen, Herrn PD Dr. Dietmar Straile (Univ. Konstanz) für seine Originalabbildungen zu den Trophiepyramiden des Bodenseeplanktons. Herrn Prof. M. Tilzer sei Dank für die Überlassung der Meßdaten zur spektralen Lichtverteilung in den patagonischen Seen. Den Herren Patrick Tigges, Frank Fox, Christian Schlagenhaufer und Michael Beyer (UFZ) danken wir für die großzügige Bereitstellung von Fotos.
Einführung
Seen sind wassergefüllte Becken in der Landoberfläche, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Weltmeer haben. Sie sind stehende Gewässer mit Wasseraustauschzeiten von mehr als drei Tagen (praktische Definition nach Mathes et al. 2002). Sie werden nach der Größe, der Tiefe, der Entstehungsweise, dem Salzgehalt des Wassers, nach der Art der Schichtung und des Mischungsverhaltens der Wassersäule, der Produktivität und der davon abhängigen Sauerstoffverhältnisse typisiert. Die Limnologie als die Wissenschaft von den Binnengewässern wurde zunächst als Seenkunde (griech. λίμνη, See) entwickelt. Die erste zusammenhängende limnologische Abhandlung wurde von François-Alphonse Forel (1841–1912) in drei Bänden mit dem Titel „Le Léman – monographie limnologique“ zwischen 1892–1902 geschrieben. Für den Genfer See als den größten Voralpensee wurden die Geografie, Hydrografie, Geologie, Klimatologie, Hydrologie, Mechanik, Chemie, Thermik, Optik und Akustik behandelt. Auf dieser Basis entstand das erste „Handbuch der Seenkunde“ (Forel 1901). Biologische Untersuchungen wurden erst später in die Limnologie einbezogen. Die Limnologie ist heute neben der Ozeanografie Teilgebiet der aquatischen Ökologie und umfasst fachlich übergreifend die komplementären Teilgebiete Hydrografie, Limnophysik, Limnochemie und Hydrobiologie. In Deutschland wird sie als Teilgebiet der Biologie oft enger gesehen als die Ökologie der Binnengewässer mit ergänzenden, nichtbiologischen Nebengebieten.
Die Darstellung der Seeökosysteme folgt den genannten Teilgebieten. Von der geologischen Entstehung und regionalen Verbreitung der Seebecken, der Limnophysik und Hydrochemie zu den ökologischen Organisationsstufen der im See lebenden Organismengemeinschaften. Diese werden eingeführt als taxonomische Gruppen und deren Diversität, mit ihren autökologischen Nischen und die demökologische Beschreibung der Populationen. Die Gemeinschaften der Biozönosen werden beschrieben aus der Sicht der Synökologie, die das Beziehungsgefüge der im See lebenden Organismen beschreibt und analysiert. Die konkurrierenden Arten der Gilden sind gekennzeichnet durch indirekte Interaktionen und bilden die Gemeinschaften 1. Ordnung. Die Räuber-Beute-Beziehungen kennzeichnen die direkten Beziehungen in den Nahrungsketten und -netzen als Gemeinschaften 2. Ordnung. Die Auswirkungen von Neobiota-Arten auf die Struktur von Nahrungsnetzen sind zurückzuführen auf „Invasionen“ mit Hilfe des Menschen und „Kolonisierung“ durch natürliche Ausbreitung.
1Verbreitung, Entstehung und Typisierung von Seen
1.1 Zahl und Größe der Seen
Die Erfassung der Seen weltweit und auch in Deutschland ist bei Weitem nicht abgeschlossen. Aktuelle Schätzungen zum Anteil der Seen an der gesamten Landfläche übersteigen deutlich die Angaben in den meisten Lehrbüchern, die von lediglich knapp 2 % Flächenanteil ausgingen. Besonders die kleinen Gewässer sind unzureichend erfasst, sodass Seen als tiefste Punkte in der Landschaft wahrscheinlich eine bislang unterschätzte Rolle für den regionalen und globalen Stoffhaushalt spielen.
1.1.1 Seen weltweit
Ordnet man die Binnenseen nach ihrer Größe, so ergibt sich ein systematischer Zusammenhang zwischen der Anzahl und der Größe. Insgesamt gibt es viele Seen in der Klasse der kleinen und nur wenige große Seen. Im globalen Maßstab ergibt sich bei doppelt-logarithmischer Auftragung der Zahl der Seen gegen ihre Flächensumme eine Steigung von –1 (Meybeck 1995; Lehner und Döll 2004). Dies bedeutet, dass jede Größenklasse etwa die gleiche Flächensumme hat. Der Zusammenhang zwischen Größe und Zahl erlaubt eine Extrapolation in den Bereich der sehr kleinen Seen, die im üblichen kartografischen Maßstab nicht mehr darstellt werden und daher nicht vollständig erfasst sind. Downing et al. (2006) haben die weltweite Gesamtzahl und die Flächen der Seen aufgrund der bekannten Daten neu geschätzt und dabei die Vielzahl der kleinen Seen und künstlichen Wasserreservoirs besonders berücksichtigt. Danach ergibt sich eine globale Summe der Seenflächen von 4,2 Mio. km2, die sich auf 304 Mio. natürliche Seen verteilt. Davon sind 277 Mio. Seen sehr klein und haben eine Fläche zwischen 0,1 und 1 ha. Die größeren Stauseen haben eine Wasserfläche von 260 000 km2. Die Fläche der kleinen landwirtschaftlichen Wasserreservoirs wird auf >77 000 km2 geschätzt. Damit sind ungefähr 3 % der Landoberfläche mit Wasser bedeckt.
Nach Meybeck (1995) gibt es in der Größenklasse mit Seeflächen von 0,1 - 1 Mio. km2 nur einen Binnensee, das Kaspische Meer (393 898 km²), etwa 1000 große Seen im Größenbereich von 100–1000 km2, entsprechend der Größe des Bodensees, und eine einstellige Millionenzahl von Seen zwischen 1–10 ha. Der Anteil der glazialen Seen >1 ha wird geschätzt auf 3,25 Mio. mit einer Gesamtfläche von 1,25 Mio. km2. Der weltweit tiefste See ist der Baikalsee (1642 m) in Russland gefolgt vom Tanganjikasee (1470 m) in Afrika. Der Flächenanteil der Oberflächengewässer an der Gesamtfläche liegt in seenreichen Ländern über 10 %, in seenarmen Ländern unter 1 %. Nach Meybeck (1995) beträgt der Weltdurchschnitt an den nicht gletscherbedeckten Landflächen 6,8 %, auf dem skandinavischen Schild 12,2 %, in Finnland 9,4 %, in Norwegen 13,9 %, in Schweden 8,6 %, im südbaltischen Tiefland 2,2 %, auf dem kanadischen Schild 10,3 % und in Patagonien 3,0 %. In Deutschland sind 1,8 % der Gesamtfläche mit Seen bedeckt, wobei dieser Wert durch die Vielzahl neu entstehender Tagebauseen in den Braunkohlegebieten weiter steigt.
1.1.2 Seen in Deutschland
Die Seen in Deutschland sind im Auftrag des Umweltbundesamtes in einer Dokumentation zusammenfassend dargestellt worden (Nixdorf et al. 2004). Abb. 1.1 zeigt eine Übersicht zur räumlichen Verteilung natürlicher und künstlicher Seen. Der Datensatz wurde unter verschiedenen Fragenstellungen statistisch ausgewertet (Hemm et al. 2002; Hemm und Jöhnk 2004). Danach sind in Deutschland 12 000 Standgewässer erfasst, davon 969 natürliche und künstliche Seen mit einer Flächengröße >50 ha einschließlich Baggerseen, Tagebauseen, Talsperren und Speicherbecken. Hemm und Jöhnk (2004) extrapolierten die Gesamtzahl der Seen mit einer Mindestgröße von 1 ha in Deutschland auf 30 000 (Abb. 1.2) gegenüber vorherigen Schätzungen von 15 000–20 000.
Abb. 1.1Zahl der erfassten stehenden Gewässer in den deutschen Bundesländern (Hemm und Jöhnk 2004).
Abb. 1.2Dichte der Seen (Anzahl pro 1 Mio. km2) in Größenklassen der Seefläche nach Hemm und Jöhnk (2004). Die Dichte der großen Seen der Welt (G) und der natürlichen Seen in Deutschland (D) folgen ungefähr derselben Verteilungsfunktion bei Bezug auf die normierte Fläche von 1 Mio. km2. Um die Zahl der Seen in Deutschland für eine gegebene Größenklasse zu bekommen, müssen die flächennormierten Werte der Seedichten mit 0,375 multipliziert werden (Fläche Deutschland: 357 000 km2). Die Daten für kleine Seen <5 ha sind unzureichend erfasst (K). Die Braunkohlentagebauseen verschiedener Größe haben eine andere Häufigkeitsverteilung. (B): verglichen mit den Naturseen gibt es relativ weniger kleine als große Tagebauseen.
Schleswig-Holstein gehört mit seinen über 300 Seen zu den seenreichen Bundesländern Deutschlands. In der Größe >50 ha gibt es in Schleswig-Holstein etwa 65 natürliche Seen sowie an der Nordseeküste Speicherbecken und Seen, die im Zuge der Landgewinnung in der Marsch entstanden sind. Die Gesamtfläche wird auf 245 km2 geschätzt (Mathes 2008). Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wird eine Gesamtfläche der Standgewässer von 720 km2 angegeben (LUNG-MV 2001), die 3,1 % der Landesfläche darstellen. Größtes Seengebiet ist die Mecklenburgische Seenplatte, die sich weiter in das Bundesland Brandenburg zieht. Die Zahl der Standgewässer >1 ha beträgt ca. 2000, davon 1400 Kleinseen in der Größenklasse 1–10 ha und >500 künstliche Seen (Baggerseen, Fischteiche, Torfstiche, Flachspeicher). Die Zahl der kleinen, runden Sölle (wassergefüllte und trockene Toteislöcher) wird auf landesweit 60 000 geschätzt. In Berlin und Brandenburg gibt es ca. 3000 Seen >1 ha und insgesamt mehr als 10 000 Seen, mit einer Gesamtfläche von ca. 600 km2. In den glazial überformten Regionen prägen langsam fließende Flussabschnitte und durchflossene, meist flache Seen (Flussseen) die Gewässerlandschaft der Flüsse Spree/Dahme und Havel. Die Anzahl der Gewässer und der Seeflächen wird im seenreichen Bundesland Brandenburg durch die Flutung nicht mehr genutzter Tagebaue in der Lausitz stark zunehmen. Die beiden größten Seen in Niedersachsen, das Steinhuder Meer und der Dümmersee, entstanden als Thermokarstseen in Senkungstrichtern, die infolge postglazialer Erwärmung vor 12 000–14 000 Jahren aus lokalen Permafrost-Eiskörpern entstanden sind. Thermokarst-Seen sind verbreitet in den küstennahen Tieflandgebieten der arktischen Klimazone. In Hessen gibt es insgesamt 773 Seen und Talsperren mit einer Fläche von >1 ha, davon 81 >10 ha. Die Seen sind nicht natürlichen Ursprungs, sondern künstlich geschaffen. Einige sind durch Abgrabungen von Kies (Baggerseen) oder von Kohle (Tagebauseen) entstanden. Bei anderen wurden aus Gründen des Hochwasserschutzes oder der Niedrigwassererhöhung Fließgewässer aufgestaut und so Talsperren angelegt (HLUG 2007). Für das Gebiet Niederrhein in Nordrhein-Westfalen sind 21 Stillgewässer als Wasserkörper mit einer Fläche zwischen 0,5 und 1,2 km2 ausgewiesen. Von den 21 Wasserkörpern der Kategorie „Seen“ sind nur zwei natürlichen Ursprungs. Regional einzigartig sind die Eifel-Maare in Rheinland-Pfalz, die im Abschnitt über vulkanische Seen dargestellt werden. Die übrigen Seen in Rheinland-Pfalz, wenige Stauseen und die Westerwälder Seenplatte, haben nur eine geringe Ausdehnung. Alle größeren Standgewässer (>50 ha) in Sachsen sind künstlichen Ursprungs. Dazu gehören Talsperren und wasserwirtschaftliche Speicher. Durch die Flutung von Tagebauen entstehen gegenwärtig prägende Seenlandschaften in der Lausitz und im Mitteldeutschen Raum. In Sachsen-Anhalt dominieren ebenfalls die künstlichen Standgewässer vor allem mit den Talsperren im Harz und den Bergbauseen. Die größten Gewässer sind derzeit der aus mehreren Teilseen bestehende Goitzschesee (13,3 km2), der aus einem Tagebau bei Bitterfeld entstanden ist, und der aus der Saale gefüllte Geiseltalsee (18,5 km2). In der Altmark befindet sich mit dem Arendsee der größte natürlich entstandene See Sachsen-Anhalts (5,14 km2). In Thüringen gibt es keine größeren natürlichen Seen. Von den 171 Talsperren und Rückhaltebecken in Thüringen hat die Bleichlochtalsperre die größte Fläche (9,2 km2) und das größte Stauvolumen (215 Mio. m3). Die natürlichen Seen der beiden süddeutschen Länder Bayern und Baden-Württemberg sind im Wesentlichen die großen und kleinen Voralpenseen und die Karseen im Bayerischen Wald und im Schwarzwald. Daneben gibt es eine Vielzahl von Toteislöchern und -seen, vor allem in der Peripherie der großen Voralpenseen wie die Osterseen südlich des Starnberger Sees und die Buchenseen im Randbereich des Bodensees. Von der Vielzahl der postglazialen Karseen in den deutschen Mittelgebirgen sind im Schwarzwald zehn und im Bayerischen Wald drei noch nicht verlandet. Sie liegen in 700–1100 m Höhe. Einige davon sind großflächig mit schwimmenden Schwingrasen bedeckt und sind wegen der hohen Gehalte an gelösten organischen Substanzen dystrophe Seen (Steinberg et al. 2001). Die im Buntsandstein gelegenen Schwarzwaldkarseen und die drei Seen im Bayerischen Wald sind Weichwasserseen mit geringem Kalkgehalt und wurden durch die Einwirkung von saurem Regen bis zu pH-Werten von 4–5 versauert (Steinberg et al. 1988; Jüttner et al. 1997). Tab. 1.1 zeigt eine Übersicht über die jeweils größten Seen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Tab. 1.1 Seen in Deutschland, Österreich und Schweiz jeweils nach Fläche geordnet (nach BMLFUW-WIEN 2005). Seefläche, Tiefenmaximum, Seevolumen, Verweilzeit
A
0
(km2)
z
max
(m)
V
0
(Mio. m3)
𝛕
w
(Jahre)
Bodensee
473
254
48 522
4,2
Deutschland
Müritz
112,6
31,0
737
Chiemsee
79,9
73,4
2048
1,3
Schweriner See
61,5
52,4
787
10,1
Starnberger See
56,4
127,8
2999
21,0
Ammersee
46,6
81,1
1750
2,7
Plauer See
38,4
25,5
300
Kummerower See
32,6
23,3
263
1,6
Größer Plöner See
30,0
58,0
373
3,0
Steinhuder Meer
29,1
2,9
40
2,8





























