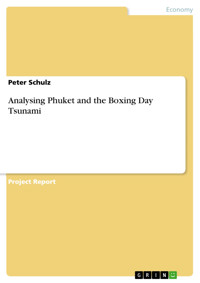6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie arbeiten im Verborgenen. In der Öffentlichkeit gelten sie wegen ihrer Maskierung als "Männer ohne Gesicht". Sie kommen dann zum Einsatz, wenn alle anderen polizeilichen Mittel am Ende sind. Wir verlassen uns darauf, dass diese Elitepolizisten für unsere Sicherheit sorgen. Eine trügerische Sicherheit, wie jetzt ein Insider berichtet. Ob Mörder, Geiselnehmer, Terrorist oder psychisch kranker Extremgewalttäter - mehr als zwanzig Jahre hat Peter Schulz als SEK-Beamter mit den schlimmsten Subjekten zu tun, die die Gesellschaft hervorbringt. Hier schildert er seine spektakulärsten Einsätze der letzten 25 Jahre.
True Crime - ein einzigartiger und packender Insiderblick in den lebensgefährlichen Alltag der Eliteeinheiten!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
ÜBER DIESES BUCH
Sie arbeiten im Verborgenen. In der Öffentlichkeit gelten sie wegen ihrer Maskierung als »Männer ohne Gesicht«. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn alle anderen polizeilichen Mittel am Ende sind. Wir verlassen uns darauf, dass diese Elitepolizisten für unsere Sicherheit sorgen. Eine trügerische Sicherheit, wie jetzt ein Insider berichtet. Ob Mörder, Geiselnehmer, Terrorist oder psychisch kranker Extremgewalttäter - mehr als zwanzig Jahre hat Peter Schulz als SEK-Beamter mit den schlimmsten Subjekten zu tun, die die Gesellschaft hervorbringt. Hier schildert er seine spektakulärsten Einsätze der letzten 25 Jahre.
True Crime – ein einzigartiger und packender Insiderblick in den lebensgefährlichen Alltag der Eliteeinheiten!
PETER SCHULZ
Dieses Buch widme ich meinem engen Freund und Kollegen Piet, der seinen bei einem tragischen Trainingsunfall erlittenen Verletzungen nach langem Siechtum schließlich erlag. Ferner widme ich es allen ehemaligen und aktiven Angehörigen von bundesdeutschen Spezialeinheiten.
VORWORT
»Defending the earth from the scum of the universe.«
M.i.B.
Wir arbeiten im Verborgenen. Für die Öffentlichkeit sind wir die »Männer ohne Gesicht«. Wir tragen Masken, um unsere Identität zu schützen, und wir kommen dann zum Einsatz, wenn der Rechtsstaat mit seinen regulären polizeilichen Mitteln am Ende ist. Nach uns kommt niemand mehr, der zur Hilfe gerufen werden könnte.
Wir haben mit den übelsten Tätern zu tun, die die Gesellschaft hervorbringt. Ob Mörder, Geiselnehmer, Terrorist oder psychisch kranker Extremgewalttäter – wir kennen sie alle. Denn weil es solche Menschen gibt, gibt es auch uns.
Ich sage »wir«, weil ich einer von ihnen war. Ich war Beamter eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei – und dies 22 Jahre lang. Mittlerweile bin ich aus dem SEK ausgeschieden, aber ich rechne mich immer noch dazu.
Ich erzähle hier meine Geschichte oder, besser gesagt, einen entscheidenden Teil davon. Anhand einiger entscheidender und spektakulärer Fälle, die ich im Laufe meiner langen Dienstzeit aktiv miterlebt habe, möchte ich einen Einblick in die Welt der »Männer hinter der Maske« ermöglichen, die sonst weitestgehend verborgen bleibt. Und ich möchte Verständnis für die großen und kleinen Probleme wecken, mit denen wir, die sogenannten Elitepolizisten, zu kämpfen haben.
Natürlich gebe ich in diesem Buch keine internen Abläufe preis, um die Sicherheit unserer Arbeit in zukünftigen Einsätzen nicht zu gefährden. Ich versichere allerdings, dass alle Einsätze, die ich in diesem Buch beschreibe, tatsächlich so stattgefunden haben und nicht das Ergebnis eines mehr oder weniger fantasiebegabten Krimiautors sind. Fehler im Detail sind nach der teilweise langen Zeit, die das beschriebene Geschehen her ist, so gut wie unvermeidlich und gehen zu meinen Lasten.
Abschließend noch ein Eingeständnis. Ich habe es stets als eine ausgesprochene Ehre empfunden, mit den Kollegen meiner Einheit zusammen Dienst zu tun und sie über lange Jahre hinweg durch viele Einsätze zu führen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Männer tatsächlich zu den Besten gehören, die in diesem gefährlichen Metier tätig sind, was ich ihnen in dieser Form während meiner aktiven Dienstzeit niemals gesagt habe.
Dies geschieht nun durch dieses Buch, denn es ist an der Zeit.
In hoc signo vinces!
Peter Schulz, im Mai 2013
WARUM EIGENTLICH SPEZIALEINHEITEN?
»Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.«
Mark Twain
Ich gehe die ausgetretenen Steinstufen zum ersten Mal nach oben. Bei dem Gebäude, in dem das Spezialeinsatzkommando der Polizei untergebracht ist, handelt es sich um einen alten Kasernenbau aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Offensichtlich hat sich an der Inneneinrichtung bis dato nicht allzu viel verändert, denke ich mir, als ich die erste Etage erreiche und vor einer verschlossenen Stahltür stehe. Als sich die Tür auf mein Klingeln hin schließlich öffnet, kann ich nicht im Entferntesten ahnen, in welche Welt ich dort eintreten werde und dass ich einmal einer der am längsten aktiv Dienst tuenden SEK-Beamten werden würde. Die Tür schließt sich automatisch, und ich bin »drin« – und das in jeder Beziehung …
In der Bundesrepublik Deutschland waren bis Anfang der 70er Jahre Spezialeinheiten sowohl bei der Polizei als auch beim Militär völlig unbekannt. Erst durch das Massaker palästinensischer Terroristen an den israelischen Sportlern während der Olympischen Spiele 1972 in München wurde schlagartig klar, dass die Sicherheitskräfte der Bedrohung durch Terroristen kaum etwas entgegenzusetzen hatten.
Aufgrund der Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus untersagt das Grundgesetz einen Einsatz des Militärs im Inland. Auch wenn also damals schon die Bundeswehr über Spezialkräfte zur Terrorbekämpfung verfügt hätte, hätten diese in die Münchener Geschehnisse gar nicht eingreifen dürfen. Tatsächlich gibt es bei der Bundeswehr erst seit 1996 eine Spezialeinheit, die jenseits der eigenen Grenzen in diesem Bereich operativ tätig werden könnte, nämlich das etwas geheimnisumwitterte Kommando Spezialkräfte (KSK).
Getreu der Binsenweisheit, dass es erst zu einem einschneidenden Ereignis kommen muss, bevor sich die Dinge grundlegend ändern, war die eigentliche Geburtshilfe für die Gründung des KSK die Unfähigkeit der Bundeswehr, gefährdete deutsche Staatsbürger aus dem im Jahre 1994 vom Völkermord erschütterten Ruanda zu evakuieren. Diese Aufgabe musste damals vom kleinen NATO-Partner Belgien und dessen schlagkräftigen Para-Commandos übernommen werden. Heute gehört das KSK sicherlich zu den besten Spezialeinheiten weltweit – und das, obwohl der Personalkörper an »aktiven« Kommandosoldaten sehr klein, der »logistische Überbau« jedoch sehr groß ist …
Bei einer entsprechenden Gefährdungslage im Inneren dürfte nicht das KSK, sondern würden polizeiliche Spezialeinheiten alarmiert werden. Die Antiterroreinheit der Bundespolizei ist die GSG 9, die 1973, durch Erlass des damaligen Innenministers Genscher, gegründet wurde. Darüber hinaus verfügt jede Landespolizei über mindestens ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und auch über Mobile Einsatzkommandos (MEK), deren Aufbau durch einen Beschluss der Innenministerkonferenz im Jahre 1974 veranlasst wurde.
Auch wenn aufgrund politischer Vorgaben die Einsatzgebiete des KSK und der SEKs säuberlich voneinander getrennt sind, so weiß ich doch aus eigener Erfahrung, dass zwischen den meisten SEK’s und dem KSK ein traditionell sehr gutes und enges Verhältnis besteht. Meine Einheit hat früher mit dem KSK Erfahrungen ausgetauscht und häufiger auch gemeinsam trainiert, allerdings immer mehr oder weniger »inoffiziell«, um bloß keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Hauptaufgabe der SEKs liegt in der Durchführung von Zugriffsmaßnahmen gegen bewaffnete, als besonders gewalttätig oder gefährlich eingestufte Personen, wohingegen die MEKs eher der Kriminalpolizei zugeordnet sind und in erster Linie mit Observationsaufgaben betraut werden. In der Öffentlichkeit treten SEK-Beamte vor allem bei spektakulären Geiselnahmen in Erscheinung; sie sind jedoch weitaus häufiger im Einsatz als weithin vermutet. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass nahezu jede Festnahme eines als bewaffnet oder sehr gewalttätig eingestuften Straftäters von SEK-Beamten vorgenommen wird.
Häufig hinzu kommen Einsätze bei eskalierenden Familienstreitigkeiten, wenn etwa Frauen und Kinder von einem gewalttätigen Vater bedroht oder attackiert werden. Wegen der zumeist unkalkulierbaren Emotionen, die in diesen Situationen vorherrschen, sind solche Einsätze besonders heikel, und tatsächlich kommen bei derartigen Dramen mehr Personen zu Schaden oder verlieren gar ihr Leben als bei spektakulären Geiselnahmen. Weitere Einsatzanlässe sind militante Demonstrationen, die Begleitung von besonders gefährlichen oder ausbruchsverdächtigen Inhaftierten bei Gefangenentransporten oder auch der Schutz von hochrangigen Staatsgästen. Zahlreiche Ereignisse also, zu denen SEKs gerufen werden können – und das bei einer vergleichsweise geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Beamten.
Dies liegt zunächst sicherlich an dem sehr rigiden Auswahlverfahren, dem sich ein potenzieller SEK-Bewerber stellen muss. Grundvoraussetzung ist natürlich, die »normale« Polizeiausbildung durchlaufen und anschließend auch bereits eine gewisse Zeit im Wach- und Wechseldienst bzw. in einer Einsatzhundertschaft absolviert zu haben. Erst dann besteht die Möglichkeit, sich für den Dienst in einem SEK zu bewerben. Wer akzeptiert wird, dem steht eine etwa ein Jahr dauernde Einführungsfortbildung bevor, in der die grundlegenden taktischen Kompetenzen vermittelt werden.
Dabei werden hohe Anforderungen an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gestellt und wird ferner die Bereitschaft verlangt, sich bis hin zur totalen Erschöpfung zu verausgaben. Die Möglichkeit, jederzeit zu versagen und den Lehrgang verlassen zu müssen, erzeugt bei den Bewerbern zusätzlichen (gewollten) Stress. Denn neben den körperlichen Fähigkeiten, die ein potenzieller SEK-Beamter mitbringen muss, ist die Stressstabilität in emotionalen Ausnahmesituationen ein ganz entscheidender Faktor, um in diesem Job bestehen zu können. Diese Fähigkeit ist allerdings nach meiner Erfahrung nur äußerst bedingt trainierbar, sondern in den meisten Fällen entweder einfach vorhanden oder eben nicht.
Einige wesentliche taktische Inhalte der SEK-Einführungsfortbildung sind:
der Umgang mit den Standardwaffen, also mit Pistole, Maschinenpistole, Sturmgewehr,die Handhabung spezieller Sonderwaffen (z.B. Schrotflinte, verschiedene Gewehre etc.),Vorgehens- und Verhaltensweisen beim Häuserkampf, Stürmen von Bussen, Bahnen, Flugzeugen etc.,Festnahme von Personen im »zivilen Einsatz«,Anhalten von Fahrzeugen und Festnahmeaktionen im laufenden Verkehr,spezielle Nahkampf- und Festnahmetechniken,souveräne Beherrschung hochmotorisierter Pkw.Im Grunde dient diese Einführungsfortbildung zwei Zielen, nämlich die Beamten mit dem nötigen Grundwissen für ihre zukünftige Tätigkeit auszustatten und gleichzeitig die Bewerber auszusortieren, die den hohen Anforderungen am Ende nicht gerecht werden. Die Ausfallquote ist daher bei diesen Lehrgängen entsprechend hoch, zumal auch dabei erlittene Verletzungen zum einen oder anderen Ausfall führen.
Nach Abschluss der Einführungsausbildung erfolgt die Versetzung in ein Stammkommando, in dem es mit der Fortbildung weitergeht und wo die Beamten sich spezialisieren können, etwa zum Präzisionsschützen, zum Rettungssanitäter oder zum Kletter-/Abseilinstructor. Tatsächlich verbringt ein SEK-Beamter während seiner Dienstzeit mindestens genauso viel Zeit mit der Aus- und Fortbildung, wie er de facto für Einsätze zur Verfügung steht.
Letztlich ist aber auch eine erfolgreich abgeschlossene Einführungsfortbildung noch keine Garantie dafür, dass ein Bewerber dauerhaft in einem SEK Verwendung findet. Nach Versetzung zu seinem Stammkommando beginnt für ihn eine halbjährige Probezeit, in der er den anderen Mitgliedern des Kommandos beweisen muss, dass er in jeder Hinsicht eine Verstärkung darstellt, menschlich wie fachlich. Wenn sich »der Neue« erkennbar in die Einheit zu integrieren versucht, wenn er also auch unangenehme Dienstverrichtungen freiwillig übernimmt, dann ist er im Team willkommen. Sehr schwer hat er es in der Regel dann, wenn er den Kollegen gegenüber, die schon etliche gefährliche Einsätze gemeistert haben, den dicken Adam markiert. Dies führt dann schon einmal sehr schnell zu einem vorzeitigen Ende der Probezeit, auch wenn so ein Bewerber die formellen und messbaren Leistungsvoraussetzungen durchaus erfüllt. Die Probezeit dient also letztlich dazu festzustellen, ob der Bewerber in das Team passt, aber umgekehrt natürlich auch, ob das Team und der Job tatsächlich das darstellen, was der Bewerber sich vorgestellt hat.
Das Wort »Team« steht in der Vokabelliste eines SEK-Beamten in der Tat sehr weit oben, denn Einzelgänger kann es in dieser Welt nicht geben. Das Handeln jedes Einzelnen, gut oder schlecht, hat immer direkte Auswirkungen auf die gesamte Gruppe. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass jeder Beamte seinem Nebenmann jederzeit sein Leben anvertraut und sich blind auf dessen Beistand verlässt. Dies beinhaltet einen Grad von Vertrauen, der weit über den Bereich der normalen »Kollegialität« hinausgeht und von Außenstehenden auch nur schwer nachvollzogen werden kann. Und das wiederum führt dazu, dass in den SEKs ein Zusammenhalt existiert, der sonst in dieser Form nicht vorkommt und häufig gerade von höheren Vorgesetzten mit Misstrauen betrachtet und als Kameraderie missgedeutet wird.
Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall, denn die Aufarbeitung von Fehlern, die im Einsatz oder auch in der Ausbildung vorkommen, erfolgt in aller Regel ebenfalls innerhalb der Gruppe und dabei völlig offen und schonungslos. Auch hier liegt der Grund auf der Hand, denn individuelle Fehler beeinträchtigen immer auch das ganze Team. Fehler sind natürlich menschlich und kommen überall vor, auch bei den Spezialeinheiten. Aber hier gehen Fehler im Einsatz mit einer exponenziell erhöhten Gefährdung für Leib und Leben von Menschen einher – sowohl der eigenen Kollegen als auch möglicher Geiseln, Unbeteiligter und letztlich auch des oder der Täter. Daher müssen etwaige Fehler im Team schonungslos aufgearbeitet werden, um die eigene Handlungskompetenz zu verbessern. Deutet die Fehleranalyse darauf hin, dass ein und derselbe Kollege wiederholt Fehler begeht, so wird er – Zusammenhalt hin oder her – sehr schnell aus dem Team ausgeschlossen. Falsch verstandene Kameraderie ist in einem SEK fehl am Platze. Niemand wird einfach so mit durchgezogen, wenn seine Leistungen oder sein Verhalten dagegensprechen.
Ich sollte noch erwähnen, dass bei der Aus- und Fortbildung der Beamten häufig über die Landes- oder gar Staatsgrenzen hinweg kooperiert wird, was der länderübergreifenden Bedrohung durch international agierende Verbrecher- und Terroristengruppen Rechnung trägt. So habe ich selbst im Zuge meiner dienstlichen Tätigkeit Kontakt zu Beamten von Partnereinheiten aus nahezu jedem Land Europas gehabt, darüber hinaus konnte ich Erfahrungen in den USA und Russland sammeln.
MEIN WEG INS SEK
»Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt werden, die ihm anvertraut sind, nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist.«
Marcus Tullius Cicero
Ich wurde 1961 in einer Stadt am Niederrhein geboren und entstamme einem gutbürgerlichen Haushalt. In jener Stadt wuchs ich auch auf und verbrachte dort meine Schulzeit. Mit etwa zwölf Jahren begann ich leistungsmäßig zu schwimmen und wurde durch sehr viel Training (ich habe mich selbst nie als besonders talentiert angesehen) über die Jahre immer besser. Ich nahm an Meisterschaften (Bezirks-, Westdeutsche, Deutsche Meisterschaften) teil und gewann sogar den einen oder anderen Titel. Diese Eigenschaft, nämlich sich Erfolge durch harte Arbeit und körperliche Anstrengung zu erarbeiten, hat sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, die spätere SEK-Ausbildung erfolgreich zu absolvieren.
Meine Schulzeit verlief quasi nebenher. Ich besuchte das Gymnasium, und die wichtigste Erkenntnis, die ich dort gewann, war die, dass ich lernte, nur genau das zu tun, was ich für ein Weiterkommen auch wirklich brauchte. Ökonomie der Kräfte sozusagen, denn das anstrengende tägliche Training ließ auch gar nichts anderes zu.
Im Oktober 1977 wurde ich das erste Mal auf die Spezialeinheiten aufmerksam, als die GSG 9 die entführte Lufthansa-Maschine »Landshut« in Mogadischu stürmte und die Passagiere aus der Hand palästinensischer Terroristen befreien konnte. Das war eine Art Erweckungserlebnis für mich, denn fortan wollte ich nur noch eines: später selber einmal einer derartigen Einheit angehören.
Folgerichtig bewarb ich mich nach meinem Abitur als Kommissaranwärter beim damaligen Bundesgrenzschutz (BGS). Ich wurde angenommen und absolvierte eine dreijährige Ausbildung an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Köln. Dieser Ausbildungsgang war erst kurz vor dem Beginn meiner Ausbildung neu installiert worden. Der BGS, als Sonderpolizei des Bundes, war vor dieser Ausbildungs- und Strukturreform eher eine paramilitärisch organisierte, kasernierte Polizeiorganisation, bei der bis zum Jahr 1979 auch militärische Dienstgrade verwendet wurden und deren Hauptaufgabe die Überwachung der innerdeutschen Grenze zur DDR war. Meine eigentliche Ausbildung fand allerdings in Lübeck statt, wo die ehemalige Offiziersschule einfach als »Fachbereich Polizei« der Fachhochschule angegliedert worden war. Was ich da lernte – also etwa das Führen von geschlossenen Einheiten in Zug-, Hundertschafts- und sogar Abteilungsstärke –, entsprach im taktischen Bereich weitestgehend einer militärischen Offiziersausbildung. Ergänzt wurde dies durch ein allerdings sehr intensives Studium des Straf- und öffentlichen Rechts.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich dort eine äußerst fundierte und wertvolle Ausbildung erhalten habe, die mich später befähigte, auch komplexe Sachverhalte und Einsatzlagen schnell zu erfassen, wichtige Informationen von unwichtigen zu trennen und, wenn es die Lage erforderte, schnell zu Entschlüssen zu kommen und diese auch mit Hilfe kurzer Anordnungen umzusetzen.
Nach meiner Ernennung zum Polizeikommissar im BGS wurde ich erst Zugführer in einer Einsatzabteilung, dann Leiter einer Dienstgruppe an einem großen deutschen Flughafen. Jedoch ließ mich während der gesamten Zeit der Gedanke nie los, einer Spezialeinheit beitreten zu wollen.
Warum?
Ein Grund war ganz schlicht meine Sportbegeisterung. Ich ging einfach davon aus – richtigerweise, wie sich herausstellte –, dass die Zugehörigkeit zu einer Spezialeinheit mit regelmäßigem Training und körperlichem Einsatz einhergeht. Dann inspirierte mich die eher diffuse Vorstellung, bei spektakulären Einsätzen aktiv mitzuwirken und überhaupt im weitesten Sinne einer »Elite« anzugehören. Entscheidender indes war die Aussicht, als SEK-Mann Menschen in höchster Not helfen zu können. Schon seit meiner Kindheit hege ich eine fast körperliche Abneigung gegen Leute, die andere wehrlose oder ihnen unterlegene Personen drangsalieren. Wie sich im Laufe meiner Dienstzeit zeigen sollte, lag ich mit dieser Einschätzung, anderen Menschen in Ausnahmesituationen beistehen zu können, nicht völlig falsch.
Der finanzielle Aspekt indes stellte überhaupt keinen Grund dar, mich für eine solche Tätigkeit zu bewerben. Entgegen der landläufigen Vermutung ist die Zugehörigkeit zu einer Spezialeinheit finanziell alles andere als lohnend. Grundsätzlich steht einem SEK-Beamten neben seinem normalen Polizistengehalt eine finanzielle Aufwandsentschädigung von 150 € (nicht steuerfrei) im Monat zu.1 Bedenkt man, dass die für eine finanzielle Absicherung bei einem (leider gar nicht so seltenen) Unfall oder gar im Todesfall notwendige Versicherung sehr teuer ist, so bleibt von dieser Aufwandsentschädigung nicht allzu viel übrig.
Im Sommer 1988 schließlich kam der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich wäre es für mich, der ich zu diesem Zeitpunkt immer noch dem BGS angehörte, folgerichtig gewesen, mich ausschließlich bei der GSG 9 zu bewerben. Aber ich hatte mich mittlerweile ein wenig mehr mit den Spezialeinheiten und deren Aufgaben befasst und wusste daher, dass die Einsatzzahlen der landespolizeilichen SEKs deutlich über denen der GSG 9 lagen. Deshalb bewarb ich mich sowohl bei der GSG 9 als auch bei einem Spezialeinsatzkommando der Polizei. Als ich deren Eignungs- und Auswahlverfahren bestand, zog ich daraufhin meine Bewerbung bei der GSG 9 zurück.
Am 1. Oktober 1988 trat ich meinen Dienst beim SEK an, durchlief im Sommer 1989 die Einführungsfortbildung und wechselte schließlich im Mai 1993 zu der SEK-Einheit, bei der ich den Großteil meiner Dienstzeit verbringen sollte und die die Grundlage für die in diesem Buch geschilderten Ereignisse darstellt.
DAS ERSTE MAL …
»Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.«
Charles de Gaulle
Das Piepen ist penetrant, und ich brauche einen Moment, um zu erfassen, was los ist. Mein Blick geht auf den Wecker neben meinem Bett, und der zeigt in roten Leuchtziffern 1:53 Uhr. Daneben liegt ein kleiner gelber Kasten, der die Quelle dieses piependen Geräuschs ist. Es ist ein sogenannter Eurosignalempfänger. Da es im Mai 1993 noch keine Handys bei der Polizei gibt, ist der Eurosignalempfänger meine permanente Verbindung zur Einsatzleitstelle der Polizei, welche bei Bedarf die Rufbereitschaftsgruppe des SEK alarmiert. Ich versehe Rufbereitschaft, das erste Mal bin ich als verantwortlicher Gruppenführer für eine solche Rufbereitschaftsgruppe des SEK eingeteilt. Meine Gruppe umfasst neben mir weitere sieben SEK-Beamte, die alle noch im Reich der Träume weilen, zumindest vermute ich das.
Als Gruppenführer wird man im Falle einer Alarmierung als Erster angerufen, um zu entscheiden, ob der Einsatz tatsächlich ein SEK-Einsatz ist oder die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.
Ich bin schlagartig wach, trotz der ungnädigen Uhrzeit, und tappe im Dunkeln zum Telefon im Wohnzimmer. Dort liegt bereits meine Einsatzmappe griffbereit drapiert. Ich wähle die Nummer des Dienstgruppenleiters der Einsatzleitstelle und melde mich zum allerersten Mal mit: »Schulz, SEK, ihr habt mich angepiepst?«
Ich ahne zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie oft ich diese Prozedur in den kommenden 18 Jahren noch durchlaufen werde. Dies ist mein erstes Mal, und ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen …
»Einsatzleitstelle, Wilhelm, entschuldige, wenn ich dich um diese Uhrzeit störe, aber ihr habt einen Einsatz.« Seine Stimme klingt tatsächlich ein wenig mitleidig, doch das dringt gar nicht zu mir durch.
»Was haben wir denn?«, frage ich betont ruhig, und obwohl ich tatsächlich ein wenig aufgeregt bin, merkt man mir das nicht an. Eine meiner offenbar angeborenen Eigenschaften, die mir bei meiner Tätigkeit beim SEK häufig von Nutzen war, ist die, je chaotischer die Situation sich darstellte, umso ruhiger zu werden und vor allem nach außen auch zu wirken.
»Die Leitstelle W. hat nach einem SEK verlangt, auf einem Campingplatz in der Nähe von S. hat sich angeblich eine Person nach einem Familienstreit in ihrem Wohnwagen verbarrikadiert und droht sich und den Wohnwagen mit einer Campinggasflasche in die Luft zu sprengen.«
»Nicht gut«, denke ich sofort. Die verheerende Wirkung von Gasexplosionen ist sogar Laien nicht unbekannt, gehen doch gelegentlich Bilder von dadurch zerstörten Häusern durch die Medien. Ich bin allerdings kein Laie und weiß daher, dass die Explosion einer durchschnittlichen Campinggasflasche in einem so kleinen Gehäuse wie einem Wohnwagen unabsehbare Folgen für alle haben kann, die sich dort aufhalten. Und wenn wir der Person habhaft werden wollen, dann müssen meine Kollegen und ich uns wohl zweifelsohne in dieses Gehäuse vorarbeiten …
Aber so weit ist es ja noch nicht.
»Ok«, sage ich knapp und versuche zu überlegen, welche Informationen mir jetzt noch von Nutzen sein können.
»Ist jemand von der Familie vor Ort?«, frage ich den Kollegen.
»Soweit ich bisher weiß, ist die Ehefrau, mit der sich der Mann gestritten hat, noch auf dem Campingplatz, aber das kläre ich noch ab.«
»Gut«, höre ich mich sagen, »ich brauche eine Verhandlungsgruppe vor Ort, und die Kollegen auf dem Campingplatz sollen die Ehefrau in jedem Fall festhalten, bis wir eingetroffen sind, ich möchte sie selbst befragen. Gib bitte weiter, dass niemand – ich betone: niemand – versuchen soll, mit der Person in dem Wohnwagen Kontakt aufzunehmen, bis wir eingetroffen sind. Das gilt auch für die Verhandlungsgruppe, falls die früher da sind als wir. Bitte alarmiere meine Einsatzgruppe, die sollen zur Dienststelle kommen, ich mach mich jetzt auch auf den Weg. Wenn ich dort bin, melde ich mich.«
»Alles klar«, antwortet der erfahrene Kollege von der Leitstelle und legt auf. In Windeseile ziehe ich meine vorbereiteten Klamotten an, schnappe meine Mappe und springe ins Auto. Da mein Wohnort etwa 90 Kilometer von meiner Dienststelle entfernt liegt, habe ich auf der nun folgenden Autofahrt genügend Gelegenheit, die Situation zu durchdenken.
Vielleicht sollte ich dem geneigten Leser an dieser Stelle kurz die Illusion rauben, dass bei einem solchen Alarm den zur Dienststelle eilenden SEK-Beamten ein Dienstfahrzeug zur Verfügung stünde. Mitnichten. Jeder SEK-Beamte musste und muss auch heute noch in so einem Fall auf sein eigenes Fahrzeug zurückgreifen, was in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Als Polizeibeamter im Einsatz ist er grundsätzlich berechtigt, Sonderrechte gem. §35 StVO in Anspruch zu nehmen. Er darf also zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen missachten oder auch über rote Ampeln fahren. Allerdings ist er mit seinem Privat-Pkw wegen fehlenden Blaulichts und Signalhorns nicht in der Lage, andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Folglich ist die Wahrnehmung seiner Sonderrechte ein sehr theoretisches Unterfangen. Stellen Sie sich doch einmal vor, dass hinter Ihnen ein wild blinkendes, hupendes Zivilfahrzeug auftaucht, das versucht, Sie um jeden Preis zu überholen. Würden Sie dabei an ein Einsatzfahrzeug der Polizei denken?
Aber die Sache wird sogar noch besser. Falls der SEK-Beamte während der Alarmierungsfahrt einen Verkehrsunfall verursacht, läuft er Gefahr, seinen Unfallschutz zu verlieren, da eine normale Kfz-Versicherung solche Schäden nicht abdeckt. Und eine pauschale Versicherung für solche Fälle hat der Dienstherr, trotz vielerlei Anmahnungen, bis heute nicht abgeschlossen!
Viel besser und aus einsatztaktischer Sicht günstiger wäre es natürlich, wenn die Rufbereitschaft versehenden SEK-Beamten mit Dienstwagen ausgerüstet wären. Sie könnten dann von zu Hause aus, ohne Umweg über die Dienststelle, direkt zum Einsatzort fahren, da ihre Ausrüstung bereits im Fahrzeug verstaut wäre, und sie könnten sich per Blaulicht und Signalhorn ungehindert Vorfahrt verschaffen. Doch eine durch und durch sinnvolle Lösung heißt in Kreisen der Polizei noch lange nicht, dass sie auch zur Anwendung kommt. In diesem Fall stehen die Bedenken des Ministeriums entgegen, dass die Nutzung von Dienst-Kfz durch SEK-Beamte für eine Fahrt nach Hause im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes möglicherweise zu »Missbrauch«, d.h. privater Nutzung führen könnte oder sich die Fahrzeuge am jeweiligen Wohnort nicht sicher unterstellen ließen. Nun ja, jedem Spitzenpolitiker steht jederzeit eine Staatskarosse zur Verfügung, auch wenn das nur in den seltensten Fällen durch eine Situation gerechtfertigt ist, in der im wahrsten Sinne über Leben und Tod entschieden werden muss. Ich will darüber weiter gar nicht richten, aber dieses Missverhältnis sagt viel darüber aus, was Politik und höhere Beamtenschaft von den Spezialeinheiten halten.
Auf unserer Dienststelle eingetroffen, rufe ich die zuständige Einsatzleitstelle in W. an, um mir neueste Informationen einzuholen. Allerdings hat sich seit meiner Alarmierung nichts Neues ergeben. Die Kollegen des Streifendienstes, die sich vor Ort auf dem Campingplatz befinden und in sicherer Entfernung den Wohnwagen unserer Zielperson beobachten, haben nichts feststellen können und sich auch an meine Anweisung gehalten, keinen Kontakt zu der Person aufzubauen.
Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, vermag ich beim besten Willen nicht einzuschätzen, wir werden es erleben, denke ich bei mir. Inzwischen sind alle Kollegen meiner Rufbereitschaftsgruppe eingetroffen und versammeln sich um mich, um zu erfahren, was genau los ist. Zwar hat Wilhelm – der Beamte der Leitstelle, der die Alarmierung durchgeführt hat – sie alle über den Grund grob informiert, aber genauere Informationen erwarten meine Kollegen jetzt von mir. Aber sonderlich mehr habe ich auch nicht zu bieten. Ich weise sie in die mir bekannte Lage ein und ergänze dann: »Wir fahren im Overall, offen, mit kolorierten Fahrzeugen, da wir uns auf dem Campingplatz wahrscheinlich über das Gelände an den Wohnwagen annähern müssen.« Übersetzt heißt dieses Fachchinesisch einfach, dass wir, im Gegensatz zu den allermeisten Fällen, in denen eine Rufbereitschaftsgruppe des SEK ausrückt, uns nicht in ziviler Kleidung und ebensolchen Fahrzeugen auf den Weg machen werden, sondern mit ebenfalls in unserem Bestand befindlichen Streifenwagen und bekleidet mit dem für Spezialeinheiten typischen graublauen Einsatzoverall, der ebenfalls bei der GSG 9 und einigen SEKs anderer Bundesländer getragen wird.
Ich teile die Fahrzeugbesatzungen ein. Neben unseren Streifenwagen führen wir noch einen in unserem Jargon als »Besteckwagen« bezeichneten zivilen Lieferwagen mit, in dem Utensilien gelagert sind, die bei einem SEK-Einsatz häufig benötigt werden. Dort finden sich neben Rammen in verschiedenen Ausführungen zum gewaltsamen Öffnen von Türen auch Brechwerkzeuge, ein ballistischer Schutzschild zum Schutz vor Beschuss aus Faustfeuerwaffen und einige Dinge mehr, die bei einem gewaltsamen Eindringen in Räumlichkeiten, unserem Hauptaufgabenbereich, von Nutzen sein können.
Ich richte meinen Blick auf einen mittelgroßen, stämmigen Kollegen und sage: »Bert, du nimmst dein Gewehr mit.«
Standardmäßig arbeiten wir in unserem Kommando im Einsatz mit einer Doppelbewaffnung. Als Hauptwaffe benutzen wir die Maschinenpistole MP 5 im Kaliber 9 mm von Heckler & Koch, mit der jeder Kollege ausgestattet ist. Als Zweitwaffe verfügen wir alle über die Pistole P226 von SIG Sauer, ebenfalls im Kaliber 9 mm.
Bert ist als Präzisionsschütze2 darüber hinaus mit einem persönlich zugewiesenen HK PSG1 ausgestattet. Bert würde uns im Bedarfsfall, so denke ich es mir zumindest, vor allem in der Annäherung an den Wohnwagen mit seinem Scharfschützengewehr absichern können.
»So, gibt’s noch was, an das wir denken müssen?« Meine Frage ist durchaus keine Phrase, die Kollegen meiner Gruppe sind durchweg erfahrene SEK-Beamte, die die Handlungsroutinen und Gepflogenheiten teilweise viel besser kennen als ich, der ich erst einen knappen Monat in diesem Kommando Dienst tue. Ich will in jedem Fall klarmachen, dass wir alle an einem Strang ziehen und jeder seine Meinung kundtun kann, auch wenn ich letztlich die Verantwortung trage.
Alle schütteln ihre Köpfe. »Ok, dann umziehen und los geht’s, ich versuche noch den Polizeiführer zu erreichen und mit ihm unsere Möglichkeiten zu besprechen …«
Sofern man den »Apparat Polizei« nicht kennt, könnte man der Meinung sein, dass beim Einsatz einer Spezialeinheit wie dem SEK die Entscheidung über Art und Umfang des Einsatzes grundsätzlich dem Führer dieser Einheit obliegt. Dies ist aber nicht der Fall. Jeder Einsatz eines SEK wird im Rahmen einer »besonderen Aufbauorganisation« abgearbeitet und von einem Beamten des höheren Dienstes als »Polizeiführer« geführt. Dieser Beamte hat in aller Regel keine besondere SEK-Ausbildung. Er ist, für eine sinnvolle Beurteilung der Möglichkeiten der eingesetzten Spezialeinheit, sehr stark von der Beratung durch den Führer dieser Einheit abhängig. Daher ist es mir wichtig, so früh wie möglich mit diesem höheren Beamten Kontakt aufzunehmen, um bei der Absprache der geplanten Vorgehensweise keine unnötige Zeit zu verlieren.
Der für diesen Einsatz verantwortliche Polizeiführer erweist sich als junger Polizeirat, der offensichtlich noch nicht lange in Amt und Würden ist. Ich schildere ihm am Telefon, dass ich die Lage derzeit noch nicht einschätzen und ihm einen Vorschlag zur Lagelösung erst machen kann, wenn ich die Situation vor Ort gesehen und mich mit dem Leiter der Verhandlungsgruppe abgestimmt habe. Immerhin rate ich ihm, die umliegenden Wohnwagen sofort räumen zu lassen, weil eine Gasexplosion, auch von einer Campinggasflasche, nicht zu unterschätzen ist. Noch während ich mit ihm telefoniere, veranlasst er das.
Als letzter Gedanke geht mir durch den Kopf, dass es vielleicht bei diesem Sachverhalt nicht schlecht wäre, auch unseren Hundeführer mitzunehmen, vielleicht ergibt sich ja eine Situation, in der ein Hund von Vorteil sein könnte. Die SEK-Hunde haben, ähnlich wie ihre zweibeinigen Kollegen, eine Zusatzausbildung durchlaufen, aufgrund derer sie mehr Fertigkeiten und Tricks beherrschen als normale Polizeihunde.
Unser Diensthundeführer Freddy versieht keine Rufbereitschaft, ich versuche mein Glück trotz der ungnädigen Uhrzeit, und tatsächlich habe ich ihn nach kurzer Zeit am Draht. Ich schildere ihm kurz den Sachverhalt und nenne ihm die Adresse des Campingplatzes, denn im Gegensatz zu uns verfügt Freddy über einen eigenen Dienstwagen mit eingebauter Transportbox für seinen Hund. Er kann sich also direkt auf den Weg machen.
Unsere Anfahrt verläuft ohne weitere Zwischenfälle, wenn man von dem Umstand absieht, dass wir uns dem Campingplatz ohne die Hilfe der heute bekannten Navigationsgeräte nähern – anhand einer Karte, auf der er nicht eingezeichnet ist … Allerdings steht an der Einfahrt zum Campingplatz bereits ein Streifenwagen der örtlichen Kollegen, sodass wir den Platz nun doch finden. Über Funk gebe ich den Kollegen die Anweisung, sich sofort einsatzbereit zu machen, während ich selbst versuche, mir zunächst ein eigenes Bild der Lage zu verschaffen.
Während also meine Kollegen sofort nach dem Abstellen der Fahrzeuge anfangen, ihre Ausrüstung anzulegen, läuft mir der Einsatzleiter der vor Ort befindlichen Streifendienstbeamten mit offenem Parka entgegen. Begleitet wird er von der Einsatzführerin der Verhandlungsgruppe, die kurz vor uns eingetroffen ist.
»Düllen, ich bin der Dienstgruppenleiter«, stellt er sich vor und schüttelt mir die Hand. »Ich bin froh, dass ihr da seid«, sagt er weiter, und an seinem Gesichtsausdruck kann ich erkennen, dass er das ernst meint, weil ihm die Situation nicht geheuer ist. Die Leiterin der Verhandlungsgruppe kenne ich, daher brauchen wir uns nicht vorzustellen. Auch wir geben uns kurz die Hand.
Ich schaue Düllen erwartungsvoll an, und er beginnt sogleich mit den Informationen, die er hat: »Gestern Abend, so etwa gegen 21 Uhr, hat Herr S. mit seiner Ehefrau einen Streit gehabt. Herr S. ist sogenannter Dauercamper hier auf dem Platz, und soweit wir wissen, lebt er tatsächlich ständig in seinem Wohnwagen. Das war auch nicht die erste Streiterei mit seiner Frau, aber gestern ist die Sache wohl eskaliert. Herr S. ist offenbar mitten im Streit aufgestanden, hat eine Campinggasflasche aus der Küchenzeile geholt, ein Feuerzeug daneben gelegt und seiner Frau gesagt, er würde die Sache jetzt ein für alle Mal beenden. Als er dann den Gasverschluss der Flasche betätigte, ist die Frau aus dem Wohnwagen geflüchtet, und er hat ihr noch hinterhergeschrien, wenn einer dem Wohnwagen zu nahe kommt, knallt es in jedem Fall.«
»Großartig«, denke ich bei mir, »meine erste Lage – und gleich ein Durchgeknallter, der sich in die Luft sprengen will …«
Ich lasse mir meine finsteren Gedanken nicht anmerken und frage: »Was war denn der Anlass für den Streit?«
»Laut Aussagen der Ehefrau waren die Anlässe nichtig«, antwortet der DGL, »zumeist ging es aber um die allgemeine Lebenssituation, vor allem, weil Herr S. schon lange arbeitslos ist und trinkt. Auch gestern Abend hat er wohl wieder einiges an Alkohol konsumiert, wie seine Frau sagt.«
»Ihr habt seitdem keinen Kontakt mehr zu Herrn S. gehabt, richtig?«, frage ich weiter.
»Wir haben den Wohnwagen weiträumig abgesperrt und uns verdeckt gehalten. Wir konnten nichts feststellen, das Licht im Wohnwagen ist aus, und es bewegt sich nichts.«
Ich wende mich an die Kollegin von der Verhandlungsgruppe: »Habt ihr den S. schon überprüfen können, ist der in der Vergangenheit bereits polizeilich aufgefallen?« Ich will vor allem wissen, ob es schon einmal einen polizeilichen Einsatz gegen Herrn S. gegeben hat, bei dem er gewalttätig geworden ist oder mit Selbstmordabsichten gedroht hat.
»Alles negativ«, antwortet mir die Kollegin von der VG, »Herr S. ist bisher überhaupt nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Wir sind noch dabei, seine Frau genauer zu befragen.« Sie weist mit ihrem Daumen auf einen von innen beleuchteten VW-Transporter, in dem ein Kollege eine augenscheinlich mitgenommene, ältere Frau befragt.
»Ok«, sage ich zunächst an den DGL gerichtet, »wir werden jetzt zuallererst deine Kräfte durch meine auswechseln. Ich werde mir zuerst die Lage des Wohnwagens anschauen und dann meine Leute verteilen. Wenn sie in Position sind, dann kannst du deine Kollegen zurückziehen.«
»Alles klar«, antwortet er, »soll ich dir den Wohnwagen zeigen? Wir haben eine Stelle, von der man alles recht gut einsehen kann.«
In den nächsten Minuten mache ich mir ein Bild von der Lage und bringe, wie angekündigt, meine Kollegen in Position. Da der Campingplatz in einem Waldgebiet liegt, bieten uns auf dem Platz befindliche Bäume guten Schutz bei der Annäherung an den Wohnwagen, und ich bin mir sicher, dass Herr S. unsere Aktivitäten auch dann, wenn er aus dem Fenster spähen sollte, nicht sehen kann. Die Platzbeleuchtung, die bereits die ganze Zeit über aktiviert war, garantiert uns andererseits eine, wenn auch diffuse Sicht auf unser Zielobjekt.
Wir nähern uns mit aller Vorsicht dem Wohnwagen so weit an, dass wir alle seine vier Seiten einsehen, allerdings nicht, und das ist der entscheidende Nachteil, in das Innere hineinschauen können. Ich habe für alle Fälle ein Zugriffsteam, bestehend aus drei meiner Kollegen, gebildet, die, falls erforderlich, gewaltsam in den Wohnwagen eindringen würden. Allerdings sind diese Kollegen wegen der latenten Explosionsgefahr so weit entfernt postiert, dass es eine Weile dauern würde, bis sie das Gefährt gestürmt hätten.
Nachdem diese kontrollierte Situation hergestellt ist – ein für mich ganz wichtiger Zwischenschritt! –, kann ich mir nun langsam Gedanken machen, wie es denn jetzt weitergehen könnte.
Inzwischen ist auch Freddy, unser Hundeführer, eingetroffen. Wir begrüßen uns kurz, und ich zeige ihm aus unserer verdeckten Beobachtungsstellung den Wohnwagen, während ich ihm die Lage schildere. Skeat, seinen Belgischen Schäferhund, hat er noch in seiner Box im Dienstwagen gelassen. In den letzten Minuten ist in mir ein, wenn auch noch vager Plan gereift, und ich möchte ihn jetzt mit Freddy besprechen.
»Wenn wir es schaffen könnten, die Tür des Wohnwagens leise aufzumachen, glaubst du, dass deine Töle den Typ da drin so schnell zu packen kriegt, dass er nicht mehr zum Feuerzeug greifen kann?«
Da ich weiß, dass Freddy, wie jeder Hundeführer, große Stücke auf seinen Diensthund hält, habe ich den bewusst als »Töle« tituliert, um ihn ein bisschen zu ärgern. Es mag vielleicht völlig unwahrscheinlich klingen, aber selbst in solchen Situationen verlieren die meisten SEK-Beamten ihre scheinbar angeborene Neigung, alles und jeden durch den Kakao zu ziehen, keineswegs. Ich bilde da keine Ausnahme, was Freddy mir überhaupt nicht krummnimmt. Er grinst sogar, bevor er dann aber ernst antwortet.
»Wenn wir die Tür leise aufbekommen, und der S. befindet sich an einer Stelle in dem Wohnwagen, wo der Hund direkt an ihn herankommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er ihn schnell genug zu packen kriegt, bevor der S. noch irgendwas ergreifen kann. Auch ein Feuerzeug nicht. Kommt der Hund allerdings nicht direkt an ihn heran, dann …« Er beendet den Satz nicht und muss es auch gar nicht, denn wir wissen beide, was das im Zweifelsfall bedeuten kann.
»Der letzte Kontakt mit S. ist bereits mehr als zwei Stunden her, seitdem hat es keine Bewegung gegeben, und seine Ehefrau hat gesagt, dass S. einiges getrunken hat«, ergänze ich unser kleines Brainstorming.
»Du meinst«, sagt Freddy daraufhin, »dass der S. vielleicht besoffen in einer Ecke liegt und seinen Rausch ausschläft?«
»Es spricht einiges dafür«, stimme ich ihm zu, »aber sicher sein können wir natürlich nicht. Meinst du, du könntest mit Skeat in dem Wohnwagen so leise sein, dass er dich vielleicht gar nicht bemerkt, wenn er schlafen sollte?«
Freddy schaut ein wenig skeptisch drein und wägt ab: »Dann muss ich ihn an der Leine halten, und wir verlieren den Vorteil der Schnelligkeit, die der Hund hat. Andererseits, wenn Skeat nicht direkt an ihn herankommen kann, ist es sicherlich besser, ich führe ihn an der Leine und lasse erst los, wenn wir sicheren Kontakt haben. Vielleicht pennt der Typ ja wirklich seinen Rausch da drin aus, und wir müssen den Hund gar nicht einsetzen. Gut, ich nehme ihn an die Leine.«
Ich weiß, dass Freddy der Fachmann ist, und seine Argumente sind für mich logisch. Da ich aber der SEK-Führer bin, muss ich die Entscheidung treffen und vor allem auch verantworten.
»Ok, Freddy«, antworte ich ihm, »ich werde jetzt noch mal mit der Kollegin von der VG sprechen. Ich neige allerdings dazu, dass wir dich und deinen Hund einsetzen, ohne S. noch anzusprechen, da viel dafür spricht, dass er in seinem Wohnwagen eingeschlafen ist. Wenn wir den jetzt aufwecken, wäre das aus meiner Sicht ziemlich kontraproduktiv.«
Freddy nickt und signalisiert Zustimmung.
Ich berate mich kurz mit der Einsatzleiterin der Verhandlungsgruppe, die sich meiner Meinung anschließt. Die Möglichkeiten der Verhandlungsgruppe sind in diesem Fall sehr begrenzt, da sie einen Kontakt nur mit einem Megafon aufnehmen könnte. Einen Telefonanschluss hat der S. in seinem Wohnwagen nicht, und Handys sind, wie bereits erwähnt, im Jahre 1993 noch nicht sehr verbreitet. Für eine Kontaktaufnahme mittels Megafon müssten die Kollegen zudem auch ziemlich nahe an den Wohnwagen heran, sodass sie sich im Gefahrenbereich einer potenziellen Gasexplosion befänden. Dieses Risiko will ich nicht eingehen, zumal niemand vorhersagen kann, wie Herr S. auf eine Kontaktaufnahme durch die Polizei reagieren würde. Irgendwie eine ziemlich vertrackte Situation …
Vom Büro des Platzwartes aus rufe ich den Polizeiführer in W. an und schildere ihm die Sachlage. Er schließt sich meiner Einschätzung an und erteilt seine Zustimmung zu unserem und Skeats Einsatz.
Wir nähern uns dem Wohnwagen von der Deichselseite her an. Dort befindet sich kein Fenster, und S. kann uns, auch wenn er auf Lauer läge, nicht sehen. Von seiner Ehefrau habe ich zuvor einen Schlüssel für die Wohnwagentür bekommen. Wenn S. diese Tür nicht verbarrikadiert hat, haben wir zumindest also die Chance, leise und vielleicht unbemerkt reinzukommen. Wir sind jetzt zu fünft: Freddy mit seinem Hund, Bert, dessen Fähigkeiten an seinem Scharfschützengewehr in diesem Einsatz nicht gebraucht werden, Gerd und Andi, ebenfalls zwei erfahrene Einsatzbeamte, und ich. Die anderen drei Kollegen meiner Rufbereitschaftsgruppe sind in Beobachtungspositionen um den Wohnwagen verteilt und sollen uns sofort Nachricht geben, wenn sie darin eine Bewegung wahrnehmen.
Wir dringen ohne Zwischenfälle bis zu unserem Ziel vor. Leider hat S. den Eingangsbereich seines Wohnwagens mit einem Vorzelt versehen, dessen Reißverschluss natürlich verschlossen ist. Den zu öffnen, könnte mit Geräuschen verbunden sein. Ich trage in der Brusttasche meiner Schutzweste ein K-Bar-Messer, welches im Gegensatz zu dem für jeden SEK-Beamten dienstlich gelieferten Puma-Messer über eine sehr scharfe Klinge verfügt, die darüber hinaus am Ende auch noch spitz zuläuft. Durch Zeichen informiere ich meine Kollegen, dass ich versuchen werde, die Zeltwand mit dem Messer leise zu durchtrennen, um uns einen Einstieg in das Vorzelt zu verschaffen. Die Daumen meiner Kollegen gehen in die Höhe, zum Zeichen, dass sie meine Absicht verstanden haben. Gerd deckt seine Surefire-Taschenlampe mit seinen behandschuhten Händen so weit ab, dass nur noch ein ganz schmaler Lichtschein hervordringt, mit dem er mir die Stelle beleuchtet, die ich mit dem Messer aufschneiden will. Würde er dies nicht tun, dann wäre das gesamte Vorzelt durch den Lichtschein der kleinen Lampe erhellt, denn die Lichtausbeute von dem kleinen Ding ist wirklich immer wieder erstaunlich. Andi, der rechts neben mir steht, hält seine Maschinenpistole schussbereit und wird mich bei meinem Versuch absichern.
Ich steche mit dem K-Bar in die Wand des Vorzeltes, und wie erhofft dringt das Messer lautlos in das Material ein. Fast ohne Widerstand und, was viel wichtiger ist, ohne das geringste Geräusch kann ich einen bodenlangen Schlitz in das Gewebe schneiden. Problemlos schlüpfen wir nacheinander in das Vorzelt. Das ist leer, keine Spur von S.
Als Letzte schlüpfen Freddy und sein Skeat hinein, und ich deute Freddy an, dass er erst einmal etwas abseits der Eingangstür stehen bleiben soll. Immer wieder wundere ich mich darüber, wie gut der Hund sich an Einsatzsituationen anpassen kann. Als ob er wüsste, dass es hier darauf ankommt, keinerlei Geräusche zu machen, verhält er sich, obwohl er mit Sicherheit aufgeregt ist, völlig ruhig und sitzt neben Freddy wie eine Statue.