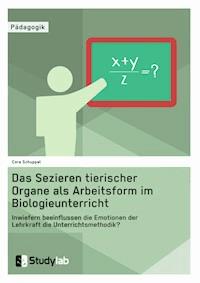
Sektion tierischer Organe im Biologieunterricht. Wie beeinflussen die Emotionen der Lehrkraft die Unterrichtsmethode? E-Book
Cora Schuppel
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Sezieren von tierischen Organen ist eine von vielen universitären Methoden, um anatomische Unterrichtseinheiten durchzuführen. Es hilft den Studenten, sich mit anatomischen und funktionalen Wissensinhalten näher auseinanderzusetzen, auch wird durch das praktische Arbeiten eine Vertiefung des Gelernten erreicht. Wieso jedoch ist das Sezieren keine gängige Unterrichtsmethode in der Schulpraxis? Die vorliegende Zulassungsarbeit zum 1. Staatsexamen geht dieser Frage vor allem im Hinblick auf die emotionale Einstellung von Biologielehrkräften im Hinblick auf die Arbeit mit realen Organpräparaten nach. Sind emotional negativ vorbelastete Lehrkräfte eher abgeneigt, in ihren Unterrichtsstunden das Sezieren als Arbeitsform durchzuführen? Eine von der Autorin durchgeführte schriftliche Umfrage an der pädagogischen Hochschule Heidelberg gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Einstellung angehender Lehrerinnen und Lehrer zur Arbeit mit Organen durch negative universitäre Erfahrungen dauerhaft geprägt wird. Es gibt natürlich noch weit mehr Arbeitsformen, die für humanbiologische Lerninhalte in Frage kommen, auch auf diese wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingegangen. Für die genauere Auseinandersetzung mit den hemmenden Einflüssen gegenüber dem Sezieren werden in dieser Arbeit fünf Hypothesen aufgestellt. Auf diese wird nach der allgemeinen Auswertung des Umfragebogens genauer eingegangen. Die Auswahl der spezifischen Emotionen Faszination und Ekel erschließt sich aus der Unterrichtspraxis, da diese beiden Gefühlszustände bei einer Sezierung am wahrscheinlichsten zu erwarten sind. Es ist eher weniger anzunehmen, dass beim Anblick von tierischen Organen bei Lehrern oder Schülern die Emotionen Wut, Trauer, Neid, Begierde oder Hass wahrzunehmen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 88
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Faszination und Ekel
2.1 Gefühle und Emotionen
2.2. Entstehung und Einflüsse
2.3. Bisherige Forschungen zu Emotionen
3. Unterrichtsmethoden
3.1 Sozial- und Arbeitsformen
3.2 Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode
4. Hypothesen
4.1 Zu erwartende Ergebnisse aufgrund der Hypothesen
4.2 Bisherige spezifische Forschungen zu Ekel
5. Umfrage
5.1 Auswahl der Fragen
5.2 Probanden
6. Durchführung
6.1 Fragebogen
6.2 Datenerhebung
7. Ergebnisse
7.1 Tabellarische Auswertung
7.2 Schriftliche Auswertung
8. Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen
8.1.Ergebnisse
8.2 Diskussion der Ergebnisse
9. Mögliche Alternativen
10. Anhang
Abbildungen der einzelnen Fragen im Vergleich Gruppe 1 zu Gruppe 2
Standardabweichung, Mittelwert und Median der einzelnen Fragen
11. Quellenangabe
Bücher in alphabetischer Reihenfolge
Artikel in alphabetischer Reihenfolge
Abbildungen
1. Einleitung
Das Sezieren zählt zu den gängigen Methoden für das Studium der Humanbiologie. Es dient den Studenten sich mit anatomischen und funktionalen Wissensinhalten näher auseinander zu setzen und durch das praktische Arbeiten eine Vertiefung des Gelernten zu erreichen. Die Humanbiologie macht wiederum, den größten Teil der Gesundheitserziehung an den Schulen aus und ist somit nicht aus der Schulpraxis weg zu denken. Um die Gesundheit und Lebensqualität von Schülern zu steigern, ist eine adäquate Gesundheitserziehung unverzichtbar. Wieso ist das Sezieren, dann keine gängige Methode in der Schulpraxis? Mit dieser Frage beschäftigt sich die folgende wissenschaftliche Hausarbeit. Dafür wurde eine schriftliche Umfrage mit Studenten der pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt. Es gilt heraus zu finden, ob die angehenden Lehrer und Lehrerinnen, durch bestimmte Einflüsse, abgeneigt sind, in ihren späteren Unterrichtsstunden das Sezieren als Arbeitsform durchzuführen. Es ist vorstellbar, dass ein Lehrer es meidet am tierischen Original zu arbeiten, wenn er selbst demgegenüber kritisch eingestellt ist. Seine Einstellung wiederum kann durch Vorerfahrungen oder selbst gewählter Ernährungsweise beeinflusst sein. Die Vorerfahrungen sind entweder negativ oder positiv emotional belastet und prägen die Einstellung der Person zur Arbeit mit Organen im Original dauerhaft.
Die hier untersuchten Einflüsse sind Vegetarismus und die spezifischen Emotionen Ekel und Faszination. Gefühle und Lernen, ist kein neues Themengebiet in der Pädagogik.
Schon Johann Heinrich Pestalozzi ging, in seinem Credo zum ganzheitlichen Lernen „ mit Kopf, Herz und Hand“ darauf ein, dass Gefühle ernst genommen und in einen Lernprozess mit einbezogen werden sollten. Auch Jean Jaque Rousseau erkannte, dass Gefühle wünschenswert für das Bildungsgeschehen sind. (vgl. Huber, 2013, S.50)
Nun soll hier, aber nicht untersucht werden, welche Gefühle wünschenswert während einer Sezierung sind und hervorgerufen werden sollen, sondern ob Gefühle einen starken Einfluss darauf haben, dass angehende Lehrer bei einer bestimmten Arbeitsform abweisend reagieren. Wie diese Gefühle und Emotionen entstehen und in wie weit sie prägend oder lernhemmend wirken können, wird in den Eingangskapiteln beschrieben. In dieser Arbeit wird nicht ausdrücklich das Empfinden von Schülern während einer Sezierung thematisiert und genauer untersucht. Dennoch müssen bei emotionsbelastenden Arbeitsweisen (wie z.B. dem Umgang mit toten Tieren), immer das Wohlergehen der Schüler von der Lehrperson berücksichtigt werden. Eine Unterrichtsstunde sollte niemals eine traumatisierende Wirkung auf die Schüler haben, auch wenn diese dann länger in Erinnerung bleibt. So ist der Lernerfolg doch fraglich, ebenso wie die anschließenden Reaktionen der Schüler und Eltern.
Es gibt natürlich noch weit mehr Arbeitsformen, die für humanbiologische Lerninhalte in Frage kommen, daher werden hier auch auf diese eingegangen und die jeweiligen Vor- und Nachteile genauer betrachtet. Für die genauere Auseinandersetzung mit den hemmenden Einflüssen gegenüber dem Sezieren, sind in dieser Arbeit fünf Hypothesen aufgestellt worden. Auf diese wird nach der allgemeinen Auswertung des Umfragebogens, genauer eingegangen.
Die Auswahl der spezifischen Emotionen Faszination und Ekel, erschließt sich aus der Unterrichtspraxis. Da diese beiden Gefühlszustände bei einer Sezierung am wahrscheinlichsten zu erwarten sind. Es ist eher weniger anzunehmen, dass die Emotionen Wut, Trauer, Neid, Begierde oder Hass, um eine Auswahl zu nennen, beim Anblick von tierischen Organen bei Lehrern oder Schülern wahrzunehmen sind. Es ist eher zu beobachten, dass Personen fasziniert, desinteressiert oder angeekelt, bei einer derartigen Arbeitsweise reagieren.
2. Faszination und Ekel
2.1 Gefühle und Emotionen
Befasst man sich mit dem Thema Ekel und Faszination, ist es sinnvoll die Unterschiede zwischen Emotionen, Affekten und Gefühlen vorab zu klären. So schreiben Dehner-Rau und Reddemann in „ Gefühle besser verstehen“ folgende Erläuterungen.
„Eine Emotion ist eine plötzliche Reaktion unseres gesamten Organismus. Sie enthält verschiedene Komponenten: Die physiologische, die kognitive und die Verhaltenskomponente. Eine Emotion hält in der Regel nur kurz an und kann relativ schnell in eine andere Emotion wechseln. Im Gegensatz zu Affekten, sind Emotionen meist milder in ihrer Intensität und deutlicher von Lernen und Erfahrung beeinflusst.“
Werden Handlungen ausgelöst, die nicht oder in geringem Maße kontrollierbar sind, spricht man von Affekten oder Affekthandlungen. Affekte sind die einschießenden, heftigen Gefühle, die körperlich deutlich erlebbar sind, mit hoher psychischer Erregung einhergehen und meistens eine soziale Reaktion hervorrufen. „Sie sind das Ergebnis unbewusster affektiver Verarbeitungsprozesse, je nach Bewertung fallen sie positiv oder negativ aus. Oft werden Affekte als diffuse Zustände erlebt, die sich in körperlichen Reaktionen zeigen können. Ein bewusster Zugang zu Auslösereizen besteht bei Affekten im Gegensatz zu den Emotionen nicht. Bei den Emotionen sind nicht nur affektive, sondern auch kognitive Verarbeitungsprozesse beteiligt, was sie dem Bewusstsein zugänglicher macht.“
Unter einem Gefühl versteht man die subjektive Wahrnehmung einer Emotion. Die Fähigkeit, Gefühle zu haben, erfordert ein Bewusstsein seiner selbst und des eigenen Verhältnisses zur Umwelt. Gefühle können also nur als solche erlebt werden, wenn das Gehirn neben einem Überlebenssystem auch die Fähigkeit zum Bewusstsein besitzt. Gefühle können wir benennen oder über Bilder ausdrücken. Wir können sie aber auch verstecken. Im Gegensatz zu Emotionen, sind Gefühle einer Person nicht immer an zu sehen. Gefühle sind spezifischer und immer auf bestimmte Gegebenheiten bezogen. Sie sind beeinflusst von unserem Denken, unserer Weltanschauung und Vorerfahrungen. Welche Gefühle wir haben, hängt von unserer eigenen Art der Auffassung ab (vgl. Dehner-Rau, Reedemann, 2011, S. 16-19).
Im Gegensatz zum Ekel, kann die Faszination zu den Gefühlen gezählt werden, da sie keinen direkten Auslöser braucht und beliebig oft abrufbar ist. Auch kann Faszination über einen längeren Zeitraum hinaus, wenn das betroffene Objekt oder der Auslöser nicht anwesend sind, hervorgerufen werden. Faszination ist immer an einen auslösenden Faktor in Form einer Handlung oder einem Objekt verbunden.
Es sollte noch erwähnt werden, dass Ekel leider oft mit Angst verwechselt wird, obwohl diese zu den Gefühlen zählt und nicht situationsabhängig ist. So kann man sich vor etwas ängstigen dass im Moment nicht da ist (wie z.B. das Monster im Schrank, oder Angst vor Schlangen zu haben), aber Ekel nur empfinden wenn der Auslöser direkten Einfluss hat.
Ekel zählt zu den Basisemotionen, deren Anzahl je nachdem welche Quellen heran gezogen werden, zwischen fünf und 15 beträgt. Wobei Ekel immer bei den elementaren Emotionen hinzu gezählt wird, ebenso wie Furcht, Zorn und Freude. Charakteristisch für eine Basisemotion ist, der weltweit für eine Emotion gleich geltende Gesichtsausdruck, der schon bei kleinen Kindern zu beobachten ist. Kennzeichnend für Basisemotionen ist auch die Tatsache, dass sie plötzlich eintreten, von kurzer Dauer sind, sich deutlich von anderen Emotionen unterscheiden und durch eine spezifische körperliche Reaktion gekennzeichnet werden.
Die körperlichen Reaktionen bei Ekel werden durch olfaktorische und gustatorische Reize ausgelöst (Geruch und Geschmack) und sind gekennzeichnet durch eine bestimmte Bewegung der Lippen und rümpfen der Nase (vgl. Rizzolatti, Sinigaglia, 2014, S. 178).
Typische Gesichtsausdrücke der Basisemotionen:
Zorn:
Abb. 2.1.1
Abb. 2.1.2
Freude:
Abb. 2.1.3
Abb. 2.1.4
Furcht:
Abb. 2.1.5
Ekel:
Abb. 2.1.6
Auf den Abbildungen sind die typischen Gesichtsausdrücke für die vier hier aufgezählten Basisemotionen zu sehen.
Bei Zorn in Abb. 2.1.1 und 2.1.2 erkennt man gut die zusammengezogenen Augenbrauen, mit der gerunzelten Stirn und den kleingekniffenen Augen. Ob der Mund offen oder klein zusammengezogen ist, kommt darauf an, ob die zornige Person ihrer Wut lauthals Ausdruck verleiht, wie auf beiden Bildern, oder stillen Zorn ausübt.
Die Freude in Abb. 2.1.3 und 2.1.4 ist gekennzeichnet durch ein breites Lächeln, mit nach oben gezogenen Mundwinkeln und großen offenen Augen. Die Augenbrauen sind hochgezogen und stehen weit auseinander.
Die Furcht zeichnet sich im Gesicht durch starre Züge ab, indem nur die Augen eine vergrößerte Form annehmen und die restlichen Gesichtszüge keinerlei Regung zeigen. In Abb. 2.1.5 ist der charakteristisch leicht geöffnete Mund zu sehen, der aber auch geschlossen sein kann. Bei kleineren Kindern steigert sich Furcht meist in Weinen und kann durch zitternde Lippen und hängende Mundwinkel beobachtet werden.
Die Abbildung 2.1.6 zeigt typische Gesichtszüge für die Emotion Ekel. So ist die Nase gerümpft, die Stirn zusammengezogen und das Kinn leicht vorgestreckt. Auf dem Bild ist die zum Gaumendach hin gewölbte Zunge nicht zu erkennen, die, wie Paul Ekman beschreibt, wohl schon in Erwartung steht, eine Substanz aus der Mundhöhle auszuwerfen um den Körper zu schützen (vgl. Gerrig, Zimbardo, Psychologie, S. 456).





























