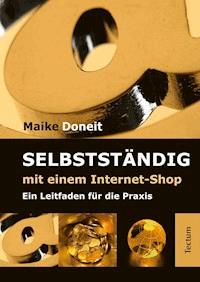
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein Internetladen ist auch ohne technische Spezialkenntnisse schnell aufgebaut. Mit einem detaillierten Angebot und entsprechender Vernetzung kann ein solches Unternehmen durchaus als Existenzgrundlage dienen. Allerdings sollten vorab alle rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge bedacht werden. Maike Doneit führt in diesem Leitfaden Gründungswillige durch den Ablauf einer Gewerbeanmeldung, klärt über verschiedene Rechtsformen auf und vermittelt Grundkenntnisse im Steuerrecht. Im Kapitel "Internetrecht" erschließen sich die Besonderheiten des Electronic Commerce, etwa zu Pflichtangaben in den AGB und darüber, was bei Preisangaben zu beachtet ist. Die Autorin gibt einen fundierten Überblick über mögliche und nötige Versicherungen und Förderungsmöglichkeiten für Jungunternehmer. Übersichtliche Info-Kästen halten weiterführende Quellen und konkrete Hinweise bereit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Maike Doneit
Selbstständig mit einem Internet-Shop. Ein Leitfaden für die Praxis
© Tectum Verlag Marburg, 2010
ISBN 978-3-8288-5606-6
Bildnachweis Cover: photocase.com © Susanne Kuscholke, neo.n, A.P.
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2196-5 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung und Ziele
2 Anmeldung eines Gewerbes
2.1 Was sind die Voraussetzungen, um ein Gewerbe anmelden zu dürfen?
2.2 Ablauf der Anmeldung beim Gewerbeamt
2.3 Rechtsform
2.3.1 Übersicht über die verschiedenen Rechtsformen
2.3.2 Einzelunternehmen
2.3.3 Gesellschaften
2.3.4 Vor- und Nachteile der Rechtsformen
2.3.5 Namensgebung
2.3.6 Die Wahl des Domainnamens
3 Relevante Behörden und Steuern
3.1 Zuständige Behörden
3.2 Steuern
3.2.1 Steuerarten
3.2.1.1 Die Umsatzsteuer
3.2.1.2 EXKURS: Rechnungsstellung
3.2.1.3 Die Gewerbeertragssteuer
3.2.1.4 Die Körperschaftssteuer
3.2.1.5 Die Einkommenssteuer
3.2.1.6 Die Lohnsteuer
3.2.1.7 EXKURS: Lohnkosten
3.2.2 Steuertermine
3.2.3 Steuertipps
3.2.4 Steuererklärung
4 Internetrecht
4.1 Zivilrechtliche Grundlagen
4.1.1 Rechts- und Geschäftsfähigkeit
4.1.2 Vertragsschlieβung
4.1.3 Kaufmann
4.2 Besonderheiten im Electronic Commerce
4.2.1 Arten des Electronic Commerce
4.2.2 Exkurs: Welcher Online-Shop ist der Richtige?
4.2.3 Die elektronische Willenserklärung
4.2.4 Der Widerruf elektronischer Willenserklärungen
4.2.5 Vertragsabschluss im Internet
4.2.5.1 Vergleich: realer und virtueller Vertragsabschluss
4.2.5.2 Preisangaben im Internet
4.2.5.3 Bezahlungsmöglichkeiten
4.2.6 Anwendbares Recht im grenzüberschreitenden E-Commerce
4.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen im Internet
4.3.1 Informationspflichten im Fernabsatzrecht
4.3.1.1 Vorvertragliche Informationspflichten
4.3.1.2 Nachvertragliche Informationspflichten
4.3.1.3 Typische Rechtsverstöβe von Online-Shops
4.3.2 Muster von AGB bei B2C Geschäften
4.3.3 Muster für Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
4.3.4 Muster von AGB bei B2B Geschäften
5 Versicherungen für den Unternehmer
5.1 Notwendige private Versicherungen
5.1.1 Krankenversicherung
5.1.2 Krankentagegeld
5.1.3 Berufsunfähigkeitsversicherung
5.1.4 Unfallversicherung
5.1.5 Private Haftpflichtversicherung
5.1.6 Private Altersvorsorge
5.2 Mögliche private Versicherungen
5.2.1 Hausratversicherung
5.2.2 Glasversicherung
5.2.3 Verkehrsrechtsschutz
5.3 Notwendige betriebliche Versicherungen
5.3.1 Betriebshaftpflichtversicherung
5.3.2 Betriebsinhaltsversicherung
5.3.3 Betriebsunterbrechungsversicherung
5.3.4 Firmenrechtsschutz
5.4 Mögliche betriebliche Versicherungen
5.4.1 Forderungsausfallversicherung
5.4.2 Produkthaftpflichtversicherung
5.4.3 Umwelthaftpflichtversicherung
5.4.4 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
5.5 Kosten für Versicherungen
6 Förderungen für junge Akademiker
6.1 Private Darlehen
6.2 Öffentlich geförderte Darlehen und Förderungen
6.2.1 StartGeld-Darlehen
6.2.2 ERP-Kapital für Gründungskredite
6.2.3 Unternehmerkredit
6.2.4 Förderung von Beteiligung
6.2.5 Regionale Fördermöglichkeiten
6.2.6 EXIST Existenzgründungen aus der Wissenschaft
6.2.7 Weiterführende Internetquellen
7 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang A
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.
Abs
Absatz
AG
Aktien Gesellschaft
Ag
Arbeitgeber
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
An
Arbeitnehmer
B2B
Business-to-business
B2C
Business-to-consumer
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BMWI
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
E-Commerce
Electronic Commerce
EGBGB
Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch
ELSTER
Elektronische Steuererklärung
ESt
Einkommensteuer
ERP
European Recovery Program
EXIST
Existenzgründungen aus der Wissenschaft
Gbr
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB
Handelsgesetzbuch
I.S.d.
Im Sinne der/des
KG
Kommanditgesellschaft
LSt
Lohnsteuer
Ltd.
Limited
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts. und zur Bekämpfung von Missbräuchen
OHG
Offene Handelsgesellschaft
PAngV
Preisangabeverordnung
PartG
Partnergesellschaft
1 Einleitung und Ziele
„Unsere Wünsche sind die Vorboten
der Fähigkeiten, die in uns liegen.“1
Die Selbstständigkeit ist eine Herausforderung, die den Gründer zu groβen Leistungen antreiben kann. Die eigenen Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen und die Firma nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten, bedeutet für viele Menschen berufliche und persönliche Entfaltung. Aufgrund der Schwierigkeiten die sich beim Start in die Selbstständigkeit mit einem Internetshop ergaben, entstand die Idee eines Leitfadens für Gründer.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundlagen der Existenzgründung und die speziellen Anforderungen eines Unternehmensstarts im World Wide Web zusammenzufassen. Eine gewisse Basis an Grundinformationen benötigt jeder Gründer, um sich überhaupt selbständig machen zu können. Diese Informationen sollen hier gegliedert und gebündelt dargestellt werden, um Absolventen der Wirtschaftswissenschaften den Weg zu einem eigenen und erfolgreichen Internetshop zu ebnen.
Der Kerngedanke dabei ist, den Studierenden bzw. Absolventen die ersten Vorbereitungen zur Firmengründung zu erleichtern. Der Leser findet in dieser Diplomarbeit Informationen zur Gründung eines Betriebes von der Gewerbeanmeldung bis zur Steuererklärung. Dieses Wissen wird durch spezielle Ausführungen zum Vertriebsrecht im Internet erweitert, das auf der Basis von zuvor behandelten zivilrechtlichen Grundlagen aufbaut. An vielen Stellen findet der Leser „TIPP“-Kästchen in denen teilweise Ratschläge von Experten, Ratschläge aus eigener Erfahrung oder aber Quellen, die das Thema weiter ausleuchten, Platz gefunden haben.
Die gröβte Herausforderung der Neu-Unternehmer stellt meist die Finanzierung da. Umfragen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zeigen, dass für 52 Prozent der Gründer die Kreditfinanzierung schwierig oder nicht möglich war.2 Gerade auch bei Studenten und jungen Akademikern ist die Finanzierungsfrage eine der gröβten zu bewältigenden Hürden.
Durch einen Internet-Shop wird weniger Startkapital benötigt als beim Kauf oder Anmieten echter Ladenfläche. Ebenfalls ist die Standortwahl flexibler und das Büro kann in preiswerten Räumen positioniert werden – Voraussetzung ist lediglich ein Internetanschluss. Dadurch ergibt sich für die jungen Akademiker die Chance, auch mit kleinem Startkapital einen Laden zu gründen und als vollwertiger Händler oder Hersteller tätig zu werden.
Oft vernachlässigen angehende Unternehmer das Thema Versicherung. Allerdings ist es sinnvoll sich gegen eventuelle Risiken abzusichern und die Kosten der benötigten Versicherungen fest in die Einschätzung des Gewinns mit einzubeziehen. Auch hier wird die Diplomarbeit dem Gründer einen Überblick über nötige und mögliche Versicherungen bieten.
Weiterhin sollen in diesem Leitfaden dem Gründer Adressen und Anlaufstellen für Beratung bzw. Finanzförderungen an die Hand gegeben werden. Viele Beratungsstellen bieten speziell für Studenten kostenlose Workshops und Beratungen an. Die kostenlosen Angebote können dem Gründer helfen in die Idee einer eigenen Firma hinein zu wachsen. Weiterhin fördern sie die persönliche Weiterbildung und damit auch die Entwicklung der Firma.
1 Johann Wolfgang von Goethe.
2 Vgl. Weber, B., Von der Geschäftsidee auf den Markt, München 2007, S.
2 Anmeldung eines Gewerbes
Als erster Schritt zur Selbständigkeit ist es notwendig ein Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt/Bürgermeisteramt anzumelden. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, um als Unternehmer aktiv werden zu können, egal welche Rechtsform später gewählt werden soll.
Das Einkommenssteuergesetz unterscheidet im Bereich der Gewinneinkunftsarten zwischen einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, einer freiberuflichen Tätigkeit und einem Gewerbebetrieb. Sollen die künftigen Gewinne also nicht aus der Land- oder Forstwirtschaft3 oder aus Freiberuflichen Tätigkeiten4 (z. B. selbstständig arbeitender Anwalt, Steuerberater, Arzt, Künstler, Journalist oder Architekt) stammen, muss zwingend ein Gewerbe angemeldet werden.
Abbildung 1 definiert die Begriffe Gewerbe und freie Berufe, um den Unterschied zu zeigen.
2.1 Was sind die Voraussetzungen, um ein Gewerbe anmelden zu dürfen?
In der Regel gilt in Deutschland die Gewerbefreiheit, das bedeutet, dass jeder einen Gewerbeschein beantragen darf. Eine gewerbliche Tätigkeit ist in vielen Bereichen wie etwa Handel, Herstellung, Be- und Verarbeitung, Dienstleistung oder Vermittlung denkbar. Als gewerblich gilt die selbständige Tätigkeit als Einzelhändler oder Groβhändler, was auf den Internethandel meist zutrifft. Die Anmeldung eines Betriebes ist nach § 14 der Gewerbeordnung verpflichtend.
Voraussetzung zum Anmelden eines Betriebs ist die Rechts- und Geschäftsfähigkeit der natürlichen Person, die das Gewerbe anmeldet. Rechtsfähigkeit bedeutet, dass die jeweilige Person, vom Gesetz vorgegebene Rechte und Pflichten tragen kann. Die Rechtsfähigkeit beginnt für jeden Menschen mit der vollendeten Geburt und endet mit dem Tod.5 Es ist grundsätzlich jede geschäftsfähige Person6, die in Deutschland wohnt, berechtigt ein Gewerbe anzumelden.
Jedoch gibt es bestimmte Ausnahmen im Bezug auf das gewählte Gewerbe, wie z. B. die Maklertätigkeit. Die einschränkende Regelung soll den Schutz von Verbrauchern gewährleisten. Diese Gewerbe nennen sich erlaubnispflichtige Gewerbe. Es müssen daher bestimmte Nachweise erbracht werden, um in einer bestimmten Branche z. B. dem Maklerwesen tätig werden zu dürfen.
Im Wesentlichen lassen sich die Voraussetzungen für eine erlaubnispflichtige Gewerbeanmeldung in drei Punkten zusammenfassen:
- Persönliche Voraussetzungen (polizeiliches Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes)
- Sachliche Voraussetzungen (Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, erforderlicher Zustand der Gewerberäume)
- Fachliche Voraussetzungen (Ausbildung, Teilnahme an Weiterbildungen, Studium)7
TIPP: Nähere Informationen zu diesem Thema können bei der Industrieund Handelskammer eingeholt werden. Im Internet unter www.ihk.de zu finden.
2.2 Ablauf der Anmeldung beim Gewerbeamt
Bevor der angehende Selbstständige sein Gewerbe bei der Gemeinde anzeigt, muss entschieden werden, wie die angemeldete Tätigkeit betitelt wird und wo die Betriebsstätte ihren Sitz haben soll.
Und nicht nur das sollte vor dem Gang zum Gewerbeamt geklärt sein: Um einen Einblick zu gewinnen, welche Informationen vor der Gewerbeanmeldung vorliegen sollten, ist in der Abbildung 2 eine Gewerbeanmeldung dargestellt. Diese sollte jedoch nur als Muster behandelt werden. Der Gründer kann sich daran orientieren, welche Informationen man bei der Gründung angeben muss und welche Fragen zum geplanten Gewerbe beantwortet werden müssen.
Abbildung 2: Formular der Gewerbeanmeldung
Wie in Abbildung 2 zu erkennen, muss man vor der Anmeldung in der Gemeinde einige Entscheidungen im Vornherein treffen. Es sollte klar sein, ob für das angestrebte Gewerbe eine besondere Erlaubnis benötigt wird, welche Rechtsform für das Gewerbe gewählt werden soll und ob das Unternehmen alleine oder mit anderen Personen gemeinsam geführt werden soll. Diese Grundinformationen sollten vor dem Gang zur Gemeinde/Stadt abgeklärt sein.
Es ist notwenig sich persönlich zum Gewerbeamt der zuständigen Gemeinde/Stadt zu begeben, in der Regel da wo der Betriebssitz seinen Standort haben soll. Dort erhält man gegen Vorlage des Personalausweises und einer Gebühr von etwa 10-50 Euro den Gewerbeschein. Während dieser Anmeldung werden die Daten der Gewerbeanmeldung an das zuständige Finanzamt übermittelt. Weiterhin werden die Informationen auch, je nach Bedarf, an Industrie- und Handwerkskammer und an das Gewerbeaufsichtsamt weitergegeben. Das Finanzamt wird dann in den folgenden Wochen per Post auf den Gewerbetreibenden zukommen und genauere Angaben einfordern.8
Kurz aber informativ wird auf der Seite www.gewerbeanmeldungen.de dieses Thema weiter beleuchtet.
TIPP: Das Formular zur Gewerbeanmeldung bieten viele Gemeinden zum Herunterladen im Internet an, so kann man das Formular schon zu Hause bearbeiten und sich in Ruhe Gedanken über die zu fällenden Entscheidungen machen.
TIPP: Alle Quittungen der Ämter von Beginn an sammeln, diese können später als Kosten von der Steuer abgesetzt werden.
Die Anmeldung ist der erste Schritt in die Selbständigkeit. Nun kann man auf dem Markt als Händler bzw. Gewerbetreibender auftreten.
2.3 Rechtsform
2.3.1 Übersicht über die verschiedenen Rechtsformen
Die Entscheidung für eine Rechtsform sollte überlegt getroffen werden, da damit die Entwicklung des Unternehmens maβgeblich geprägt wird. Die Wahl der Rechtsform hat für das Unternehmen weitreichende steuerliche, finanzielle und rechtliche Auswirkungen. Die Rechtsformen gliedern sich in Personalunternehmen, Kapitalgesellschaften, Mischformen aus Personal- und Kapitalunternehmen und Sonderformen (z. B. Vereine, Stiftungen u. ä.).
Der Gründungsinteressierte sollte sich bei der Entscheidung, welche Rechtsform am Besten zu dem geplanten Unternehmen passt, von einem Steuerbrater unterstützen lassen und somit einen sinnvollen Grundstein für das Unternehmen legen.
Jedoch ist es wichtig mit einem Grundwissen über die Rechtsformen in die Beratung zu gehen, um diese optimal ausnutzen zu können. Deshalb werden im Anschluss die geläufigsten Rechtsformen beschrieben. Abbildung 3 zeigt eine Einteilung der in dieser Diplomarbeit beschriebenen Rechtsformen (auf Verein, Stiftung und Aktiengesellschaft wurden nicht genauer eingegangen, da sie für den Neugründer als Rechtsform im Normalfall nicht in Frage kommen).
2.3.2 Einzelunternehmen
Ein Einzelunternehmen besteht dann, wenn der Unternehmer ein Unternehmen allein d.h. ohne Gesellschafter betreibt. Die Rechtsform des Einzelunternehmens ist die häufigste Rechtsform in Deutschland. Das kann an den vielen Vorteilen der Einzelfirma für Gründer liegen:
— Es wird kein Mindestkapital benötigt
— Die erwirtschafteten Gewinne stehen nur dem Unternehmer zu
— Groβer Gestaltungsspielraum
— Es gibt keine Gründungsvorschriften einzuhalten
— Geringe Gründungskosten fallen an, da notarielle Vorschriften entfallen
— Die Einzelfirma kann flexibel auf Veränderungen reagieren
Auf der anderen Seite ist der Unternehmer für den Betrieb voll verantwortlich. Das bedeutet, er haftet unmittelbar, unbeschränkt und mit seinem gesamten privaten und betrieblichen Vermögen für alle Verbindlichkeiten seiner Unternehmungen. Dies kann einen groβen Verantwortungsdruck für die Einzelperson bedeuteten, und die Bereitschaft diesen Druck allein zu tragen, sollte vorhanden sein. Auch die Kapitalanlagen der Firma stammen aus dem Vermögen des Gründers und können auch nur durch das private Kapital des Gründers aufgestockt werden.9
Einzelunternehmer lassen sich weiterhin in den Kaufmann und den Nichtkaufmann unterteilen. „Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.“10
Prinzipiell wird der Unternehmer je nach Umfang seines Unternehmens zum Kaufmann oder Nichtkaufmann eingeteilt. Von Bedeutung sind vor allem Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, Umsatz, Anzahl der Beschäftigten, Betriebsvermögen, Kredithöhe und Standortanzahl. Der Kaufmann ist im Sinne des Handelsgesetzbuches zu einer ordnungsgemäβen Buchführung und Bilanzierung verpflichtet.
Unter die Kategorie Nichtkaufmann fallen Freiberufler, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe (können durch freiwilligen Handelsregistereintrag auch zu Kaufleuten werden) und Kleingewerbetreibende. Für den Nichtkaufmann ist keine vollkaufmännische Betriebsführung nötig und er hat somit weniger Buchführungsaufwand zu betreiben.
Hat der Gründer vor als Kleinunternehmer zu beginnen, muss er dies in die vom Finanzamt zugesendeten Formulare eintragen. Dies bedeutet, dass die steuerpflichtigen Einnahmen, einschlieβlich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im Betriebseröffnungsjahr, insgesamt 17.500 Euro nicht übersteigen dürfen.11
Kleingewerbetreibende haben den Vorteil, dass sie nur zu einer einfachen Gewinnermittlungsmethode, der Einnahme-Überschussrechnung, verpflichtet sind. Der betriebliche Gewinn wird dann für die Steuererklärung als Differenz der Betriebseinnahmen und -ausgaben ausgewiesen. Dabei gilt die vereinnahmte Umsatzsteuer als Betriebseinnahme und die an Lieferanten gezahlte Vorsteuer als Betriebsausgabe. Diese vereinfachte Abrechnung sorgt für einen leichten Einstieg in die Betriebsbuchführung.12
Genaueres zum Thema Buchführung ist im Kapitel 3.2.4 Steuererklärung zu finden.
2.3.3 Gesellschaften





























