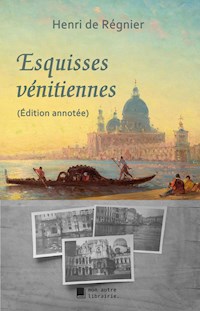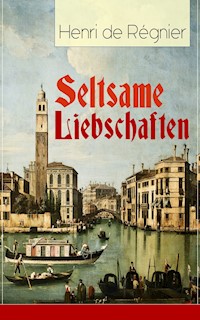Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henri de Régnier's 'Seltsame Liebschaften' ist ein faszinierendes Werk, das sich mit den komplexen Beziehungen und Leidenschaften zwischen den Charakteren auseinandersetzt. Der Roman zeichnet sich durch seinen poetischen und melodischen Schreibstil aus, der die Leser in eine Welt voller Intrigen und Geheimnisse entführt. Régnier schafft es geschickt, die menschlichen Emotionen und Beziehungen in einer erhabenen Sprache darzustellen, die den Leser fesselt und zum Nachdenken anregt. Mit subtilen Nuancen und feinsinnigen Beschreibungen entfaltet dieses Buch eine reiche und vielschichtige Erzählung, die die Leser in den Bann zieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seltsame Liebschaften
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Henri de Régnier, ein Schüler Mallarmés, wird von einer kleinen Elite von literarischen Feinschmeckern schon lange gekannt und geschätzt, doch ist er erst durch seinen Roman » La double Maîtresse« der allgemeinen Aufmerksamkeit teilhaftig geworden. Die innere Entwicklung, die er durchgemacht hat und deren Niederschlag seine Gedichte, Novellen und Romane sind, läßt sich bei ihm wie bei wenigen zeitgenössischen Dichtern verfolgen und ist auch bei wenigen so typisch für die verschiedenen Phasen des jüngsten Literaturprozesses. Vom Romantiker, der Lebensflucht und Weltentsagung in rätselvollen Liedern besang und müde Stimmungen in märchenhafte Novellen hineingeheimniste, hat er sich Schritt für Schritt zur Lebensbejahung und Wirklichkeitskunst durchgerungen, ganz ähnlich wie der große belgische Symbolist Maurice Maeterlinck.
Henri de Régnier ist 1864 in der träumerischen Weltferne der französischen Provinz geboren, die er in seiner Novelle » Jours heureux« so herzbewegend geschildert hat. Die Eltern waren legitimistische Edelleute, die ein müdes, zurückgezogenes Aristokratendasein führten. Müde und melancholisch tritt er selbst ins Leben; Enttäuschung und Entsagung folgen ihm auf seinem Wege; nur ein letzter Wunsch bleibt ihm: nach Einsamkeit und Stille ... »Die Lampe brennt in einer Ecke des weiten, hochfenstrigen Saales,« heißt es in der Novellensammlung » La Canne de Jaspe«. »Ich stehe am Fenster und drücke die Stirn gegen die beschlagenen Scheiben. Die Blätter sehe ich nicht mehr fallen, aber jetzt fühle ich etwas in mir sich ablösen und langsam abbröckeln. Mich deucht, ich höre in der Stille den Fall meiner Gedanken. Sie fallen von hoch herab, einer nach dem andern, und zergehen langsam, ich aber folge ihrem Fall mit allem Ernst, der in mir ist. Ihr dumpfer, leichter Schall hat nichts mehr von der Schwere dessen, was sie im Leben wollten. Der Stolz entblättert sich, der Ruhm vergilbt ...« Gegenwart und Wirklichkeit versinken ihm in nächtliches Dunkel, während die Bilder der Vergangenheit in seiner Erinnerung aufleuchten und seine Träume erfüllen. Das Einst folgt ihm wie ein Schatten, als sein Schatten ...
Aus diesem zurückgewandten Leben entsteht allmählich eine letzte Freude für den Einsiedler: die am Nachbilden, am Schaffen, ja, am Leben selbst. Das Ideal, das der Träumer im Busen trägt, aber im Leben nicht zu verwirklichen vermag, soll wenigstens im Spiegel der Kunst ein schönes Scheinleben führen. Alle Figuren der ersten Prosawerke zeigen diese Neigung zu Spiegeln; sie gehen an die Quellen, um sich darin zu schauen, und die »Weisen« der großen Stadt in der Novelle »Hermokrates« gehen mit einem Spiegel in der Hand, um sich in ihrem Getriebe nicht zu verlieren. Régnier läßt auch die Natur, den Wald, den Sonnenuntergang, sich im Spiegel sehen, abgekühlt, verkleinert, »frei von dem zu großen Pathos da draußen.« Daher auch die Neigung zu Symbolen. Der Philosoph Eustasius ist der schönen Humbeline ewig dankbar, daß sie ihm »die abgekürzte Formel der Welt« ist. Er will die Welt als Ganzes sehen, ohne die ermüdende Fülle ihrer Einzelheiten, ohne ihre scharfen Ecken und Kanten. Und er stilisiert sie, um sie sich menschlich näher zu bringen. Er leiht ihr idyllische Züge; er schmückt sie mit Abendröten von Claude Lorrainscher Kristallklarheit, er belebt sie mit dem wild dahinbrausenden bacchantischen Treiben Böcklinscher Fabelwesen; und wenn er jetzt wieder dem verzitternden Nachhall der Vergangenheit in seinem Innern lauscht und die Erinnerungen der Kindheit reden läßt, so geschieht dies nicht mehr in symbolischen Liedern, sondern in der liebenden Kleinmalerei eines Schalcken und Mieris. Die Novelle » La Côte verte« offenbart diesen Stilbruch, dieses fortwährende Verlassen eines alten Stilprinzips und das fortwährende Hineinklingen von etwas Neuem, noch halb Unbewußtem, in typischer Weise und verleiht ihr dadurch einen eignen Zauber. In der nächsten Novelle » Jours heureux« ist der Umschwung zur Wirklichkeitskunst bereits vollendet. Die Brücke aus dem Traum- und Fabelland, aus der toten Natur ins Menschenleben, ist ganz abgebrochen. Es ist schlichter Wirklichkeitsstil, den schlichten Kindheitserinnerungen angepaßt, aber von einer Tiefe und Zartheit des Empfindens, bereit ein konsequenter Naturalist nicht fähig wäre.
» II ne s'agit pas d'analyser mais d'evoquer des sentiments«, sagt Régnier einmal, und nachdem er die Realität der Kinderzeit einmal aus sich herausgestellt hat, versucht er mit Glück, seine Gefühle vollends zu objektivieren und in einem Roman, ganz von sich losgelöst, in die Welt der äußeren Tatsachen einzuführen. Er schafft die Gestalt seines »armen« Nicolas von Galandot und transponiert diesen ins ancien régime, das bei einem französischen Aristokraten wohl das nächstliegende ist. Auch hier ist es eine Erinnerung, und zwar eine über sein individuelles Dasein zurückreichende Erinnerung, die ihn dem Leben – oder der Darstellung des Lebens – wiedergibt. Es ist schwer, den Roman » La double Maîtresse« in kurzen Worten zu schildern, da sich um eine sehr einfache Handlung, deren einzelne Phasen nach Art des altfranzösischen Romans freilich sehr ineinandergeschachtelt sind, ein ganzes Gewirr von kleinen Zügen und Tatsachen dreht, lauter angewandte Psychologie, verbunden mit meisterhafter historischer Milieuschilderung und apartem, altmodischem Stil. Der Roman ist getrost als Régniers standard-work zu betrachten und wird in deutscher Ausgabe diesem Bande nachfolgen, bedarf also keiner Inhaltsangabe.
Nach ihm hat Régnier noch eine Gedichtsammlung » Les Médailles d'Argile« verfaßt, anscheinend in dem Bestreben, den einmal gewonnenen Realismus in Sprache und Darstellung auch lyrisch festzubannen. Sie verrät nichts mehr von dem vers libre des einstigen Mallarmé-Schülers, atmet vielmehr die akademische Korrektheit der Versbehandlung seines Schwiegervaters, José Maria de Hérédia. Einen weiteren Fortschritt bedeutet die vorliegende Novellensammlung » Les Amants Singuliers«, deren erste, packendste Novelle unwillkürlich an C. F. Meyers unvergeßliche Renaissanceschilderungen gemahnt. Hier ist auch der letzte Faden zwischen Regniérs Figuren und seinem subjektiven Ich zerschnitten, und der objektiv bildende Künstler schafft mit historischem Sinn alte Kultur-Milieus nach: das italienische Cinquecento mit seinen wilden Leidenschaften und seiner heidnischen Schönheitstrunkenheit, – das Venedig des Rokoko, das so von ungebundenem Glück und sorgloser Zufriedenheit strotzt, daß Stendhal es als das Eldorado preist, in dem er gelebt haben möchte, – und das Zeitalter des Roi Soleil mit seiner stelzbeinigen Würde und seinem, in Allongeperücken daherschreitenden Römertum.
In diesem Zeitalter bewegt sich auch der in der Sprache Saint-Simons gemeisterte Roman » Le bon plaisir«, während Régnier in seiner letzten Schöpfung » Le Mariage de Minuit« den Schritt in die Moderne tut. Freilich ist diese Moderne von ganz besonderer Art; die Menschen, die er schildert, führen eine altmodisch-graziöse Sprache und ein geistreich-frivoles Rokokoleben: es sind die Nachkömmlinge jener alten Noblesse, die von der rohen Faust der Revolution zerbrochen wurde, wie zartes, zerbrechliches Sèvresporzellan. das nur in traurigen Scherben noch überlebt.
Fr. von Oppeln-Bronikowski
I. Das Marmorbild
Eine Geschichte aus dem Cinquecento
Ich schwöre, als ich Giulietta del Rocco begegnete, hätte ich nie gedacht, sie nackt zu sehen.
Es war an einem schönen Sommernachmittag, wenn auch die Luft nicht von solcher vollkommenen Reinheit und Klarheit war, wie zuweilen, wo ihre Schönheit schier göttlich ist. Kein Wölkchen stand am Himmel, aber ein trockener Dunst trübte das strahlende Licht. Die Schwüle war nicht gewitterhaft, aber drückend. Und ich fühlte meine Ermüdung, denn ich hatte die Stadt schon lange hinter mir.
Gleichwohl setzte ich meinen Weg fort. Das Gelände stieg plötzlich steil an. Trotz meiner Müdigkeit schlug ich den Querweg ein, der nach den hochgelegenen Höfen von Rocco führt. Von oben genießt man eine weite Aussicht über die Ebene und die sumpfige Schlangenlinie des Motterone. Auch ein Pinienhain ist da. Die Luft ist gesünder als in der Niederung, und ich gedachte mich dort bis zum Abend im Schatten der Bäume hinzustrecken und den Heimweg zur Stadt erst anzutreten, wenn es auf den Straßen dunkelt und kühl wird. Ich hoffte in den Höfen etwas zum Abendbrot zu bekommen, eine Satte Milch, Oliven und eine Traube.
Um den Weg abzuschneiden, mußte ich durch den Weinberg des alten Bernardo. Nach meiner Rechnung war es mehr als fünf Jahre her, daß ich den Biederen nicht gesehen hatte, und in diesen fünf Jahren hatten Fleiß und Arbeit mich ans Haus gefesselt. Alles war dieser plötzlichen Neigung zum Opfer gefallen, meine Vergnügungslust und meine gewohnte Trägheit, ja selbst meine Feinschmeckerei. So begierig ich sonst auf Speisen und Früchte war, ich hatte mich nicht einmal mehr zu Tische gesetzt. Ein Stück Brot, im Stehen genossen, ein Glas Wein, hastig hinabgeschlürft, bildeten meine ganze Nahrung. Und wie hatte ich vordem auf den alten Bernardo gelauert, bis ich ihn mit seinem Esel aus einem Winkel des Gemüsemarktes auftauchen sah!
Er schwang seinen dicken Dornstab über der grauen Kruppe des Esels, dessen trockene Hufe auf den flachen Steinen trippelten. Zwischen den Körben, in die er ihn eingezwängt hatte, um ihn zum Markt zu führen, hörte ich die kleine Giulietta lachen. Das Kind trug in seinen Händen Schwertlilien, die es am Motterone-Ufer gefunden hatte, und drehte sich bei den Flüchen seines Großvaters und dem Farzen des Esels um. Bernardo brachte mir Früchte und Gemüse und legte die schönsten von allen, die er zu Markte trug, für mich zurück.
Der anmaßliche, spruchweise Alte war stolz darauf, daß ich ihm Beachtung schenkte, aber mit dem Tage, wo ich dem Schritt seines Esels nicht mehr Gehör gab und nicht selbst an den Korb trat, um mir das Beste eigenhändig herauszusuchen, fühlte er sich in seinem Gärtnerstolz gekränkt und stellte seine Dienste allmählich von selbst ein. Ich sah ihn also nicht mehr und hatte ihn vielleicht auch nie wieder erblickt, denn er war sehr alt, und die Jahre sind in seinem Alter schwer und tückisch.
Die fünf, die ich in der Zurückgezogenheit meines häuslichen Lebens verbracht hatte, waren Gott sei Dank recht fruchtbringend für mich. Wenn der Garten des alten Bernardo in dieser Zwischenzeit schöne irdische Früchte trug, so war die Ernte des Geistes, die ich machte, nicht minder kostbar; denn ihr müßt wissen, daß ich in diesen fünf Jahren zum Meister in meiner Kunst geworden bin.
Ich empfand, um die Wahrheit zu sagen, über die Schnelligkeit meiner Fortschritte eine große Freude und auch eine große Furcht. Jetzt galt es, mich dieser großen Gnade würdig zu erweisen und sie in meinen eignen Augen durch den rechten Gebrauch zu rechtfertigen, denn die ernstlichste Pflicht des Menschen ist nicht die, zu der man ihn zwingt, sondern die, die er sich selbst auferlegt.
Seitdem ward mir im Drang und in der Ungewißheit meiner Gedanken das Haus zu eng. Ich lief ungeduldig und aufgeregt durch die Stadt, ging aufs Land hinaus und suchte einen einsamen Ort auf, bald an den Ufern des Motterone, bald in den Bergen. Ich erklomm die Berglehnen und setzte mich auf einen Felsen, oder ich lag am Ufer und lauschte dem Rauschen des gelben Lehmwassers und dem Flüstern der trockenen Schilfblätter an ihren feuchten Stengeln. Das Schweigen der Felsen und das Murmeln der Wellen war die abwechselnde Unterhaltung meiner einsamen Stunden.
Es war ein Zufall, daß ich bis zu dem Tage, von dem ich euch erzähle, nicht wieder nach den Höfen von Rocco und dem Pinienhain gekommen war. Früher ging ich oftmals dorthin. Er war voller Holztauben, und ich liebte, sie mit der Armbrust zu erlegen. Ich war sehr geschickt in dieser Kunst. Nie verfehlte der Bolzen sein Ziel, aber ich hatte diesem müßigen Spiel schon lange entsagt. Ich hatte das scharfe Auge nicht mehr und die sichere Hand, als ich mich heute ängstlich an die roten Baumschäfte zu lehnen gedachte. Ich wollte mich hier mit geschlossenem Ohr und Auge niederstrecken und die Verwirrung meines Geistes für ein Stündlein verschlafen.
Ich hatte Bernardos Weinberg erreicht. Er war terrassenförmig angelegt. Reife Trauben hingen an den Spalieren. Ich kostete eine Beere, aber ich fand keinen Geschmack an ihrer faden, lauen Flüssigkeit und spie die süßliche Schale wieder aus. Ich hörte hinter mir lachen und wandte mich um.
Ein junges Mädchen stand vor einem großen Korb voller Weintrauben. Wie sie den Arm nach einer Traube reckte, schien sie mir schlank und stark zugleich. Die Schönheit ihres Leibes schimmerte durch ihr Hemd und ihren Rock von grobem Linnen.
* * *
Von Kindheit an war ich ein aufmerksamer Beobachter der Form von Dingen und Wesen. Ich konnte lange Stunden sitzen und die flüchtigen Wolkenbilder, die Adern der Kieselsteine, die Knoten der Baumrinde betrachten. Ich erkannte alles Unbestimmte und Geheimnisvolle, was man bei langer Betrachtung den Dingen enträtselt. Ich liebte den Anblick der Landschaften und der Tiere. Auf der Jagd, wenn ich sie verfolgte, bewunderte ich ihren Lauf oder Flug.
So lebte ich, indem ich dem Leben zusah. Ich diente Mars und Amor. Die Art, wie sich zwei Degen kreuzen und zwei Lippenpaare berühren, begeisterte mich gleichermaßen. Eines Tages umarmte mich meine Geliebte mit einer so holden Gebärde, daß ich die Erinnerung daran noch wo anders als in meinem Gedächtnis bewahren wollte. Denn das menschliche Gedächtnis ist so ungewiß, daß selbst die köstlichsten Bilder, die es aufgenommen hat, vergänglich und flüchtig sind. Aus der Erkenntnis dieses Unbestandes sind die Künste entstanden und aus dem Verlangen, das zu verewigen, was ohne ihren Beistand vergänglich ist. Ich wollte dem nacheifern, was andre so trefflich verstehen. Aber ach, ich besaß die göttliche Kunst nicht. Mein Papier trug nur formlose Linien und bewahrte nur unbezeichnende Gestalten. Ich weinte in ohnmächtiger Wut.
Ich mußte alles lernen. Und ich lernte. Zwanzigmal war ich nahe daran, zu verzweifeln. Aber ich ließ nicht nach. Als fünf Jahre verflossen waren, wußte ich die Farben zu mischen und den Stein zu meißeln und alles, was ist, abzubilden. Es blieb mir nur noch die Wahl dessen, was ich verewigen wollte. Und ich hatte mich entschlossen, einen Frauenleib zu wählen, im Angedenken an das Weib, dessen Kuß mir die Augen geöffnet ...
* * *
Inzwischen hatte die Winzerin die Traube gepflückt, nach der sie gegriffen, und warf sie zu den andern in den Korb. Sie lachte nicht mehr und blickte mich an.
»Sie sind zu heiß, gnädiger Herr, um Euch den Durst zu löschen,« sagte sie mit sanfter und ernster Stimme. »Sie werden erst im Kühlen wieder munden. Aber wenn Euer Herrlichkeit dürstet, so geruhet nur, mit mir in das Haus zu kommen. Unser Brunnen ist kalt, und mein Großvater wird frohen Mutes sein, Euer Herrlichkeit wiederzusehen, wenn Ihr den alten Bernardo noch nicht vergessen habt.«
Und sie begann wieder zu lachen. Mich deuchte, daß ich sie erkannte.
»So bist du denn die kleine Giulietta,« antwortete ich, »die mir einst auf dem Esel Oliven, Melonen und Schwertlilien brachte. Du saßest zwischen den Körben. Wie groß und schön bist du geworden!«
»Ja,« antwortete sie errötend, »ich bin Giulietta, die Großtochter des alten Bernardo. Und ich bin groß geworden.«
Sie hob den Korb auf, daß das Weidengeflecht sich stöhnend unter der Traubenlast bog. Aber sie ergriff die Henkel mit fester Hand und hob die Bürde auf ihre Schulter. Ihr ganzer Körper ward steif, um das Gewicht zu tragen. Ich sah, wie ihre Hüfte den Rock spannte. Sie begann vor mir herzugehen.
Ich folgte ihr. Ihre Haare waren auf ihrem Nacken zusammengeknüpft und wanden sich in schweren Flechten. Sie ging mit festen und gleichmäßigen Schritten.
Ihre kräftigen Lenden wölbten sich prall; der rauhe Stoff ihres Rockes bog sich wie weicher Stein, und der Körper schien in starken und edlen Linien gemeißelt. Das Fleisch ihrer Arme und des bloßen Nackens vollendete das Bild der Statue. Da es sehr heiß war, trug ihr Hemd zwischen den Schultern einen feuchten Fleck.
Das Gehöft war ein viereckiges Gebäude in der Mitte eines kiesbedeckten Hofes. Ein Hund bellte uns beim Kommen entgegen, ein Rind blökte im Stalle. Aus dem Schafstalle drang das klägliche Geblök der Hämmel. Der alte Bernardo erschien auf der Schwelle der Haustür.
Er hatte sich in diesen fünf Jahren nicht verändert, nur sein Bart war noch länger und weißer geworden. Ich bewunderte seine breiten, erdbraunen Hände. Der ganze Mann gemahnte an einen alten Baum. Sein Haar kräuselte sich auf seiner Stirn wie trockenes Moos, und sein Bart hing herab wie ein strähniges Kraut. Seine nackten Füße klebten am Boden wie Wurzeln, und sein gefurchtes Antlitz glich einer rauhen Borke, in welcher der Mund einen Spalt und die Nase einen Astknoten bildete. Die lebhaften Augen glänzten wie Regentropfen, und die Ohren glichen jenen knorpeligen Pilzen, wie sie am Fuße alter Stämme wachsen. Er hatte etwas Wald- und Pflanzenhaftes an sich.
Er empfing mich freundlich, aber mit gemessenem Ernst. Vielleicht sah er es ungern, daß ich derart mit Giulietta zurückkam, und er traute mir dieselben galanten Absichten zu, wie sie die vornehmen Herren sich schönen Landmädchen gegenüber nicht nehmen lassen. Giulietta hatte, ohne ein Wort zu sagen, einen strohumflochtenen Fiasco und einen irdenen Krug frischen Wassers auf den Tisch gestellt, daneben eine Schüssel mit schwarzen Oliven. Dann war sie plötzlich fort, und wir blieben allein. Bernardo schwieg und blickte mich an, wobei er an seinem langen Bart kaute. Das Schweigen währte eine gute Weile.
»Findest du sie schön, unsre Giulietta?« fragte er plötzlich, indem er mir einschenkte.
Ich antwortete nicht.
»Sie ist schön, nicht wahr?« wiederholte er und hielt einen Augenblick inne. Dann stemmte er seine Ellbogen auf, und als ich das Glas wieder vor mich hingestellt hatte, fuhr er fort:
»Warum machst du ihr Bild nicht in Holz oder Stein?«
Seine Zunge war plötzlich losgebunden, als rühmte er mir schon lange die Güte einer Frucht, die er mir mit seiner rauhen Hand über das borstige Rückgrat seines Esels hinhielt.
»Die beiden Herren von Corcorone, deine Freunde, haben mir oft von dir erzählt, seit man dich selbst nicht mehr zu Gesicht bekommt. Du weißt, die beiden Corcorone? Ich bin mit ihrem Großvater im Krieg gewesen, und darum grüßen sie mich auch und reden mich leutselig an. Es sind gute Herren. Der große ist schlank wie ein Bogen und der kleine schnell wie ein Pfeil. Sie haben mir gesagt, du würdest jetzt so gelehrt im Malen und Bildschneiden, und du könntest, wenn du nur wolltest, ein Altarbild machen wie das, das beim Brande von Santa Chiara untergegangen ist, oder die Apostel an den Türen von San Michele ausbessern, denen in schlimmen Zeiten die Nase und die Arme abhanden gekommen sind. Giulietta ist schön und klug, und ich möchte sie wohl auf einem Heiligenbilde sehen. Ihr Gesicht wäre dann immer von Gebeten, Weihrauch und Kerzen umgeben, das würde ihr Glück bringen und ihre Weisheit und Frömmigkeit mehren.«
»Ei, du täuschest dich, Bernardo,« erwiderte ich. »Ich male und bilde keine Heiligen, das überlasse ich Geschickteren und Frömmeren, als ich es bin. Mir ist es genug, das Antlitz der Dinge genau abzubilden, und mehr noch Körper und Gesicht der Menschen.«
Er ließ seine Hand über den Bart gleiten.
»Die Corcorone haben dir Falsches berichtet, Bernardo,« fuhr ich fort.
»Ich habe alte Steinbilder ausgraben sehen,« sagte der Greis ganz leise, als spräche er zu sich selbst. »Sie ruhten seit Hunderten von Jahren in der Erde. Sie trugen weder Kleider noch Haarputz, sie waren ganz nackend. Und doch lachte keiner darüber, und alle behandelten sie mit Ehrerbietung. Ich glaube, es war, weil man sie schön fand.«
Und leiser noch setzte er hinzu:
»Ich habe auch Gräber öffnen sehen und eherne Särge aufbrechen. Sie bargen Skelette in goldenen Gewändern. Aber alles hielt sich die Nase zu, und etliche traten die Gebeine mit Füßen. Es war in Kriegszeiten, als wir Guescia einnahmen und die Herzogsgräber plünderten ...«
Und der alte Bernardo erzählte mir von verschiedenen Waffentaten aus seiner Jugendzeit, damals, als er den Fahnen des großen Corcorone folgte. Ich hatte die Oliven inzwischen verzehrt und die Flasche ausgetrunken. Der Greis geleitete mich zur Tür.
»Entschuldige, daß ich nicht weiter gehe,« sagte er; »meine Beine sind schwer.«
Ich war allein und ging nach dem Pinienwäldchen. Als ich es betrat, erschraken die Tauben und hörten auf zu girren. Etliche flogen mit lautem Flügelschlag von dannen. Ein schuppiger Pinienzapfen fiel mir zu Füßen.
* * *
Nein, wahrlich, ich habe es schon einmal gesagt, und ich wiederhole es nun: Als ich Giulietta im Weinberg begegnete, da dachte ich nicht, daß ich sie je nackten Leibes sehen würde, noch, wie ich hinzusetzen muß, daß ich sie in ihrem Fleisch und Bein erblicken würde, ohne in dem meinen nach ihr zu verlangen.
Sie erschien jeden Morgen bei mir zur selbigen Stunde wie das erstemal. Es war am zweiten Tag nach meinem Besuch bei dem alten Bernardo, da betrat sie zum erstenmal meine Werkstätte. Ich glaubte, sie wollte mir etwas Verlorenes wiederbringen, und ich wartete, daß sie sprechen würde, indes ich sie lächelnd anschaute.
Aber ohne etwas zu sagen, begann sie ihre Kleider abzulegen. Dies geschah, als ob sie einem Befehl gehorchte. Als ich sie nackend sah, schaute sie mir in die Augen und blieb regungslos stehen.
Lange Tage blieb ich in den Anblick ihrer Schönheit versunken. Meine Tür war für jedermann verschlossen. Marmorhändler kamen und Verkäufer bunter Tonerden, das waren meine gewöhnlichen Besuche. Auch die beiden Herren von Corcorone verlangten mich zu sehen und gingen erstaunt wieder von dannen, als sie nicht vorgelassen wurden.
Sonst pflegten sie zu kommen, wie es ihnen beliebte. Selbst in den Tagen meiner strengsten Abgeschlossenheit drangen sie in meine Einsamkeit.