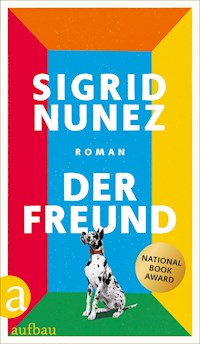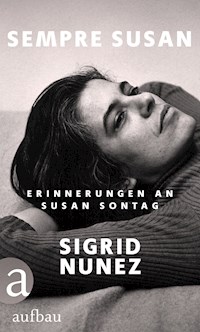
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Autorin des Bestsellers »Der Freund« erscheinen jetzt die autobiographischen Erinnerungen an ihre Zeit mit Susan Sontag »Sigrid Nunez liefert das bis heute lebendigste und schillerndste Porträt von Susan Sontag.« Vogue Frühling 1976 in New York City: Sigrid Nunez, gerade mal 25 Jahre alt, träumt davon, Schriftstellerin zu werden, als Bob Silvers von der „New York Review of Books“ ihr einen Job vermittelt: Sie soll einer bekannten Autorin, die ein paar Straßenecken weiter auf der Upper Westside wohnt, bei der Korrespondenz helfen. Wenig später sitzt Nunez am Küchentisch von Susan Sontag und tippt auf deren Schreibmaschine, was Susan ihr diktiert. Sie lernt die glamouröse Denkerin aus nächster Nähe kennen, verliebt sich in deren Sohn David und zieht schließlich bei den beiden ein. Ein Erinnerungsbuch, in dem Sigrid Nunez über die vielleicht prägendste Begegnung ihres Lebens schreibt und ein privates, nuanciertes Porträt von Susan Sontag entsteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Von der Autorin des Bestsellers »Der Freund« erscheinen jetzt die autobiographischen Erinnerungen an ihre Zeit mit Susan Sontag
»Sigrid Nunez liefert das bis heute lebendigste und schillerndste Porträt von Susan Sontag.« Vogue
Frühling 1976 in New York City: Sigrid Nunez, gerade mal 25 Jahre alt, träumt davon, Schriftstellerin zu werden, als Bob Silvers von der „New York Review of Books“ ihr einen Job vermittelt: Sie soll einer bekannten Autorin, die ein paar Straßenecken weiter auf der Upper Westside wohnt, bei der Korrespondenz helfen. Wenig später sitzt Nunez am Küchentisch von Susan Sontag und tippt auf deren Schreibmaschine, was Susan ihr diktiert. Sie lernt die glamouröse Denkerin aus nächster Nähe kennen, verliebt sich in deren Sohn David und zieht schließlich bei den beiden ein. Ein Erinnerungsbuch, in dem Sigrid Nunez über die vielleicht prägendste Begegnung ihres Lebens schreibt und ein privates, nuanciertes Porträt von Susan Sontag entsteht.
Über Sigrid Nunez
Sigrid Nunez ist eine der beliebtesten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Für ihr viel bewundertes Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Für »Der Freund« erhielt sie 2018 den National Book Award und erreichte ein großes Publikum. Sie lebt in New York City.
Anette Grube, geboren 1954, lebt in Berlin. Sie ist die Übersetzerin von Arundhati Roy, Vikram Seth, Chimamanda Ngozi Adichie, Mordecai Richler, Yaa Gyasi, Kate Atkinson, Monica Ali, Richard Yates u.a.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sigrid Nunez
Sempre Susan
Erinnerungen an Susan Sontag
Aus dem Amerikanischen von Anette Grube
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Impressum
Es war das erste Mal überhaupt, dass ich von einer Schriftstellerkolonie eingeladen war, und aus einem Grund, den ich vergessen habe, verzögerte sich meine Ankunft dort. Ich machte mir Sorgen, dass meine verspätete Ankunft Stirnrunzeln hervorrufen würde. Doch Susan bestand darauf, dass es nicht schlecht wäre. »Es ist immer gut, alles mit einem Regelbruch anzufangen.« Für sie war Unpünktlichkeit die Regel. »Nur wenn ich ein Flugzeug erwischen muss oder in die Oper gehe, schaue ich, dass ich nicht zu spät komme.« Wenn sich jemand beschwerte, dass er immer auf sie warten musste, blieb sie hart. »Wenn die Leute nicht schlau genug sind und sich etwas zum Lesen mitbringen …« (Aber wenn bestimmte Personen schlau genug waren und Susan auf sich warten ließen, war sie nicht amüsiert.)
Meine eigene pingelige Pünktlichkeit ging ihr manchmal auf die Nerven. Als ich einmal mit ihr beim Mittagessen war und mir klar wurde, dass ich zu spät zur Arbeit zurückkehren würde, und vom Tisch aufsprang, machte sie sich über mich lustig. »Bleib sitzen! Du musst nicht auf die Sekunde dort sein. Sei nicht so servil.« Servil war eins ihrer Lieblingswörter.
Einzigartigkeit. War es wirklich eine gute Idee, dass wir drei – Susan, ihr Sohn, ich – zusammenwohnten? Sollten David und ich uns nicht eine eigene Wohnung suchen? Sie sagte, sie sehe keinen Grund, warum wir nicht alle zusammenleben könnten, auch wenn David und ich ein Kind bekommen sollten. Sie würde uns freudig unterstützen, wenn sie müsste, sagte sie. Und als ich Zweifel äußerte: »Sei doch nicht so konventionell. Wer sagt, dass wir wie alle anderen leben müssen?«
(Auf dem St. Mark’s Place wies sie mich einmal auf zwei exzentrisch aussehende Frauen hin, eine mittleren Alters, die andere älter, beide gekleidet wie Hippies mit langen, fließenden grauen Haaren. »Alte Bohemiennes«, sagte sie. Und fügte scherzhaft hinzu: »Wir in dreißig Jahren.«
Über dreißig Jahre sind vergangen, und sie ist tot, und es gibt keine Bohème mehr.)
Sie war dreiundvierzig, als wir uns kennenlernten, doch auf mich wirkte sie sehr alt. Das lag zum einen daran, dass ich fünfundzwanzig war und mir in diesem Alter alle über vierzig alt erschienen. Andererseits erholte sie sich gerade von einer radikalen Mastektomie. (Brich eine Regel: Als das Krankenhauspersonal sie dafür tadelte, dass sie die empfohlene Krankengymnastik nicht machte, flüsterte ihr eine mitfühlende Krankenschwester ins Ohr: »Happy Rockefeller hat sie auch nicht gemacht.«) Ihre Haut war fahl, und ihr Haar – es sollte mich immer wundern, dass so viele Leute glaubten, die weiße Strähne in ihrem Haar wäre entfärbt, da doch auf der Hand lag, dass es die wahre Farbe ihres Haars war. (Ein Friseur hatte gemeint, dass es weniger künstlich aussähe, eine Partie nicht zu färben.) Die Chemotherapie hatte ihr extrem dickes schwarzes Haar überwiegend, wenn auch nicht komplett ausgedünnt, doch die Haare, die nachwuchsen, waren vor allem weiß.
Es war demnach merkwürdig: Als wir uns kennenlernten, sah sie älter aus als zu der Zeit, als ich sie schon besser kannte. Während sie genas, wirkte sie zunehmend jünger, und als sie beschloss, ihr Haar zu färben, sah sie noch jünger aus.
Es war im Frühjahr 1976, fast ein Jahr, nachdem ich meinen Master of Fine Arts an der Columbia University gemacht hatte, und ich wohnte in der West 106th Street. Susan, die an der Ecke 106th Street und Riverside Drive lebte, wollte einen Stapel unbeantworteter Korrespondenz, der sich während ihrer Krankheit angesammelt hatte, abarbeiten. Sie bat Freunde, die Herausgeber der New York Review of Books, ihr jemanden zu empfehlen, der ihr dabei helfen könnte. Ich hatte bei der Review zwischen dem College und der Universität als Assistentin gearbeitet. Die Herausgeber wussten, dass ich Schreibmaschine schreiben konnte und in der Nähe wohnte, und schlugen Susan vor, mich anzurufen. Es war genau die Sorte Gelegenheitsjob, die ich suchte: ein Job, der mich nicht am Schreiben hindern würde.
Am ersten Tag, als ich zu 340 Riverside Drive ging, schien die Sonne, und in der Wohnung – einem Penthouse mit vielen großen Fenstern – war es blendend hell. Wir arbeiteten in Susans Schlafzimmer, ich saß an ihrem Schreibtisch und tippte auf ihrer massiven IBM Selectric, und sie diktierte, ging dabei durchs Zimmer oder lag auf dem Bett. Der Raum war wie der Rest der Wohnung karg eingerichtet; die Wände waren weiß und nackt. Später erklärte sie, dass sie so viel weißen Raum wie möglich um sich haben wollte, wenn sie arbeitete, und sie versuchte, das Zimmer weitgehend frei von Büchern zu halten. Ich erinnere mich an keine Fotos von der Familie oder Freunden (ja, ich erinnere mich überhaupt an keine Bilder dieser Art in der Wohnung); stattdessen waren da ein paar Schwarz-Weiß-Fotos (wie sie in Pressemappen von Verlagen zu finden sind) von einigen ihrer literarischen Helden: Proust, Wilde, Artaud (von dem sie gerade einen Band ausgewählter Schriften herausgegeben hatte), Walter Benjamin. An anderen Orten in der Wohnung befanden sich Fotos von alten Filmstars und aus berühmten alten Schwarz-Weiß-Filmen. (Soweit ich mich erinnere, hatten diese zuvor in der Lobby des New Yorker Theater gehangen, des Kinos Ecke 88th Street und Broadway, in dem alte Filme liefen.)
Sie trug einen lockeren Rollkragenpullover, Jeans und Ho-Chi-Minh-Sandalen aus Reifengummi, die sie, glaube ich, von einer ihrer Reisen nach Nordvietnam mitgebracht hatte. Wegen des Krebses versuchte sie, mit dem Rauchen aufzuhören (sie sollte es versuchen und scheitern und wieder versuchen, viele Male). Sie aß ein ganzes Glas gerösteter Maiskörner und spülte sie mit Schlucken aus einer großen Flasche Wasser hinunter.
Der Stapel Briefe war entmutigend; es waren viele Stunden notwendig, um ihn abzuarbeiten, doch was unser Weiterkommen absurd verlangsamte, war, dass ständig das Telefon klingelte, und sie nahm jedes Mal ab und plauderte (manchmal ziemlich lang), während ich dasaß, wartete und natürlich zuhörte und manchmal den großen Schlittenhund ihres Sohnes streichelte, der Aufmerksamkeit suchte. Die meisten Anrufer waren Leute, deren Namen ich kannte. Ich nahm an, dass sie entsetzt war, auf welche Weise viele Menschen auf ihre Krebserkrankung reagierten. (Obwohl ich es noch nicht wusste, beschäftigte sie sich bereits mit Ideen für ihren Essay »Krankheit als Metapher«.) Ich erinnere mich, dass sie einem Anrufer gegenüber »Krebs« als »imperiale Krankheit« bezeichnete. Ich hörte sie zu mehreren Personen sagen, dass sie sich aufgrund der kurz zurückliegenden Tode von Lionel Trilling und Hannah Arendt »verwaist« fühle. Heftige Empörung, als sie berichtete, jemand habe über Trilling gesagt, es sei kein Wunder gewesen, dass er an Krebs erkrankt sei, da er seine Frau wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gevögelt habe. (»Und das war ein Akademiker, der das gesagt hat.«) Sie gab es nur äußerst ungern zu, aber sie tat es tapfer: Einer ihrer ersten Gedanken nach der Krebsdiagnose war gewesen: »Hatte ich zu wenig Sex?«
Einmal rief ihr Sohn an. David, ein Jahr jünger als ich, hatte das Studium in Amherst aufgegeben, studierte jedoch seit Kurzem wieder in Princeton. Er hatte dort ein Zimmer, aber die meiste Zeit wohnte er bei seiner Mutter. Sein (bald unser) Schlafzimmer war direkt neben ihrem.
Die Arbeit langweilte sie. Nachdem wir erst ein paar wenige Briefe erledigt hatten, schlug sie eine Mittagspause vor. Ich folgte ihr durch Flure, die mit Büchern gesäumt waren, ein Esszimmer, in dem ich einen langen eleganten Tisch aus Holz mit dazu passenden Holzbänken (ein alter französischer Tisch aus einem Bauernhof, erklärte sie mir) und ein gerahmtes altes Olivetti-Poster (»la rapidissima«) an der Wand dahinter bewunderte, ans andere Ende der Wohnung. Auf dem Esstisch lagen normalerweise Bücher und Papiere, und die meisten Mahlzeiten wurden an einer dunkelblau gestrichenen Holztheke in der Küche eingenommen.
Ich saß unsicher auf einem Hocker an der Theke, während sie eine Dose Campbell’s Pilzcremesuppe aufwärmte. Gab man Milch dazu, reichte es für zwei. Es überraschte mich, dass sie so gesprächig war. Ich war an die hierarchische Welt der New York Review gewöhnt, deren Herausgeber nie mit den Mitarbeitern sprachen. An diesem Tag erfuhr ich, dass der Vormieter der Wohnung ihr Freund Jasper Johns gewesen war; ein paar Jahre zuvor, als Johns beschlossen hatte, woanders hinzuziehen, hatte Susan den Mietvertrag übernommen. Doch sie glaubte, dass sie nicht mehr lange dort würde wohnen dürfen; der Hausbesitzer wollte die Wohnung für sich selbst. Es war offensichtlich, warum Susan sie behalten wollte: ein großes Penthouse mit zwei Schlafzimmern in einem schönen Vorkriegsgebäude – ein großartiges Schnäppchen für, soweit ich mich erinnere, ungefähr 475 Dollar im Monat. Das riesige Wohnzimmer wirkte noch größer, weil so wenig darin stand (es hallte sogar leicht). Aber am meisten würde sie die Aussicht vermissen: den Fluss, die Sonnenuntergänge. (Die grandiose Aussicht wäre im Freien noch besser gewesen, doch die Terrasse war ein Saustall: Der Hund erledigte dort sein Geschäft.) Am anderen Ende der Wohnung von den beiden Schlafzimmern aus gesehen, waren ein viel kleineres Zimmer, einst ein Dienstmädchenzimmer, und eine Gästetoilette. Damals schlief ein Freund von David dort. Nach meinem Einzug fungierte es als mein Arbeitszimmer. (»Du bist die einzige in der Wohnung mit zwei Zimmern«, sagte Susan, gekränkt, vorwurfsvoll, als ich ihr mitteilte, dass ich »340« verlassen würde.)
Beim Mittagessen stellte sie mir eine Menge Fragen zu meiner Arbeit mit den Herausgebern Robert Silvers und Barbara Epstein bei der New York Review, und wie es war, bei Elizabeth Hardwick zu studieren, die eine meiner Professorinnen am Barnard College gewesen und ebenfalls Herausgeberin der Review war. Es war klar, dass diese drei Personen Susans größtes Interesse – Faszination sogar – erregten, und ich sollte erfahren, dass ihr ihre Freundschaft und Anerkennung alles bedeuteten. Alle drei gehörten 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Review. Susan hielt die Review allen anderen Zeitschriften im Land für weit überlegen – eine »heroische« Anstrengung, das intellektuelle Leben Amerikas auf den höchstmöglichen Standard zu heben – und war stolz darauf, von der ersten Ausgabe an dafür geschrieben zu haben. Ihre Artikel wurden von Silvers redigiert: »Bei Weitem der beste Redakteur, den ich je hatte.« Der beste Redakteur, den ein Autor nur haben könne, sagte sie. Wie anderen Autoren der Review flößte ihr seine große Achtung für Schriftsteller, sein Perfektionismus und die immense Arbeit, die er vor der Veröffentlichung in die Überarbeitung von Artikeln steckte, großen Respekt ein. Er sei einer der intelligentesten und begabtesten Menschen, die sie je kennengelernt habe, sagte sie – und wahrscheinlich das größte Arbeitstier, er sei sieben Tage die Woche, einschließlich der Feiertage, den ganzen Tag und meist bis spät in die Nacht an seinem Schreibtisch zu finden. Er verkörperte aufs Haar die Art von Disziplin, intellektueller Leidenschaft und Gewissenhaftigkeit, die Susan bei anderen Menschen bewunderte, und er weckte in ihr die gleiche Verehrung, die sie für gewöhnlich nur für die ernsthaftesten Schriftsteller und Künstler reserviert hatte.
Ihrem Stolz, für die New York Review zu schreiben, kam nur der Stolz gleich, dass ihre Bücher von Farrar, Straus and Giroux verlegt wurden. Ihr längstes und vertraulichstes Telefongespräch an diesem Tag war mit Roger Straus, der als Verleger von FSG dreizehn Jahre zuvor Susans erstes Buch veröffentlicht hatte und alle ihre weiteren Bücher publizieren sollte. Es war nicht ungewöhnlich, dass die beiden mindestens einmal am Tag telefonierten. Damals hatte Susan keinen Agenten, und abgesehen davon, dass er ihre Bücher verlegte, kümmerte sich Straus um bestimmte geschäftliche Dinge, die normalerweise nicht Sache eines Verlegers sind, zum Beispiel versuchte er, ihre Kurzgeschichten und Artikel bei Zeitschriften unterzubringen. Doch ihre Beziehung war nicht nur geschäftlich; sie waren seit Langem gute Freunde, sie waren Vertraute, und Straus war in viele Aspekte von Susans Leben involviert, die nichts mit Schreiben zu tun hatten, darunter die Krise ihrer Krankheit und, als es so weit war, die Suche nach einer neuen Wohnung. Obwohl David bereits zehn Jahre alt war, als Straus und Susan sich kennenlernten, bezeichnete Straus ihn oft als »wahrscheinlich mein unehelicher Sohn«. Bald sollte er David in den Verlag aufnehmen und ihn zum Lektor von, neben anderen Autoren, Susan selbst machen.
Die Suppe war nicht genug. Sie schaute in den Kühlschrank, der fast leer war, und obwohl nicht die Saison für Mais war, lag ein in Plastik verpacktes Paket mit Maiskolben darin. Nachdem wir sie gegessen hatten, sagte sie: »Natürlich wollte ich nichts davon. Alles, was ich wollte, war eine Zigarette.« Ich selbst hatte erst vor Kurzem mit dem Rauchen aufgehört, doch nachdem ich eingezogen war, fing ich wieder an. Wir rauchten alle drei, wie auch so ziemlich alle anderen, die in die Wohnung kamen.
Als ich an diesem Tag ging, stand die Sonne tief über dem Hudson, aber wir hatten sehr wenig erledigt. Susan bat mich, in ein paar Tagen wiederzukommen. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Heimweg dachte, wie lässig und offen sie gewesen war – mehr wie jemand meines Alters und nicht wie jemand aus der Generation meiner Mutter. Aber sie war immer so mit jungen Leuten, und auch zwischen ihr und ihrem Sohn gab es diesen Abstand zwischen den Generationen nicht; sie fing an, ihren Sohn wie einen Erwachsenen zu behandeln, noch bevor er in die High School ging, ohne offenbar jemals daran zu zweifeln, dass es so sein sollte. Wenn ich jetzt daran denke, fällt mir unwillkürlich ein, was Susan oft sagte: Dass sie sich an ihre Kindheit als eine Zeit vollkommener Langeweile erinnerte und es gar nicht hatte erwarten können, dass sie endlich vorbei wäre. Ich hatte immer Schwierigkeiten, das zu verstehen (wie kann man die Kindheit – auch eine nicht unbedingt glückliche – zur »totalen Zeitverschwendung« erklären?), doch sie wollte, dass auch Davids Kindheit so schnell wie möglich vorbei wäre. (Und wie sich herausstellte, blickte auch er auf seine Kindheit als eine unglückliche Zeit zurück und benutzte dabei genau den Ausdruck, mit dem auch Susan ihre Kindheit oft beschrieb: eine Gefängnisstrafe.) Es war, als würde sie nicht wirklich an Kindheit glauben – oder vielleicht besser ausgedrückt, einen Wert darin erkennen.
Für David war sie schon als Junge »Susan«, und sein Vater, der Soziologe und Kulturkritiker Philip Rieff, war »Philip«; David erzählte mir, dass er sich nicht vorstellen konnte, sie Mom und Dad zu nennen. Und wann immer Susan mit David über seinen Vater sprach – den sie geheiratet hatte, als sie eine siebzehnjährige Studentin an der University of Chicago und er ein achtundzwanzig Jahre alter Dozent gewesen waren, und von dem sie sich sieben Jahre später wieder hatte scheiden lassen –, nannte sie ihn ebenfalls Philip. David sagte nur selten »meine Mutter«, wenn er von ihr sprach, und mir wäre es komisch vorgekommen, »deine Mutter« zu sagen. Es war sempre Susan. (Als ich anfing, bei der New York Review zu arbeiten, sagte Robert Silvers einmal: »Hol mir Susan ans Telefon.« Als ich nach dem Rolodex griff, fragte ich: »Susan wer?« Auch Barbara Epstein war im Raum, und als sie es hörte, lachte sie. »Susan wer?«, wiederholte sie, schüttelte den Kopf, und ich begriff, dass sie über mich lachte.)
Namen. Susan räumte ein, dass sie von einem so langweiligen, gewöhnlichen Namen nie begeistert gewesen war. (»Du siehst nicht aus wie eine Susan«, sagte sie und äffte die vielen Leute nach, die das zu ihr gesagt hatten.) Sie ärgerte sich und korrigierte jeden, der sie Sue nannte. Sie mochte keine Abkürzungen und Spitznamen im Allgemeinen, obwohl sie zu David (den sie nach Michelangelos Statue benannt hatte) oft Dig sagte.
In jenen Jahren hatten weder Mutter noch Sohn Kontakt zum Vater. Doch einmal, als wir zu dritt nach Philadelphia fuhren, wo Susan eine Rede halten sollte und wo Davids Vater inzwischen mit seiner zweiten Frau lebte, sprach Susan David vom Rücksitz an: »Ich denke, du solltest Sigrid Philip vorstellen.« Und bevor wir am nächsten Tag nach New York zurückkehrten, fuhren wir zu Philip Rieffs Haus. Susan wollte im Wagen warten. Wir hatten unseren Besuch nicht angekündigt, und als wir klingelten, öffnete niemand. Aber durch ein kleines Glasfenster in der Haustür konnte man hineinspähen, und David wies mich auf die Gehstocksammlung seines Vaters hin.