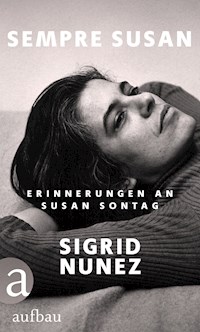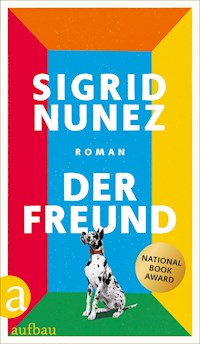9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Sigrid Nunez, Bestseller-Autorin von »Der Freund«, kommt dieser faszinierende, autobiographische Roman über ihre Jugend in New York City.
Eine junge Frau blickt zurück auf ihre Anfänge: den chinesisch-panamaischen Vater und die deutsche Mutter, die sich im Nachkriegsdeutschland begegnen und zusammen nach New York City gehen. In den fünfziger und sechziger Jahren dort aufwachsend, flüchtet sie sich in Träume, die von den Geschichten ihrer Eltern inspiriert sind, und dann in die Welt des Balletts. Eine sehnsüchtige Mutter mit Heimweh nach ihren Wurzeln, ein stiller Vater, den sie kaum kennt, das Tanzen, und die Erfahrung einer ersten Affäre mit Vadim, einem Russen aus Odessa: Das sind die Elemente, die das Leben der jungen Frau prägen. Ein Roman über Eltern und Kinder, Immigration und Liebe – und das Fremdsein in der eigenen Familie.
»Ein kraftvoller Roman von einer Autorin mit ungewöhnlichem Talent.«The New York Times Book Review
»Sigrid Nunez schreibt unwiderstehlich.«Die Zeit
»Ein Genuss von der ersten bis zur letzten Seite.« Jonathan Franzen.
»Nunez' Roman über die Suche nach der eigenen Identität ist hochaktuell. Ihre literarische Spurensuche berührt.« Der Spiegel.
»Ein Kleinod.« Süddeutsche Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Eine junge Frau blickt zurück auf ihre Anfänge: den chinesisch-panamaischen Vater und die deutsche Mutter, die sich im Nachkriegsdeutschland begegnen und zusammen nach New York City gehen. In den fünfziger und sechziger Jahren dort aufwachsend, flüchtet sie sich in Träume, die von den Geschichten ihrer Eltern inspiriert sind, und dann in die Welt des Balletts. Eine sehnsüchtige Mutter mit Heimweh nach ihren Wurzeln, ein stiller Vater, den sie kaum kennt, das Tanzen und die Erfahrung einer ersten Affäre mit Vadim, einem Russen aus Odessa: Das sind die Elemente, die das Leben der jungen Frau prägen. Ein großer Roman über Eltern und Kinder, Immigration und Liebe – und das Fremdsein in der eigenen Familie.
»Sigrid Nunez’ Werke sind mehr als kluge Gedanken einer belesenen Frau, es spricht ein eigener Sound aus ihnen.« Süddeutsche Zeitung
Über Sigrid Nunez
Sigrid Nunez ist eine der beliebtesten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Für ihr viel bewundertes Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Für »Der Freund« erhielt sie den National Book Award und erreichte international ein großes Publikum. Auch ihr Roman »Was fehlt dir« wurde zum Bestseller. Bei Aufbau außerdem lieferbar: »Sempre Susan«, ihr Buch über Susan Sontag. Sigrid Nunez lebt in New York City.
Anette Grube, geboren 1954, lebt in Berlin. Sie ist die Übersetzerin von Arundhati Roy, Vikram Seth, Chimamanda Ngozi Adichie, Mordecai Richler, Yaa Gyasi, Kate Atkinson, Monica Ali, Richard Yates und vielen anderen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sigrid Nunez
Eine Feder auf dem Atem Gottes
Roman
Aus dem Amerikanischen von Anette Grube
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Teil Chang
2. Teil Christa
3. Teil Eine Feder auf dem Atem Gottes
4. Teil Vadim
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
1. Teil Chang
Zum ersten Mal hörte ich meinen Vater in Coney Island Chinesisch sprechen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, aber ich muss noch sehr jung gewesen sein. Es war in den frühen Tagen, als wir noch Familienausflüge machten. Wir gingen die Strandpromenade entlang, als wir den vier chinesischen Männern begegneten. Meine Mutter erzählte die Geschichte oft, als nähme sie an, dass wir sie vergessen hätten. »Ihr Kinder habt sie nicht gekannt und ich auch nicht. Es waren Freunde eures Vaters aus Chinatown. Ihr hattet nie zuvor Chinesisch gehört. Ihr wusstet nicht, was los war. Ihr habt mit offenem Mund dagestanden – ich musste lachen. ›Warum singen sie? Warum singt Daddy?‹«
Einer der Männer gab meinen Schwestern und mir je einen Dollarschein. Ich ließ meinen in Zehn-Cent-Stücke wechseln und machte mich auf, einen Goldfisch zu gewinnen. Mit zehn Cent erkaufte man sich drei Würfe mit einem Pingpongball in eine der vielen kleinen Schalen, in denen je ein zitternder orangefarbener Fisch schwamm. Überaufgeregt warf ich einfach drauflos, wieder und wieder. Als alle Zehn-Cent-Stücke aufgebraucht waren, lief ich weinend zu den Erwachsenen zurück. Der Mann, der mir den Dollar geschenkt hatte, versuchte, mir noch einen zu geben, aber meine Eltern ließen es nicht zu. Er drückte mir die Tüte mit Erdnüssen, die er gegessen hatte, in die Hand und sagte, dass ich sie alle haben könne.
Ich habe keinen dieser Männer je wiedergesehen oder etwas über sie gehört. Es waren die einzigen Freunde meines Vaters, die ich je traf. Ich hörte ihn erneut Chinesisch sprechen, aber nur sehr selten. In chinesischen Restaurants, gelegentlich am Telefon, ein- oder zweimal im Schlaf und im Krankenhaus, als er im Sterben lag.
Es stimmte also. Er war tatsächlich Chinese. Bis zu jenem Tag hatte ich es nicht wirklich geglaubt.
Meine Mutter erzählte immer, dass er auf einem Schiff nach Amerika gekommen war. Er hat ein langsames Schiff von China genommen, sagte sie und lachte. Ich war nicht sicher, ob sie es ernst meinte, und wenn doch, warum es so lustig war, aus China zu kommen.
Ein langsames Schiff von China. Mit der Zeit erfuhr ich, dass er nicht in China, sondern in Panama geboren war. Kein Wunder, dass ich nur halb glaubte, dass er Chinese war. Er war nur halb Chinese.
Ich kenne nur unerträglich wenige Fakten über sein Leben. Obwohl wir achtzehn Jahre lang im selben Haus lebten, hatten wir sehr wenig gemeinsam. Wir hatten keine Kultur gemein. Und es ist nur leicht übertrieben zu behaupten, dass wir auch keine Sprache gemein hatten. Als ich geboren wurde, lebte mein Vater schon fast dreißig Jahre in Amerika, aber wenn man ihn sprechen hörte, konnte man es nicht glauben. Sein Scheitern, die englische Sprache zu lernen, schien mir immer etwas Vorsätzliches zu haben. Abgesehen von ihrem Akzent – so stark wie seiner, aber ganz anders als seiner – hatte meine Mutter keinerlei Probleme damit.
»Er hat nie viel über sich gesprochen. So war er. Er hatte im Allgemeinen nicht viel zu sagen. Schweigen war Gold. Ich glaube, es war was Kulturelles.« (Meine Mutter.)
Als ich alt genug war, es zu verstehen, hatte mein Vater so gut wie aufgehört zu sprechen.
Schweigsamkeit: Es heißt, sie sei ein asiatischer Charakterzug. Doch ich glaube nicht, dass mein Vater immer der schweigsame, verschlossene Mann war, den ich kannte. Man denke nur an den Tag in Coney Island, als er ununterbrochen Chinesisch sprach.
Nahezu alles, was ich über ihn weiß, stammt von meiner Mutter, und es gab viel, das auch sie nicht wusste, viel, das sie vergessen hatte oder nicht genau wusste, und viel, das sie nie erzählte.
Ich bin sechs, sieben, acht Jahre alt, ein Schulmädchen mit erbärmlicher Haltung und ständig aufgesprungenen Lippen, wundgescheuert in den puppenhaften Alte-Welt-Kleidern, die meine Mutter selbst näht; ein rechthaberisches, quengeliges, durchtriebenes, feiges Kind, das zu Wut- und Heulanfällen neigt. In der Schule oder auf dem Spielplatz oder vielleicht im Fernsehen höre ich etwas über Chinesen – etwas Seltsames, Unwahrscheinliches. Ich werde meinen Vater fragen. Er wird wissen, ob es zum Beispiel stimmt, dass Chinesen mit Stäbchen essen.
Er zuckt die Achseln. Er tut so, als würde er nicht verstehen. Oder er blickt finster drein und sagt: »Chinesen genau wie alle anderen.«
(»Er hat geglaubt, dass du dich über ihn lustig machst. Er hat immer geglaubt, dass sich alle über ihn lustig machen. Er hatte einen Komplex. So wie er sich verhalten hat, hätte man glauben können, er wäre ein Schwarzer!«)
Tatsächlich sagte er »andelen«.
Stimmt es, dass die Chinesen rückwärts schreiben?
Chinesen genau wie alle andelen.
Stimmt es, dass sie Hund essen?
Chinesen genau wie alle andelen.
Sind sie wirklich alle Kommunisten?
Chinesen genau wie alle andelen.
Was ist chinesische Wasserfolter? Was heißt die Füße binden? Was ist ein Mandarin?
Chinesen genau wie alle andelen.
Er war nicht wie alle anderen.
Die unerträglich wenigen Fakten sind diese. Er wurde 1911 in Colón, Panama, geboren. Sein Vater kam aus Shanghai. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, war Großvater Chang ein Kaufmann, der mit Tabak und Tee handelte. Aufgrund dieser Geschäfte, die er mit einem seiner Brüder betrieb, reiste er oft zwischen Shanghai und Colón hin und her. Er hatte zwei Frauen, eine in jeder Stadt, und als hegte er eine Leidenschaft für Symmetrie, zwei Söhne von jeder Frau. Bald nachdem mein Vater, Carlos, geboren war, brachte ihn sein Vater nach Shanghai, um ihn von seiner chinesischen Frau aufziehen zu lassen. Zehn Jahre später wurde mein Vater nach Colón zurückgeschickt. Den Grund dafür habe ich nie verstanden. So wie mir die Geschichte erzählt wurde, hatte ich den Eindruck, dass mein Vater fortgeschickt wurde, um einer Gefahr zu entgehen. Es war natürlich eine Zeit des Aufruhrs in China, das Jahrzehnt nach der Gründung der Republik, die Ära der Warlords. Wenn das Datum stimmt, verließ mein Vater Shanghai in dem Jahr, als die Kommunistische Partei Chinas gegründet wurde. Es ist jedoch nicht gewiss, ob politische Ereignisse überhaupt etwas mit seiner Abreise aus China zu tun hatten.
Ein Jahr nachdem mein Vater nach Colón zurückgekehrt war, starb seine Mutter. Ich erinnere mich, als Kind gehört zu haben, dass sie einem Schlaganfall erlag. Jahre später, als ich ausrechnete, dass sie erst sechsundzwanzig gewesen war, erschien mir das merkwürdig. Noch merkwürdiger ist der Gedanke an die Wiedervereinigung von Mutter und Sohn nach langer Trennung; gut möglich, dass sie nicht dieselbe Sprache sprachen. Der andere halb-panamaische Sohn, Alfonso, wurde entweder mit meinem Vater zurückgeschickt oder hatte Colón nie verlassen. Nach dem Tod ihrer Mutter kamen die beiden Jungen in die Obhut des Bruders und Geschäftspartners ihres Vaters, Onkel Mee, der offenbar in Colón lebte und eine eigene große Familie hatte.
Großvater Chang, seine chinesische Frau und ihre beiden Söhne blieben in Shanghai. Es heißt, dass alle von den Japanern umgebracht wurden. Das muss während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs gewesen sein. Mein Vater war damals Ende zwanzig, Anfang dreißig, aber ob er seine Verwandten aus Shanghai vor ihrem Tod jemals wiedergesehen hat, weiß ich nicht.
Mit zwölf oder dreizehn fuhr mein Vater mit Onkel Mee mit dem Schiff nach Amerika. Ich glaube, es waren nur die beiden, die in die USA kamen und den Rest der Familie in Colón zurückließen. Irgendwann im nächsten Jahr wurde mein Vater an einer staatlichen Schule in Brooklyn angemeldet. Ich erinnere mich, ein Schulheft gefunden zu haben, das ihm in jenen Tagen gehört hatte, und über den Namen auf dem Umschlag gestolpert zu sein: Charles Cipriano Chang. Es war weder der Vorname noch der Nachname meines Vaters, soweit ich wusste, und von einem zweiten Namen hatte ich nie gehört. (Schwer zu glauben, dass mein Vater seine Kindheit in Shanghai verbrachte und Carlos genannt wurde, ein Name, den er nicht einmal korrekt spanisch aussprechen konnte. Er musste also zudem einen chinesischen Namen gehabt haben. Und auch wenn unsere Familie diesen Namen nicht kannte, benutzte er ihn vielleicht unter Chinesen.)
Zwanzig Jahre vergingen. Über diese Spanne im Leben meines Vaters weiß ich nur, dass er sie illegal in New York verbrachte, vor allem in Chinatown, wo er in verschiedenen Restaurants arbeitete. Dann kam der Zweite Weltkrieg, und er wurde eingezogen. Während er in der Armee war, wurde er endlich amerikanischer Staatsbürger. Er nannte sich nicht länger Charles, sondern wieder Carlos, und jetzt, da er Staatsbürger war, legte er den Familiennamen seines Vaters ab und nahm den seiner Mutter an. Warum ein Mann, der sich als Chinese betrachtete, der stets unter Chinesen gelebt hatte, der wenig Spanisch sprach und seine Mutter kaum gekannt hatte, in der Mitte des Lebens diese Entscheidung traf, ist eins der vielen Rätsel, die meinen Vater umgeben.
Meine Mutter hatte folgende Erklärung. »Alfonso war panamaischer Staatsbürger, und er hatte den Namen seiner Mutter angenommen.« (Das entsprach natürlich der spanischen kulturellen Tradition.) »Er war das einzige Familienmitglied, das dein Vater noch hatte – alle anderen waren tot. Dein Vater wollte den gleichen Nachnamen haben wie sein Bruder. Und er hat geglaubt, dass er mit einem spanischen Namen in diesem Land besser zurechtkommt.« Für mich ergab das keinen Sinn. Er war zwanzig Jahre lang ein Chinatown-Chang gewesen. Jetzt wollte er auf einmal als Hispano durchgehen?
In einer anderen Version dieser Geschichte wurde die Idee, den chinesischen Namen abzulegen, dem Mann bei der Behörde zugeschrieben, der die Papiere meines Vaters bearbeitete. Das ist plausibel angesichts der Einwanderungsbeschränkungen für Chinesen, die damals noch in Kraft waren. Aber ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass der Namenswechsel die Folge eines Missverständnisses zwischen meinem Vater und dem Beamten war. Mein Vater war leicht zu verwirren, besonders wenn er mit Behörden zu tun hatte, und er hatte immer Mühe, Englisch zu verstehen und sich auf Englisch verständlich zu machen. Und ich kann mir nicht nur vorstellen, dass er verwirrt genug war, diesen Fehler zu begehen, sondern auch, dass er zu ängstlich war, um ihn später zu korrigieren.
Was immer tatsächlich passiert ist, werde ich nie erfahren. Ich weiß allerdings, dass der spanische Name große Konfusion ins Leben meines Vaters brachte, und ich frage mich, inwiefern mein eigenes Leben vielleicht anders verlaufen wäre, hätte er den Namen Chang behalten.
Von diesem Zeitpunkt an wird die Geschichte klarer.
Mein Vater zieht mit der 100. Infanteriedivision in den Krieg, kämpft in Frankreich und Deutschland und wird nach Kriegsende in der kleinen süddeutschen Stadt stationiert, in der er meine Mutter kennenlernen wird. Er ist vierunddreißig, und sie ist gerade achtzehn geworden. Bald ist sie schwanger.
Reicher Stoff für Spekulationen: Wie kommunizierten die beiden? Sie hatte in der Schule ein bisschen Englisch gelernt. Er lernte ein bisschen Deutsch. Sie müssen sich mehr missverstanden als verstanden haben. Vielleicht hilft das zu erklären, warum meine älteste Schwester schon zwei und meine andere Schwester bereits unterwegs war, bevor meine Eltern heirateten. (Meine Schwestern und ich erfuhren davon erst, als wir alle über zwanzig waren.)
Als ich drei war, waren sie bereits zweimal lange getrennt gewesen.
»Ich hätte Rudolf heiraten sollen!« (Meine Mutter.)
1948. Mein Vater kehrt mit seiner Frau und der ersten Tochter in die Vereinigten Staaten zurück. Alles hat sich drastisch verändert. Es ist ein anderes Amerika: das Amerika des Staatsbürgers, des legalen Arbeiters, des Familienvaters. Kein Trinken und Spielen bis in die Puppen in Chinatown mehr. Keine ständigen Jobwechsel, kein Leben von der Hand in den Mund mehr, kein Übernachten auf dem Fußboden im Zimmer eines Freunds oder auf der Ablage einer Restaurantküche. Es gibt neue ungeahnte Ausgaben: Haushaltsgeld, Babyausstattungen, Steuern, Versicherungen, ein spezielles Bankkonto für die Ausbildung der Kinder. Er gibt sein Bestes. Er mietet eine Wohnung in der Sozialbausiedlung in Fort Greene, unweit des kantonesischen Restaurants in der Fulton Street, in dem er als Kellner arbeitet. An manchen Abenden, nachdem das Restaurant geschlossen hat, nachdem alle Tische abgeräumt sind und das Geschirr gespült ist, bleibt er, um zu spielen. Er wankt nach Hause zu einer hellwachen Frau, die den Whiskey in seinem Atem riecht und sich nicht darum kümmert, ob er verloren oder gewonnen hat. So wenig Geld – auch nur mit einem Bruchteil davon zu spielen ist eine Sünde. Ihr Englisch wird besser (»nicht dank ihm!«), doch für das, was sie zu sagen hat, braucht sie kein großes Vokabular. Sie ist unglücklich. Sie hasst Amerika. Sie träumt ständig davon, nach Hause zurückzukehren. Die Dreijährige ist etwas merkwürdig: Sie lächelt nur selten; sie zerkratzt die Seiten von Zeitschriften wie eine Katze. Die Einjährige neigt zu Koliken. Zu ihrem Entsetzen erfährt meine Mutter, dass sie wieder schwanger ist. Sie versucht abzutreiben, vergeblich. Ich werde geboren. Wusste mein Vater von dem versuchten Abbruch? Höchstwahrscheinlich nicht. Hätte er es gewusst, glaube ich zu wissen, was er gesagt hätte. Er hätte gesagt: Nein, diesmal wird es ein Junge. Wie die meisten Männer wünschte er sich einen Sohn. (Nur Mädchen – ein Haus voller Frauen – der Albtraum eines chinesischen Mannes!) Mit einem Sohn wäre er vielleicht offener gewesen. Einem Sohn hätte er vielleicht Chinesisch beigebracht.
Er findet eine andere Arbeit als Tellerwäscher in der Küche eines großen, dem Gesundheitsministerium unterstellten Krankenhauses. Er wird dort bis zu seiner Pensionierung arbeiten, schließlich zum Leiter der Küche befördert.
Er zieht mit der Familie in eine andere Sozialbausiedlung, außerhalb der Stadt, neu gebaut, sauberer, sicherer.
Er arbeitet die ganze Zeit. An Wochenenden, wenn er nicht ins Krankenhaus muss, jobbt er als Kellner in dem einen oder anderen Restaurant. Er arbeitet an den meisten Feiertagen und macht keinen Urlaub. An seinen seltenen freien Tagen bringt er meine Mutter auf die Palme, weil er zum Pferderennen geht. Doch er gönnt sich kaum etwas. Ein bisschen spielen, ein kleines Budweiser zum Abendessen – das er allein einnimmt, ungefähr eine Stunde nach uns (er arbeitete immer bis spät) –, hin und wieder ein Glas Scotch, Zigaretten – das waren seine einzigen Freuden. Als die Kinder noch klein sind, werden gelegentlich Ausflüge unternommen. Nach Coney Island, Chinatown, in den Zoo. Sonntags geht er manchmal mit uns ins Kino, in die Kindervorstellung, und einmal im Jahr in die Radio City Music Hall zur Weihnachts- oder Ostershow. Doch er und meine Mutter gehen nie allein aus, nur sie beide – niemals.
Ihr Englisch wird immer besser, so dass sich seins immer schlechter anhört.
Er ist kaum zu Hause, doch ich erinnere mich, dass sie ständig streiten.
Kein großes Vokabular nötig, um zu verletzen.
»Dumme Frau. Verrückte Frau. Redet, redet, redet – sagt nie nichts.«
»Ich hätte Rudolf heiraten sollen!«
Einmal spuckte sie ihm ins Gesicht. Ein anderes Mal nahm sie ein Brotmesser, und er musste es ihr mühsam entwinden.
Sie schliefen in getrennten Betten.
Jeden Monat verkündete sie den Kindern, dass es vorbei war: Wir würden »nach Hause« gehen. (Und einmal, als ich zwei war, kehrte sie mit uns nach Deutschland zurück. Wir blieben ein halbes Jahr. Über diese Episode sprach sie nur vage. Wann immer wir sie in späteren Jahren fragten, warum wir nicht in Deutschland geblieben sind, sagte sie: »Ihr Kinder wolltet euren Vater.« Aber ich glaube, das stimmt nicht. Wahrscheinlicher war, dass ihr klar wurde, dass dort kein Leben auf sie wartete. Sie war nie gut mit ihrer Familie ausgekommen. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hatte Rudolf schon eine andere geheiratet.)
Obwohl er zwei Jobs hatte, verdiente mein Vater nicht viel. Es reichte nie, um ein Haus zu kaufen. Doch die Last, arm zu sein, schien schwerer auf meiner Mutter zu wiegen. Arm zu sein hieß, sich nie ausruhen zu können, hieß, ständig auf den äußeren Schein achten zu müssen. Kein Geld zu haben bedeutete nicht, zu verwahrlosen. Man komme in die Wohnung: Alles ist sauber und ordentlich. Man schaue die Kinder an: makellos. Und die Leute machten meiner Mutter Komplimente – zum Glanz ihrer Böden und wie sie sich um ihre Kinder kümmerte –, und sie freute sich darüber. Dennoch war es ermüdend, arm zu sein.
Eines Tages klopfte eine Frau, umgeben von einer Schar Kinder, an die Tür. Als meine Mutter öffnete, entschuldigte sich die Frau. »Ich habe gedacht – der Name an Ihrem Briefkasten, ich habe gedacht, Sie sind auch spanisch. Meine Kinder müssten mal auf die Toilette.« Meine Mutter konnte ihr Missfallen nicht verhehlen. Sie war stolz darauf, Deutsche zu sein, und in den Nachkriegsjahren war sie auf verbitterte Weise defensiv. Wenn Leute uns beschimpften – uns Spicks und Chinks nannten –, sagte sie: »Ihr seht ja, wie es in diesem Land ist. Auch wenn alle sagen, wie schlimm wir Deutschen sind, beschimpft uns niemand, nur weil wir Deutsche sind.«
Sie hatte keine Geduld für die Marotten meines Vaters. Das unfreiwillige Zucken eines Muskels bedeutete, dass jemand ihn mit dem bösen Blick bedacht hatte. Ein Glas heißes gekochtes Wasser trinken heilte die Grippe. Er hob alte Ausgaben von Reader’s Digest und Silberdollar bestimmter Jahrgänge auf, weil er glaubte, dass sie eines Tages viel Geld wert wären. Was für ein rückständiges Wesen hatte sie geheiratet? Sein Englisch trieb sie in den Wahnsinn. Wann immer er etwas nicht verstand, das an ihn adressiert war (und das passierte ständig), sagte er statt »Was?« »Huh?« »Huh? Huh?«, kreischte sie ihn an. »Was bist du, eine Eule?«
Andauerndes Hickhack und Gezänk.
Wir Kinder träumten davon, erwachsen zu werden, aufs College zu gehen, zu heiraten, zu entkommen.
Und was war mit Alfonso und Onkel Mee? Was war mit ihnen passiert?
»Ich habe keinen von beiden je kennengelernt, aber von Mee haben wir die ersten Jahre ständig gehört – es war furchtbar. Da war er wieder in Panama. Er war ein schrecklicher Spieler, und seine Söhne waren es auch. Sie steckten bis zum Hals in Schulden – und an wen wandten sie sich, wenn nicht an deinen Vater. Onkel Mir-mich-Mee habe ich ihn genannt. ›Vergiss nicht, was ich alles für dich getan habe. Du schuldest mir was.‹« (Und obwohl sie ihn nie gehört hatte, ahmte sie seine Stimme nach.) »Dein Vater hatte es geschafft, ein paar Tausend Dollar zu sparen, und er hat alles Mee geschickt. Ich wäre am liebsten gestorben. Das habe ich ihm nie verziehen. Ich war damals schwanger, und ich hatte ein einziges Umstandskleid – eins. Kaum hatte Mee das Geld, hat er geschrieben, dass er mehr braucht. Ich habe zu deinem Vater gesagt, dass ich ihn verlasse, wenn er ihm auch nur noch einen Cent schickt.«
Der Streit weitete sich aus und schloss irgendwie auch Alfonso mit ein, der sich offenbar auf Mees Seite schlug. Mein Vater brach mit beiden. Mehrere Jahre nachdem wir Brooklyn verlassen hatten, erschien in einer Chinatown-Zeitung eine Anzeige. Alfonso und Mee versuchten, meinen Vater ausfindig zu machen. Er habe sich nie auf die Anzeige gemeldet, sagte mein Vater. Er habe nie wieder mit den beiden gesprochen. (Vielleicht log er. Vielleicht hatte er immer heimlich Kontakt mit ihnen. Ich glaube, viel von seinem Leben hielt er vor uns geheim.)
Ich habe nie ein Foto von meinem Vater gesehen, das vor seinem Eintritt in die Armee aufgenommen wurde. Ich habe keine Ahnung, wie er als Kind oder junger Mann aussah. Ich habe nie Fotos von seinen Eltern oder seinen Brüdern oder von Onkel Mee oder irgendwelchen anderen Verwandten oder von den Häusern, in denen er in Colón oder Shanghai lebte, gesehen. Sollte mein Vater etwas besessen haben, das seinen Eltern gehört hatte, Familienandenken oder Erinnerungsstücke an seine Jugend, habe ich nichts davon gesehen. Zu seiner Jugend hatte er nichts zu sagen. Nur eine einzige Anekdote erzählte er mir. In Shanghai hatte er einen Hund. Als mein Vater nach Panama abreiste, kam der Hund mit zum Pier, um ihn zu verabschieden. Mein Vater ging an Bord, und der Hund begann zu jaulen. Er vergaß es nie: Das Schiff legte ab, und der Hund jaulte. »Hund nicht dumm. Er weiß, ich nicht zurückkomme.«
In unserer Wohnung gab es nichts Chinesisches. Keine Gegenstände aus Bambus oder Jade. Keine Lackdosen. Keine bemalten Schriftrollen oder Fächer. Keine bestickte Seide. Keine Buddhas. Keine Essstäbchen unter dem Besteck, keine Reis- oder Teeschalen. Keinen chinesischen Tee, keinen Ginseng und keine Sojasoße im Schrank. Mein Vater war das einzige Chinesische, saß wie der Buddha höchstpersönlich zwischen den Hummel-Figuren und Kuckucksuhren und Bildern alpiner Landschaften. Meine Mutter betrachtete die Wohnung als ihre, sprach von ihren Vorhängen, ihren Böden (oft als Warnung: »Verkratzt meine Böden nicht!«). Die Töchter waren auch ihre. Jeder gab sie einen nordischen Namen, den er unmöglich aussprechen konnte. (»Wie nennt dich dein Vater?« Diese Frage – die reinste Agonie für mich – hörte ich während meiner gesamten Kindheit.) Es war Teil ihrer anhaltenden Nostalgie, dass sie ihre Kinder als Deutsche erziehen wollte. Sie nähte Dirndl für sie und auch für ihre Puppen. Sie flocht ihr Haar zu Zöpfen und wand sie im deutschen Stil fest um ihre Ohren wie Ohrenschützer. Wir packten unsere Weihnachtsgeschenke an Heiligabend und nicht am Weihnachtsmorgen aus. Thanksgiving wurde nicht gefeiert. Selbstverständlich wurde kein einziger chinesischer Feiertag begangen. Keine Drachen und kein Feuerwerk zum chinesischen Neujahr. Zu Weihnachten gab es Rotkraut und Sauerbraten. Allein die Vorstellung mein Vater würde Sauerbraten sagen.
Hin und wieder brachte er Essen aus Chinatown mit: scharfe rote Würste mit Fettstückchen darin, eingebettet wie Zähne, getrockneten Fisch, mit Bohnenpaste gefüllte Brötchen, mit denen er uns zum Lachen brachte, weil er chinesische Erdnussbutter sagte. Meine Mutter rührte nichts davon an. (»Gott weiß, was das wirklich ist.«) Wir Kinder forderten lauthals, davon probieren zu dürfen, und wenn es uns nicht schmeckte, wurde mein Vater wütend. (»Du weißt doch, wie er war mit seinem Komplex. Er nahm es persönlich. Er war beleidigt.«) Wann immer wir in einem der Restaurants aßen, in denen er arbeitete, bestellte er für uns stets die amerikanisierten Gerichte, die die meisten weißen Gäste bestellten.
Eine frühe Erinnerung: Ich bin vier, fünf, sechs Jahre alt und schneide in alberner Stimmung Grimassen vor dem Kommodenspiegel meiner Mutter. Mein Vater ist im selben Zimmer, aber ich vergesse, dass er da ist. Ich ziehe mit den Zeigefingern meine Lider in die Länge. Dann sehe ich, dass er mich beobachtet. Sein Blick ist hasserfüllt.
»Er hat gedacht, dass du dich lustig machst.«
Eine spätere Erinnerung: »Panama ist ein Isthmus.« Grundschulgeografie. Mein Vater blickt von der Zeitung auf, wachsam, argwöhnisch. »Merry Isthmus!« »Isthmus muss der Ort sein!« Meine Schwester und ich kreischen vor Lachen. Mein Vater schüttelt den Kopf. »Nicht nett, lustig machen über Ort, wo Leute geboren!«
»Ach, er hatte keinen Sinn für Humor – nie. Er hat nie einen Witz verstanden.«
Tatsächlich habe ich ihn nur selten lachen gehört. (Im Gegensatz zu meiner Mutter, die trotz ihrer chronischen Unzufriedenheit ständig zu lachen schien – über ihn, über uns, über die Nachbarn. Sie stichelte gern, war durchtrieben, boshaft, oft witzig.)
Chinesische Undurchdringlichkeit. Chinesisches Erdulden. Chinesische Zurückhaltung. Ja, ich erkenne meinen Vater in diesen Klischees. Aber was ist mit seiner panamaischen Seite? Wie sind Hispanos angeblich? Heißblütig, lebhaft, gefühlvoll, macho, gesellig, romantisch, leichtsinnig. Nein, er war nichts davon.
»Er wollte immer zurück. Er hat China immer vermisst.«
Aber er war erst zehn, als er China verlassen hat.
»Ja, aber das ist, was zählt – wo du diese ersten Jahre verbringst, und deine Muttersprache. Das bist du.«
Ich hatte ein Kinderbuch über Sun Yat-sen, den Mann, der China veränderte. Darin waren Zeichnungen von Sun als Junge. Ich versuchte, mir meinen Vater so vorzustellen, als chinesischen Jungen, der im Freien eine Pyjamahose und einen Reishut trug und auf dessen Rücken ein Zopf hing. (Obwohl es natürlich in der Zeit nach Suns Revolution unwahrscheinlich war, dass er einen Zopf trug.) Ich stellte mir meinen Vater vor diesen Landschaften mit Berggipfeln und Pagoden vor, mit einem Hund wie Old Yeller zu seinen Füßen. Wie war sie, diese Kindheit in Shanghai? Wie behandelte die chinesische Ehefrau den Sohn der zweiten Frau? (Mein Vater und Alfonso hatten nicht den gleichen Status wie die Söhne der offiziellen Frau, das glaube ich nicht.) Wie behandelten ihn die chinesischen Brüder? Wurde er in der Schule – ging er in die Schule? – von den anderen Kindern als einer der Ihren akzeptiert? Gibt es ein chinesisches Schimpfwort wie »Mischling« und wurde er wie wir damit bezeichnet? Bestimmt hat er sich viele Male im Leben gewünscht, er wäre ganz und gar Chinese. Meine Mutter wünschte, ihre Kinder wären ganz und gar deutsch. Ich wäre gern ein typisch amerikanisches Mädchen mit einem Namen wie Sue Brown gewesen.
Er wollte immer zurück.
Er hat den jaulenden Hund am Pier nie vergessen.
Bei uns zu Hause gab es nicht viele Bücher. Die Liebesgeschichten und historischen Romane meiner Mutter, Bücher über Deutschland (vor allem über die Nazi-Zeit), einen Band Shakespeare, die Märchen von Andersen und den Gebrüdern Grimm, das Nibelungenlied, Edith Hamiltons Mythology, Werke von Goethe und Heine, Der Struwwelpeter, die Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Es war meine Mutter, die mir das Buch über Sun Yat-sen gab und, als ich ein bisschen älter war, eins ihrer Lieblingsbücher, Die gute Erde, eine Kindergeschichte für Erwachsene. Pearl S. Buck war eine Missionarin, die viele Jahre in China lebte. (Angeblich überzeugten Missionare die Changs, zum Christentum zu konvertieren. Von was? Buddhismus? Taoismus? Die Mutter meines Vaters war mit großer Sicherheit römisch-katholisch. Er selbst gehörte keiner Kirche an.) Pearl S. Buck schrieb vierundachtzig Bücher, gründete ein Heim für asiatisch-amerikanische Kinder und gewann den Nobelpreis.
Die gute Erde. China ein Land der Hungersnöte und Plagen – unzählige Geburten eine davon. Die Geburt einer Tochter ein schlechtes Omen. »Diesmal ist es nur eine Sklavin – nicht der Rede wert.« Kleine Mädchen wurden ganz selbstverständlich verkauft. Wuchsen auf, um Konkubinen mit Namen wie Lotus und Kuckuck und Birnenblüte zu werden. Frauen mit Füßen wie die winzigen Hufe eines Rehkitzes. Unterwürfige Ehefrauen, die sechs Schritte hinter ihren Männern trippelten. All das erfüllte mich mit Angst. In unserem Zuhause war der Mann demütig und eingeschüchtert.
Abgesehen von der Zeitung habe ich meinen Vater nie lesen gesehen. Er las die Reader’s Digest nicht, die er sammelte. Er wäre nicht in der Lage gewesen, Die gute Erde zu lesen. Ich bin sicher, dass er in keiner Sprache flüssig schreiben konnte. Je älter ich wurde, umso mehr hielt ich ihn für einen Analphabeten. Es fiel mir schwer, zu akzeptieren, dass er keine Bücher las. Nehmen wir an, ich würde Schriftstellerin. Er würde nicht lesen, was ich schrieb.
Er hatte seinen eigenen Schrank in der Eingangsdiele. Jeden Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, zog er sich, kaum war er durch die Tür, sofort um, draußen in der Diele. Er zog seinen Anzug aus und seinen Bademantel an. Er trug immer einen Anzug zur Arbeit, doch im Krankenhaus zog er einen weißen Arbeitskittel und eine weiße Hose an, und im Restaurant trug er eine schwarze Hose, ein weißes Jackett und eine schwarze Fliege. Auf den wenigen Fotos, die es von ihm gibt, ist er oft in Uniform – in seiner Soldaten-, seiner Krankenhaus- oder seiner Kellneruniform.
Obwohl er nicht eitel war, legte er Wert auf sein Aussehen. Er kaufte seine Anzüge in einem edlen Männerbekleidungsgeschäft in der Fifth Avenue und pflegte sie pedantisch. Er hatte einen Horror vor billigem Stoff und Kunstleder und einen ebensolchen Horror vor Schlamperei. Sein Schrank war vorbildlich aufgeräumt. Im obersten Fach, wo er seine Hüte aufbewahrte, lagerte ein großes Sortiment – ein Vorrat fürs ganze Leben, schien mir – an Kaugummi, Hustenbonbons und Pfefferminzdrops. In diesem Fach lagen auch seine Zigaretten und Zigarren. Der Schrank roch so wie er – nach Tabak und Minze und der Rosenwasser-Glyzerin-Creme, die er für seine trockene Haut benutzte. Kein unangenehmer Geruch.
Er war klein. Mit vierzehn war ich schon so groß wie er, und schließlich sollte ich ihn überragen. Ein adretter Sprössling von einem Mann, zierlich, aber nicht schwächlich, penibel, aber nicht unmännlich. Ich wunderte mich ständig über seine sauberen Fingernägel und seine guten Zähne, die nicht eine Füllung benötigten. Als ich geboren wurde, hatte er sein Haupthaar überwiegend verloren, wodurch seine gewölbte Stirn noch größer wirkte, sein Mondgesicht noch runder. Vielleicht lag es am kupfernen Ton seiner Haut, dass manche Leute ihn für einen indigenen Amerikaner hielten – Leute, die wahrscheinlich nie einen gesehen hatten.