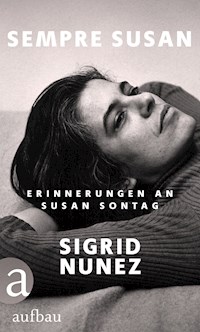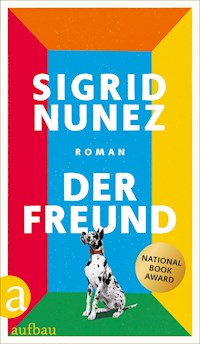9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen zu tun?
Kaum jemand durchdringt das, was es heißt, am Leben zu sein, tiefer, als die amerikanische Autorin Sigrid Nunez. In ihrem neuen Roman »Was fehlt dir« schreibt sie darüber, wie wir einander verbunden sind, in Glück und Trauer, Trost und Zuversicht – und wie Mitgefühl unsere Sicht aufs Leben verändern kann. Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen zu tun? Die New Yorker Erzählerin in Sigrid Nunez’ neuem Roman findet Antworten auf diese Frage in der Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen, ihrer Traurigkeit, ihrem Mut, ihrer Zuversicht: Ob mit einer verflossenen Liebe, einer verunsicherten Airbnb-Gastgeberin oder einer Jugendfreundin, die unheilbar krank ist.
»Was fehlt dir« ist ein Buch über das emphatische Einfühlen und darüber, dass wir viel mehr füreinander tun können, als wir vielleicht meinen: indem wir genau hinhören. Ein Roman, der zugleich ein Porträt davon liefert, was es heißt, gerade jetzt am Leben zu sein. Poetisch und federleicht, ein Buch, das Hoffnung macht – und große Freude.
Der Goldene Löwe für den besten Film auf dem Filmfestival Venedig 2024 geht an den Film »The Room Next Door« des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Der Film basiert auf dem Bestseller »Was fehlt dir« (2021) von Sigrid Nunez.
»Voller Geistesgegenwart und Zärtlichkeit.« PEOPLE.
»Ein profundes Buch.« THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT.
»Ein anmutiger Roman.« THE NEW YORKER.
»Man folgt ihr gespannt bis zur letzten Seite und fühlt sich auf eine sehr zivilisierte Weise getröstet.« JOHANNA ADORJÁN.
»Liebe, Verlust, Freundschaft, Empathie – und so viel Weisheit. Ich verehre Sigrid Nunez.« PAULA HAWKINS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Der neue Roman der Bestseller-Autorin von »Der Freund« »Voller Geistesgegenwart und Zärtlichkeit.« PEOPLE »Ein anmutiger Roman.« THE NEW YORKER »Man folgt ihr gespannt bis zur letzten Seite und fühlt sich auf eine sehr zivilisierte Weise getröstet.« JOHANNA ADORJÁN »Liebe, Verlust, Freundschaft, Empathie – und so viel Weisheit. Ich verehre Sigrid Nunez.« PAULA HAWKINS »Ein profundes Buch.« THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT Kaum jemand durchdringt das, was es heißt, am Leben zu sein, tiefer, als die amerikanische Autorin Sigrid Nunez. In ihrem neuen Roman »Was fehlt dir« schreibt sie darüber, wie wir einander verbunden sind, in Glück und Trauer, Trost und Zuversicht – und wie Mitgefühl unsere Sicht aufs Leben verändern kann. Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen zu tun? Die New Yorker Erzählerin in Sigrid Nunez’ neuem Roman findet Antworten auf diese Frage in der Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen, ihrer Traurigkeit, ihrem Mut, ihrer Zuversicht: Ob mit einer verflossenen Liebe, einer verunsicherten Airbnb-Gastgeberin oder einer Jugendfreundin, die unheilbar krank ist. »Was fehlt dir« ist ein Buch über das emphatische Einfühlen und darüber, dass wir viel mehr füreinander tun können, als wir vielleicht meinen: indem wir genau hinhören. Ein Roman, der zugleich ein Porträt davon liefert, was es heißt, gerade jetzt am Leben zu sein. Poetisch und federleicht, ein Buch, das Hoffnung macht – und große Freude.
Über Sigrid Nunez
Sigrid Nunez ist eine der beliebtesten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Für ihr viel bewundertes Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Für ihren Roman "Der Freund" erhielt sie 2018 den National Book Award und erreichte international ein großes Publikum. Im Aufbau Verlag ist außerdem ihr Buch „Sempre Susan. Erinnerungen an Susan Sontag“ erschienen. Sigrid Nunez lebt in New York City.
Über Anette Grube
Anette Grube, geboren 1954, lebt in Berlin. Sie ist die Übersetzerin von Arundhati Roy, Vikram Seth, Chimamanda Ngozi Adichie, Mordecai Richler, Yaa Gyasi, Kate Atkinson, Monica Ali, Richard Yates und vielen anderen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sigrid Nunez
Was fehlt dir
Roman
Aus dem Amerikanischen von Anette Grube
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Erster Teil
»Die Fülle der Nächstenliebe besteht einfach in der Fähigkeit, den Nächsten fragen zu können, welches Leiden quält dich.«
Simone Weil
1
Ich machte mich auf den Weg, um mir den Vortrag eines Mannes anzuhören. Die Veranstaltung fand auf einem College-Campus statt. Der Mann war Professor, aber er lehrte an einem anderen College, in einem anderen Teil des Landes. Er war ein weithin bekannter Autor, der Anfang des Jahres einen internationalen Preis gewonnen hatte. Doch obwohl die Veranstaltung kostenlos und der Öffentlichkeit frei zugänglich war, füllte sich das Auditorium nur zur Hälfte. Auch ich war nur aufgrund eines Zufalls im Publikum, in dieser Stadt. Eine Freundin von mir lag in einem örtlichen Krankenhaus, das auf die Behandlung ihres besonderen Typs von Krebs spezialisiert war. Ich war gekommen, um diese Freundin, diese alte, mir sehr liebe Freundin, zu besuchen, die ich seit mehreren Jahren nicht gesehen hatte und angesichts der Schwere ihrer Krankheit vielleicht auch nicht wiedersehen würde.
Es war die dritte Woche im September 2017. Über Airbnb hatte ich ein Zimmer gemietet. Die Gastgeberin war eine pensionierte Bibliothekarin, eine Witwe. Aus ihrem Profil wusste ich, dass sie vier Kinder und sechs Enkelkinder hatte und ihre Hobbys unter anderem Kochen und Theaterbesuche waren. Sie lebte im obersten Stock einer Anlage mit Eigentumswohnungen in ungefähr dreieinhalb Kilometer Entfernung vom Krankenhaus. Die Wohnung war sauber und aufgeräumt und roch leicht nach Kreuzkümmel. Die Einrichtung des Gästezimmers war so, wie offenbar die meisten übereingekommen sind, dass der Mensch sich wohlfühlt: kleine flauschige Teppiche, ein Bett mit einer Hecke aus Kissen und einer dicken Daunendecke, ein Tischchen, darauf ein Keramikkrug mit getrockneten Blumen, und auf dem Nachttisch ein Stapel Taschenbuchausgaben von Krimis. Die Art Zimmer, in der ich mich nie wohlfühle. Was die meisten Leute heimelig – gemütlich, hygge – nennen, finden andere erdrückend.
Eine Katze war versprochen worden, aber ich sah keine Spur von ihr. Erst später, als ich abreiste, erfuhr ich, dass die Katze meiner Gastgeberin zwischen meiner Buchung und meiner Ankunft gestorben war. Sie teilte es mir brüsk mit, wechselte sofort das Thema, so dass ich sie nicht danach fragen konnte – was ich in der Tat hatte tun wollen, weil ich aufgrund ihres Verhaltens den Eindruck hatte, dass sie danach gefragt werden wollte. Mir kam der Gedanke, dass sie nicht wegen ihrer Gefühle einfach so das Thema wechselte, sondern eher aufgrund der Sorge, dass ich mich später beschweren könnte. Triste Gastgeberin sprach zu viel von toter Katze. Die Sorte Kommentar, die man ständig auf der Website findet.
Ich trank Kaffee in der Küche, aß etwas von dem Tablett mit Snacks, das die Gastgeberin für mich bereitgestellt hatte (während sie sich, so, wie es Airbnb-Gastgebern empfohlen wird, rar machte), und studierte die Korktafel, an der sie für Gäste Flyer mit Veranstaltungshinweisen aufgehängt hatte. Eine Ausstellung mit japanischen Drucken, eine Arts-and-Crafts-Messe, Gastauftritte einer Tanzkompanie aus Kanada, ein Jazzfestival, ein karibisches Kulturfestival, ein Veranstaltungsplan des örtlichen Sportstadions, eine Lesung. Und an diesem Abend um halb acht der Vortrag des Autors.
Auf dem Foto sieht er hart aus – nein, »hart« ist zu hart. Sagen wir streng. Er sieht aus wie viele weiße Männer ab einem gewissen Alter: völlig weißes Haar, Hakennase, schmale Lippen, durchdringender Blick. Wie ein Raubvogel. Wohl kaum anziehend. Wohl kaum ein Bild, das vermittelt: Bitte, komm und hör dir meinen Vortrag an. Würde dich gern sehen! Sondern eher: Täusch dich nicht, ich weiß viel mehr als du. Du solltest mir zuhören. Vielleicht verstehst du dann, wo’s langgeht.
Eine Frau stellt ihn vor. Die Institutsleiterin, die ihn eingeladen hat. Sie ist ein vertrauter Typ: Die hippe Akademikerin, der intellektuelle Vamp. Jemand, der unbedingt mitteilen will, dass sie, obwohl schlau und gebildet, obwohl Feministin und eine Frau in einer Machtposition, keine Schabracke, kein langweiliger Nerd, keine geschlechtslose Xanthippe ist. Und was macht es da schon, dass sie ein bestimmtes Alter überschritten hat. Der eng sitzende Rock, die Höhe der Absätze, der knallrote Mund und das gefärbte Haar (ich habe einmal einen Friseur sagen hören: Ich glaube, es behindert das Denkvermögen einer Frau, wenn sie graue Haare hat), all das sagt: Ich bin noch immer bereit für Sex. Eine schlanke Figur, die höchstwahrscheinlich bedeutet, dass sie die meiste Zeit Hunger hat. Diesen Frauen geht mit trauriger Regelmäßigkeit durch den Kopf, dass Intellektuelle in Frankreich Sexsymbole sein können. Auch wenn das Symbol bisweilen peinlich ist (Bernard-Henri Lévy und seine nicht zugeknöpften Hemden). Diese Frauen erinnern sich, als Kinder gequält worden zu sein, nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen ihrer Intelligenz. »Männer mögen keine Brillenschlangen« meinte schlaue Mädchen, Mädchen, die Bücher lesen, sich für Mathematik oder Naturwissenschaften begeistern. Die Zeiten ändern sich. Wer mag heutzutage keine Brillen. Wie weit verbreitet sind heute Männer, die damit angeben, dass sie sich zu schlauen Frauen hingezogen fühlen. Oder wie ein junger Schauspieler vor Kurzem sagte: Meine Meinung war schon immer, dass die sexyesten Frauen die mit dem größten Verstand sind. Woraufhin ich, ich gestehe es, die Augen so sehr verdrehte, dass ich den Kopf jäh nach vorn kippen musste, um wieder richtig sehen zu können.
Sie kann unmöglich stimmen, nicht wahr, die Geschichte, dass Toscanini während einer Probe mit einem Sopran die Geduld verlor, an ihre Brüste fasste und rief: Wenn sie nur Gehirne wären!
Später hieß es: »Männer mögen keine Frauen mit fetten Ärschen.«
Ich sehe sie vor mir, diesen Mann und diese Frau, beim kollegialen Abendessen, das sicherlich auf die Veranstaltung folgen wird und das, weil er ist, wer er ist, ein gutes sein wird, in einem der teuersten Restaurants der Stadt, und bei dem sie wahrscheinlich nebeneinandersitzen werden. Und selbstverständlich wird die Frau auf ein intensives Gespräch hoffen – keinen Smalltalk –, vielleicht sogar auf einen kleinen Flirt, aber das wird sich als nicht so einfach erweisen, da seine Aufmerksamkeit immer wieder zu der Doktorandin abschweifen wird, die als seine Eskorte abgestellt ist, ihn von Ort zu Ort chauffiert, auch nach dem Essen zurück in sein Hotel, und die nach nur einem Glas Wein auf seine vielen kurzen Blicke mit eigenen zunehmend gewagteren Blicken reagiert.
Sieht aus, als würde das mit Toscanini stimmen. Ich habe es gegoogelt. Doch laut mancher Berichte fasste er nicht an die Brüste des Soprans, sondern deutete nur darauf.
Während der obligatorischen Aufzählung der Verdienste des Redners senkt der Mann den Blick, setzt eine Miene des Unbehagens auf und heuchelt Bescheidenheit, von der ich bezweifle, dass jemand sie ernst nimmt.
Wenn Noten mehr davon abhingen, wie viel ich in Vorlesungen gelernt hätte als bei der Lektüre von Texten, hätte ich beim Studium versagt. Wenn ich lese oder jemandem bei einem Gespräch zuhöre, kann ich mich fast immer konzentrieren, aber Vorträge jeder Art waren schon immer ein Problem (am schlimmsten ist es, wenn ein Autor aus seinem eigenen Werk vorliest). Meine Gedanken schweifen nahezu sofort ab, wenn der Redner beginnt. An diesem Abend war ich zudem ungewöhnlich zerstreut. Ich war den ganzen Nachmittag bei meiner Freundin im Krankenhaus gewesen. Ich war vollkommen erschöpft, weil ich hatte zusehen müssen, wie sie litt, und mich ständig bemüht hatte, mir meine Bestürzung angesichts ihres Zustandes nicht anmerken zu lassen und vor ihr zu verbergen. Mit Krankheit umzugehen: Darin bin ich nie gut gewesen.
Meine Gedanken schweiften also ab. Von Anfang an. Ich verlor mehrmals den roten Faden des Vortrags. Doch es war nicht wichtig, denn der Vortrag des Mannes basierte auf einem langen Artikel, den er für eine Zeitschrift geschrieben hatte, und ich hatte den Artikel gelesen, als er erschienen war. Ich hatte ihn gelesen, alle, die ich kannte, hatten ihn gelesen. Meine Freundin im Krankenhaus hatte ihn gelesen. Ich vermutete, dass auch die meisten im Publikum ihn gelesen hatten. Mir ging durch den Kopf, dass zumindest einige von ihnen gekommen waren, weil sie Fragen stellen, eine Diskussion dessen hören wollten, was der Mann zu sagen hatte, auch wenn sie das Wesentliche bereits aus dem Artikel kannten. Aber der Mann hatte die ungewöhnliche Entscheidung getroffen, keine Fragen zu beantworten. Es würde an diesem Abend keine Diskussion geben. Das erfuhren wir jedoch erst, nachdem er seinen Vortrag beendet hatte.
Es ist vorbei, sagte er. Er zitierte einen anderen Schriftsteller, übersetzte aus dem Französischen: Der Wald geht dem Menschen voraus; die Wüste folgt ihm. Was immer getan werden musste, um die Katastrophe zu verhindern, welche Aktionen unternommen und welche Opfer gebracht werden mussten, es war klar, dass der Menschheit der Wille fehlte, der kollektive Wille, sie anzugehen. Jedem intelligenten Außerirdischen, sagte er, mussten wir wie besessen von einem Todeswunsch erscheinen.
Es ist vorbei, sagte er. Nicht länger der Glaube und der Trost, die Generationen über Generationen aufrechterhalten haben, nicht länger das Wissen, dass das, was wir lieben und uns etwas bedeutet, weiterbestehen wird, dass die Welt, von der wir ein Teil sind, Bestand hat, auch wenn unsere individuelle Lebenszeit auf Erden enden muss – diese Zeit ist vorbei, sagte er. Unsere Welt und unsere Zivilisation haben keinen Bestand, sagte er. Mit diesem Wissen müssten wir leben und sterben.
Unsere Welt und unsere Zivilisation hätten keinen Bestand, sagte er, weil sie die vielen Kräfte nicht überleben könnten, die wir selbst gegen sie entfesselt hatten. Wir, unser eigener schlimmster Feind, hatten uns selbst zur leichten Beute gemacht, zugelassen, dass Waffen, die uns alle mehrfach töten konnten, nicht nur entwickelt wurden, sondern auch in die Hände von Egomanen, Nihilisten, Menschen ohne Empathie, ohne Gewissen gerieten. Dank unseres Versagens, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu kontrollieren und diejenigen von der Macht fernzuhalten, für die ihr Einsatz nicht nur vorstellbar war, sondern vielleicht eine unwiderstehliche Versuchung darstellte, wurde ein apokalyptischer Krieg immer wahrscheinlicher.
Wenn wir verschwinden, sagte der Mann, werden wir nicht von einer Rasse edler und intelligenter Affen ersetzt werden, so schön der Gedanke auch sein mag. Es ist vielleicht tröstlich, sich einzubilden, dass der Planet eine Chance hat, wenn es keine Menschen mehr gibt. Doch leider ist auch das Tierreich zum Untergang verurteilt, sagte er. Obwohl sie das Böse nicht erschaffen haben, sind die Affen und alle anderen Geschöpfe mit uns verloren – das heißt diejenigen, die menschliche Aktivitäten nicht bereits ausgerottet haben.
Aber nehmen wir einmal an, es gebe gar keine nukleare Bedrohung, sagte der Mann. Nehmen wir einmal an, dass das Nukleararsenal der ganzen Welt wie durch ein Wunder über Nacht pulverisiert würde. Wären wir nicht trotzdem mit Gefahren konfrontiert, die generationenübergreifende menschliche Dummheit, Kurzsichtigkeit und die Fähigkeit zur Selbsttäuschung heraufbeschworen haben?
Die Industriellen im Sektor der fossilen Energieträger, sagte der Mann. Wie viele sind es, wie viele sind wir? Es ist nicht zu fassen, dass wir, ein freies Volk, Bürger einer Demokratie, sie nicht aufgehalten, nicht Front gegen sie gemacht haben, gegen diese Menschen und ihre politischen Verbündeten, die so beharrlich daran arbeiten, den Klimawandel zu leugnen. Und ebendiese Leute haben bereits Milliarden an Profiten eingestrichen und gehören zu den reichsten Menschen, die je gelebt haben. Aber wenn die mächtigste Nation der Welt sich auf ihre Seite schlägt, sich an vorderster Front der Leugner positioniert, was für eine Hoffnung für den Planeten Erde gibt es dann noch. Zu glauben, dass die Massen von Flüchtlingen, die vor dem durch die globale ökologische Katastrophe erzeugten Mangel an Nahrung und sauberem Wasser fliehen, dort, wohin sie ihre Verzweiflung treibt, auf Mitgefühl treffen werden, ist absurd, sagte der Mann. Im Gegenteil, wir würden bald eine Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen in einem Maßstab erleben, der alles bislang Erlebte in den Schatten stellte.
Der Mann war ein guter Redner. Auf dem Pult vor ihm lag ein iPad, auf das er hin und wieder blickte, doch statt den Text abzulesen, sprach er, als hätte er jede Zeile auswendig gelernt. In dieser Hinsicht war er wie ein Schauspieler. Ein guter Schauspieler. Er war sehr gut. Kein einziges Mal zögerte er oder stolperte über ein Wort, aber ebenso wenig wirkte sein Vortrag eingeübt. Ein Talent. Er sprach mit Autorität und war absolut bestechend, sichtlich überzeugt von allem, was er sagte. Wie in dem Artikel, den ich gelesen hatte und auf dem der Vortrag basierte, stützte er seine Behauptungen mit zahlreichen Verweisen. Doch er hatte auch etwas an sich, das ausstrahlte, dass es ihm nicht wirklich wichtig war, ob er überzeugte oder nicht. Bei seinem Vortrag ging es nicht um Ansichten, sondern um unwiderlegbare Fakten. Es war gleichgültig, ob wir ihm glaubten oder nicht. Und da es so war, kam es mir merkwürdig vor, wirklich und wahrhaftig merkwürdig, dass er diesen Vortrag überhaupt hielt. Da er vor leibhaftigen Menschen sprach, Menschen, die gekommen waren, um ihn zu hören, hatte ich erwartet, dass er einen anderen Ton anschlagen würde als den, an den ich mich aus dem Zeitschriftenartikel erinnerte. Ich hatte erwartet, dass er an diesem Abend, wenn schon nicht zuversichtliche, dann zumindest nicht ausschließlich dem Weltuntergang verpflichtete Punkte vorbringen würde; zumindest eine zukunftsweisende Geste, einen Funken, wenn auch nur einen Funken Hoffnung. Also etwa so: Jetzt, da ihr aufmerksam zuhört, jetzt, da ich euch zu Tode erschreckt habe, lasst uns darüber reden, was getan werden kann. Warum sonst überhaupt zu uns sprechen? Ich war mir sicher, dass andere Zuhörer genauso empfanden.
Cyberterrorismus. Bioterrorismus. Die unvermeidliche nächste große Grippepandemie, auf die wir genauso unvermeidlich nicht vorbereitet waren. Unheilbare Killerinfektionen aufgrund wahlloser Verabreichung von Antibiotika. Der Aufstieg rechtsextremer Regime überall auf der Welt. Die Normalisierung von Propaganda und Täuschung als politische Strategie und Basis für Regierungspolitik. Die Unfähigkeit, den globalen Dschihadismus zu besiegen. Bedrohungen des Lebens und der Freiheit – von allem, das die Bezeichnung Zivilisation verdient – nehmen überhand, sagte er. Knapp dagegen sind die Mittel, sie zu bekämpfen.
Und wer wollte glauben, dass die Konzentration von so gewaltiger Macht in den Händen von ein paar wenigen Tech-Firmen – ganz zu schweigen vom System der Massenüberwachung, von dem ihre dominante Stellung und ihre Profite abhingen – im besten Interesse der Zukunft der Menschheit sei. Wer wollte ernsthaft daran zweifeln, dass die Werkzeuge dieser Firmen nicht eines Tages zu den bemerkenswert effektiven Mitteln zur Erreichung der denkbar ruchlosesten Zwecke würden. Doch wie hilflos stehen wir vor diesen Tech-Göttern und Herren, meinte er. Es ist eine gute Frage, sagte er: Wie viel mehr Opioide kann das Silicon Valley sich noch einfallen lassen, bevor alles vorbei ist. Wie wäre das Leben, wenn das System dafür sorgte, dass das Individuum nicht einmal mehr die Option hätte, nein dazu zu sagen, überall verfolgt, ständig angeschrien und herumgestoßen zu werden wie ein Tier im Käfig. Noch einmal, warum hatte ein angeblich freiheitsliebendes Volk das zugelassen? Warum waren die Menschen nicht außer sich allein schon angesichts der Idee des Überwachungskapitalismus? Zu Tode erschrocken über Big Tech? Ein Außerirdischer, der eines Tages unseren Zusammenbruch studieren würde, könnte zu der Schlussfolgerung gelangen: Die Freiheit war zu viel für sie. Sie wollten lieber Sklaven sein.
Jemand, der die Rede des Mannes nur gelesen hätte, statt ihn sprechen zu hören und vor sich zu sehen, hätte ihn sich wahrscheinlich ganz anders vorgestellt, als er tatsächlich an diesem Abend war. Angesichts der Worte, ihrer Bedeutung, der entsetzlichen Fakten, hätte er sich wahrscheinlich eine Zurschaustellung von Emotionen vorgestellt. Nicht diese ruhigen, rhythmischen Sätze. Nicht diese leidenschaftslose Maske. Nur einmal sah ich ein kurzes Aufflackern von Gefühl: Als er von den Tieren sprach, ein leichtes Stocken in seiner Stimme. Mit Menschen schien er kein Mitleid zu haben. Während er sprach, schaute er hin und wieder über sein Pult und ließ seinen Raubvogelblick über das Publikum schweifen. Später meinte ich zu verstehen, warum er keine Fragen zulassen wollte. Waren Sie jemals bei einer Diskussion, bei der nicht mindestens eine Person eine gedankenlose Bemerkung gemacht oder eine völlig unwichtige Frage gestellt hat, die darauf schließen ließ, dass sie überhaupt nicht zugehört hatte? Ich konnte verstehen, dass so etwas für ihn nach diesem Vortrag unerträglich gewesen wäre. Vielleicht hatte er Angst, die Beherrschung zu verlieren. Denn natürlich waren sie da: Unter der Coolness, der Beherrschung, waren sie zu spüren. Tiefe, vulkanische Emotionen. Die, würde er sich gestatten, sie auszudrücken, aus seinem Kopf speien und uns alle in Asche verwandeln würden.
Auch das Verhalten der Zuhörer hatte etwas Seltsames, Groteskes sogar, fand ich. Diese Unterwürfigkeit angesichts des grimmigen Porträts ihrer Zukunft, des noch grimmigeren Schicksals, das ihre Kinder angeblich erwartete. Diese Ruhe und höfliche Aufmerksamkeit, als hätte der Redner nicht eine Zeit beschrieben, in der in einer grausamen Umkehrung der natürlichen Ordnung zuerst die Jungen die Alten beneiden würden – ein Zustand, den wir bereits erreicht hatten, laut ihm – und dann die Lebenden die Toten.
Und dann auch noch zu klatschen, aber das taten wir, ich nehme an, dass es noch seltsamer gewesen wäre, es nicht zu tun – doch jetzt nehme ich etwas vorweg.
Vor dem Applaus, vor dem Ende des Vortrags, sprach der Mann etwas an, das auf der glatten Oberfläche ein Kräuseln verursachte. Ein Murmeln ging durch das Publikum (das er ignorierte), die Leute veränderten ihre Haltung auf den Stühlen, und ich bemerkte hier und da ein Kopfschütteln und aus einer Reihe irgendwo hinter mir das nervöse Auflachen einer Frau.
Es ist vorbei, sagte er. Es ist zu spät, wir haben zu lange gezaudert.
Unsere Gesellschaft sei bereits zu zersplittert und dysfunktional, um die verhängnisvollen Fehler, die wir begangen hatten, rechtzeitig wiedergutzumachen. Und zudem sei die Aufmerksamkeit der Menschen flüchtig. Weder ein Jahr nach dem anderen mit Extremwetter noch das Risiko, eine Million Tierarten auf der Welt auszurotten, konnten die Umweltzerstörung nach ganz oben auf die Liste der Probleme unseres Landes katapultieren. Und wie traurig, sagte er, mitanzusehen, wie so viele Mitglieder der kreativsten und gebildetsten Klassen, von denen wir uns einfallsreiche Lösungen erhofft hatten, stattdessen eine Therapie machten und sich pseudoreligiösen Praktiken widmeten, die Abgeklärtheit, Konzentration auf den Augenblick, Akzeptanz der Welt, wie sie war, Gleichmut im Angesicht weltlicher Belange propagierten. (Diese Welt ist nur ein Schatten, sie ist ein Kadaver, sie ist nichts, diese Welt ist nicht wirklich, verwechsle diese Halluzination nicht mit der wirklichen Welt.) Selbsfürsorge, Bewältigung der eigenen alltäglichen Ängste, Vermeidung von Stress sind zum höchsten Ziel unserer Gesellschaft geworden, sagte er – offensichtlich höher als die Rettung der Gesellschaft selbst. Der Achtsamkeitswahn ist nur eine weitere Ablenkung, sagte er. Selbstverständlich sollten wir gestresst sein, sagte er. Furcht sollte uns verzehren. Achtsame Meditation könne einer Person helfen, dem Ertrinken mit Gleichmut zu begegnen, aber sie helfe nicht dabei, die Titanic wieder aufzurichten. Nicht individuelle Anstrengung, inneren Frieden zu finden, nicht eine mitfühlende Haltung gegenüber anderen hätten zu rechtzeitigen Präventivmaßnahmen führen können, sondern eine kollektive, fanatische, gesteigerte Obsession für den bevorstehenden Untergang.
Es ist sinnlos zu leugnen, sagte der Mann, dass uns Leiden immensen Ausmaßes bevorsteht, dem wir nicht entkommen können.
Wie also sollten wir leben?
Eine Frage, die wir uns als Erstes stellen müssen, ist, ob wir weiterhin Kinder kriegen sollten.
(An dieser Stelle das Unbehagen, das ich bereits erwähnt habe: Murmeln und Bewegung auf den Stühlen, das nervöse Lachen der Frau. Zudem war dieser Teil neu. Das Thema Kinder war in dem Zeitschriftenartikel nicht vorgekommen.)
Um es klarzustellen, er meine nicht, dass jede Frau, die ein Kind erwartete, eine Abtreibung in Betracht ziehen sollte, sagte er.
Selbstverständlich meinte er das nicht. Was er meinte, war, dass vielleicht die Art der Familienplanung, wie sie seit Generationen erfolgte, überdacht werden müsse. Er meinte, dass es vielleicht ein Fehler sei, menschliche Wesen in eine Welt zu bringen, die zu ihren Lebzeiten wahrscheinlich zu einem öden und schrecklichen, wenn nicht gar unbewohnbaren Ort würde. Er fragte, ob es nicht egoistisch und vielleicht sogar unmoralisch und grausam sei, einfach blind weiterzumachen und so zu tun, als bestünde diese Möglichkeit kaum oder gar nicht.
Und gibt es schließlich, fragte er, nicht bereits zahllose Kinder auf der Welt, die verzweifelt Schutz vor bereits bestehenden Bedrohungen suchen? Gibt es nicht Abermillionen Menschen, die unter unterschiedlichen humanitären Krisen leiden, die Abermillionen anderer Menschen einfach lieber vergessen? Warum können wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Menschen richten, die leiden und von denen es mitten unter uns nur so wimmelt?
Hier liegt vielleicht unsere letzte Chance, uns zu rehabilitieren, sagte der Mann und hob die Stimme. Der einzige moralisch sinnvolle Kurs für eine Zivilisation, die mit ihrem eigenen Ende konfrontiert ist: Zu lernen, um Vergebung zu bitten und in winzigem Maßstab Abbitte zu leisten für das Leid, das wir der Menschheitsfamilie, allen anderen Geschöpfen und unserer wunderschönen Erde angetan haben. Einander zu lieben und zu vergeben, so gut wir können. Und zu lernen, uns zu verabschieden.
Der Mann nahm sein iPad vom Pult und verließ rasch die Bühne. Dem Rhythmus des Klatschens war anzuhören, dass das Publikum verwirrt war. War es das gewesen? Würde er noch einmal zurückkommen? Doch die Frau, die ihn vorgestellt hatte, betrat jetzt die Bühne, dankte allen für ihr Kommen und wünschte uns einen schönen Abend.
Und dann standen wir auf und verließen wie eine Herde das Auditorium, strömten aus dem Gebäude in die frische Abendluft, die, obwohl es bislang offiziell eines der wärmsten Jahre überhaupt war, die perfekte Temperatur für diesen Monat in diesem Teil der Welt hatte.
Ich brauche was zu trinken, sagte jemand in meiner Nähe. Antwort: Ich auch!
Die aufbrechende Menge hatte etwas Bedrücktes. Manche Leute schienen benommen und schwiegen. Andere machten Bemerkungen zu der fehlenden Diskussion. Das ist so arrogant, sagte jemand. Vielleicht war er sauer, weil der Saal nicht voll war, sagte jemand anders.
Ich hörte: Was für ein Langweiler.
Und: Es war deine Idee zu kommen, nicht meine.
Ein älterer Mann im Mittelpunkt einer Gruppe älterer Leute brachte alle zum Lachen. He! Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei-hei. Ich dachte, da oben steht Roy Orbison.
Ich hörte: Melodramatisch … Unverantwortlich.
Und: Absolut richtig, jedes Wort.
Und (aufgebracht): Kannst du mir bitte sagen, was das sollte?
Ich beschleunigte den Schritt, ließ die Leute hinter mir, ging jedoch etwa gleich schnell wie ein Mann, den ich aus dem Publikum wiedererkannte. Er trug einen dunklen Anzug, Joggingschuhe und eine Baseballmütze. Er war allein, und pfiff beim Gehen ausgerechnet »My Favorite Things«.
Ich brauche was zu trinken. Um ehrlich zu sein, hatte ich es schon gedacht, bevor ich es jemand sagen hörte. Ich wollte etwas trinken, bevor ich in die Wohnung zurückkehrte, bevor ich ins Bett ging. Ich hatte beschlossen, vom Campus zu Fuß zurückzugehen, so, wie ich auch hingegangen war (es waren nur eineinhalb Kilometer), und ich wusste, dass ich unterwegs an mehreren Lokalen vorbeikommen würde, wo ich etwas trinken könnte – ich wollte ein Glas Wein. Doch ich war fremd in der Stadt und unsicher, wo ich, wenn überhaupt, allein etwas trinken gehen konnte, ohne mich unwohl zu fühlen.
Überall, wo ich schaute, war es entweder zu voll oder zu laut oder aus einem anderen Grund nicht einladend. Ein Gefühl der Einsamkeit und Enttäuschung überkam mich. Es war ein vertrautes Gefühl. Ich dachte an eine Frau, von der ich wusste, dass sie angefangen hatte, immer einen Flachmann mitzunehmen. Ich war bereit aufzugeben, als mir einfiel, dass an der Ecke zur Straße meiner Gastgeberin ein Café war, das leer gewesen war, als ich zuvor daran vorbeigegangen war, und in dem, wie ich gesehen hatte, Wein serviert wurde.
Jetzt war das Café natürlich nicht mehr leer. Doch von der Straße aus sah ich, dass zwar alle Tische besetzt, aber an der Bar noch Plätze frei waren.
Ich ging hinein und setzte mich. Ich erlebte einen Augenblick der Panik, weil der Barkeeper, ein junger Mann mit kunstvollen Tätowierungen und der Art Gesichtsbehaarung, die mich an ein Konversationsstück erinnerten, mich ignorierte, obwohl er niemand anderen bediente. Ich nahm mein Handy heraus, diese verlässliche Requisite, und beschäftigte mich ein paar Momente damit.
Raindrops on roses and whiskers on kittens.
Endlich schlenderte der Barkeeper zu mir (ich war demnach nicht durchsichtig geworden) und nahm meine Bestellung entgegen. Endlich hatte ich etwas zu trinken. Rotwein: eins meiner Lieblingsdinge. Mit einem Glas Wein würde es nach diesem langen Tag, der mir so viel zum Nachdenken eingebracht hatte, einfacher, meine Gedanken zu sortieren. Doch ich wurde sofort von einem Gespräch abgelenkt, das an dem Tisch direkt hinter mir stattfand. Zwei Personen, die ich nicht sehen konnte, außer, ich würde mich umdrehen. Ich drehte mich nicht um. Doch bald schon wurde mir klar, worum es ging.
Vater und Tochter. Die Mutter war tot. Sie war ein Jahr zuvor nach langem Kampf mit einer Krankheit gestorben. Es war eine jüdische Familie. Es war Zeit für die Enthüllung des Grabsteins. Die Tochter war für die Zeremonie angereist. Der Vater sprach leise, kaum lauter als ein Murmeln. Die Tochter sprach lauter und lauter, bis sie – zum Teil, weil der Barkeeper die Musik immer wieder lauter stellte – nahezu schrie.
Es war so schwer für deine Mutter.
Ich weiß, Dad.
Was sie durchgemacht hat.
Ich weiß. Ich war dabei.
Sie war tapfer. Aber so tapfer kann niemand sein.
Ich weiß, Dad, ich war dabei. Ich war die ganze Zeit dabei. Ich habe gehofft, wir könnten darüber sprechen. Du weißt, wie es war, Dad. Ich habe mich um alles gekümmert. Du hast dir wegen Mom solche Sorgen gemacht, und sie hat sich wegen dir Sorgen gemacht. Ich weiß, wie schwer es für euch beide war.
Ich weiß, wie schwer es für sie war.
Ich habe gehofft, dass wir darüber sprechen könnten, Dad. Ich habe damals selbst so viel durchgemacht – das hat keiner wirklich mitgekriegt. Du und Mom, ihr wart füreinander da, und ich war für euch beide da. Aber für mich war niemand da. Ich musste meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, und damit haben wir uns nie beschäftigt. Meine Therapeutin sagt, dass ich deswegen so viele Probleme habe.
(Unhörbar.)
Ich weiß, Dad. Aber ich will sagen, dass es auch für mich schwer war und noch immer ist, und für mich ist es wichtig, dass das anerkannt wird. Die ganze Zeit, und immer noch, es wirkt sich jeden Tag auf mein Leben aus. Meine Therapeutin sagt, dass ich das klären muss.
Ich finde, die Trauerfeier ist gut gegangen. Was meinst du?
Als ich in der Wohnung meiner Gastgeberin ankam, saß sie mit einer Tasse Tee am Küchentisch.
Ich habe Sie gesehen, sagte sie – und brachte mich durcheinander.
Bei dem Vortrag, sagte sie. Dort habe ich Sie gesehen.
Oh, sagte ich. Ich habe Sie nicht gesehen.
Sie haben weit hinten gesessen, sagte sie, und ich ganz vorn. Ich war mit einer Freundin dort, und sie will immer ganz vorn sitzen. Ich habe Sie gesehen, als Sie gegangen sind. Haben Sie noch irgendwo was gegessen?
Ja, log ich und kam mir lächerlich vor. Weil ich mich schämte zuzugeben, dass ich etwas getrunken hatte? Seitdem ich das Krankenhaus verlassen hatte, war ich nicht in der Lage gewesen, irgendetwas zu essen aufgrund dessen, was ich dort gesehen – und gerochen – hatte.
Sie bot an, mir Tee zu machen, ich lehnte ab.