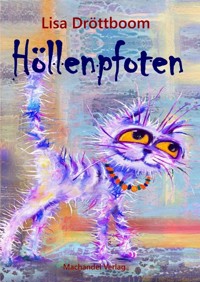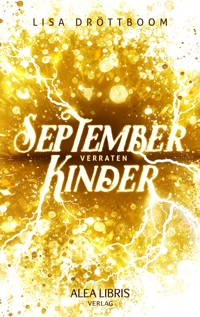
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alea Libris
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Septemberkinder
- Sprache: Deutsch
In einer Welt ohne Kunst ist schon ein Tanz tödlich. Ein Stromschlag verändert Bens Leben drastisch. In ihm erwachen kinetische Kräfte, die von der deutschen Regierung gefürchtet und mit dem Tod bestraft werden. Ben versucht daher, seine neuen Fähigkeiten zu verbergen, doch die Kontrolle entgleitet ihm immer mehr. Bald kann er nicht länger für die Sicherheit seiner Familie garantieren. Verzweifelt beschließt er, sein Leben selbst zu beenden. Doch kurz davor hält ihn ein Kinet auf. Keno lebt seit Jahren auf der Straße und hat den Kampf gegen die Regierung und ihre Unterdrückung der Kunst aufgenommen. Er handelt mit Ben einen Deal aus: Einen Monat lang soll er dem Leben eine letzte Chance geben und sich Keno und seinen Kameraden anschließen. Ehe er sich versieht, findet sich Ben zwischen dem täglichen Überlebenskampf, Patrouillen der Schutzwache und seinem eigenen Gefühlschaos wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SEPTeMBERKINDER
Verraten
Lisa Dröttboom
1. Auflage, 2022
© Alea Libris Verlag, Wengenäckerstr. 11, 72827 Wannweil
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Michael KrummISBN: 9783945814949
Druck: CPI Ebner & Spiegel GmbH
© Covergestaltung:
Viktoria Lubomski
Bildrechte:
eakgaraj
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Personen und die Handlung des Buches sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Für alle Septemberkinder
Gebt nicht auf. Es wird besser.
Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn Sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.
Vorwort
Der September 2010 ist ein besonderer Monat, vor allem in den Reihen der LGBTQ-Community. Zu diesem Zeitpunkt ereignete sich in den USA eine Reihe von tragischen Selbstmorden. Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren nahmen sich – unabhängig voneinander – das Leben, weil sie homosexuell waren oder dafür gehalten wurden. Die Opfer der sogenannten »September suicides« (September-Selbstmorde) sind als »septembers children« (Septemberkinder) bekannt.
Erst Jahre später hat mich ein Lied auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Neugierig geworden habe ich mich in die Recherchen gestürzt und so die Basis für diese Geschichte gefunden. Auch wenn meine Septemberkinder hier eine andere Bedeutung haben, greift das Buch viele Themen der eigentlichen Septemberkinder auf. Daher möchte ich an dieser Stelle für einige Themen sensibilisieren, die für manche Menschen problematisch sein könnten:
Zentraler Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte sind Mobbing und seine Auswirkungen. Es wird Mobber geben, Mitläufer und solche, die wegsehen. Suizidale Gedanken und Suizidversuche werden thematisiert. Ferner kämpfen manche Personen in dem Buch mit Alkoholismus und dem Verlust eines Elternteils. Auch gibt es eine Szene, in der Figuren gefoltert werden.
Am Ende des Buches steht jedoch dieselbe Botschaft, die auch die Band Rise Against in ihrem Lied »Make it stop« findet: Don’t give up, it gets better – Gebt nicht auf. Es wird besser.
Prolog
Wer sich von seiner Angst fesseln und bestimmen lässt,
der ist ein Gefangener.
Die Ketten abzustreifen und man selbst zu sein,
das ist der Inbegriff von Freiheit.
01. September
Ein Schrei ließ Ben aus seinen Gedanken schrecken. Ruckartig drehte er den Kopf und beugte sich vor, um aus dem Fenster sehen zu können. Zwei Jungen jagten sich lachend über die Straße. Der vordere schrie erneut auf, als sein Freund ihn beinahe erwischte. Er wand sich außer Reichweite und sprintete in die entgegengesetzte Richtung.
Ben seufzte und lehnte sich zurück. Von seinem Tablet leuchtete ihm der Grundriss eines Gebäudes entgegen. Darin befand sich ein Fehler, den er seit einer halben Stunde verzweifelt suchte.
Er tippte auf ein kleines Symbol und schob die Zeichnung damit auf den Fernseher. Nachdenklich drehte er die Skizze um ihre eigene Achse. Auf dem großen Bildschirm ließen sich die einzelnen Zahlen, Winkel und Linien besser erkennen.
Er fand eine kleine Ungenauigkeit und beseitige sie. Trotzdem zeigte das Programm weiter an, dass das Gebäude zusammenbrach, wenn er es so bauen würde. Irgendetwas an der Formel musste falsch sein, die Frage blieb nur, was.
Frustriert speicherte er die Fortschritte der letzten halben Stunde. In nicht einmal zwei Wochen musste er sein Projekt abgeben. Ein Blick würde den Professoren genügen, um festzustellen, dass die Kapelle wie ein Kartenhaus zusammenfiel.
Lag es an der Kuppel?
Er zoomte den entsprechenden Teil des Entwurfes heran. Ein weiteres Mal ging er die Berechnungen, Maße und Winkel Schritt für Schritt durch. Er konnte keinen Fehler finden und dennoch trugen die Wände die Last nicht.
Ben wechselte in die Innenansicht der Kapelle. Vielleicht half ihm eine neue Perspektive, dem Fehler auf die Spur zu kommen. Doch als ihm eine Idee kam, hörte er das Klimpern eines Schlüsselbundes.
Nur ein paar Sekunden später wurde die Haustür so hart aufgestoßen, dass sie gegen den Stopper an der Wand prallte. Schuhe flogen durch die Luft, eine Jacke wurde ausgezogen und in Richtung Garderobe geworfen. Ben schüttelt den Kopf und versuchte, sich wieder auf sein Projekt zu konzentrieren.
Sein Bruder randalierte wie eine Horde wilder Berserker in der Küche herum. Ben starrte auf seine Zeichnung, ohne etwas zu sehen. In seinem Kopf hallte nur der Lärm wider.
»Ach, du bist heute hier?« Manu hob eine Augenbraue, als er ihn entdeckte. Er kam ins Wohnzimmer, eine Milchpackung in der Hand, und ließ sich auf die Couch fallen. »Gar nicht in der Uni?«
Ben schüttelte den Kopf. Er hatte die Ruhe im Haus nutzen wollen, um seine Bauzeichnung auf dem Fernseher unter die Lupe zu nehmen. Schweigend beobachtete er, wie sich Manu die Fernbedienung schnappte. Die Zeichnung verschwand und auf Bens Tablet erschien eine Fehlermeldung.
»Ich habe gerade gearbeitet«, sagte er leise.
»Papa hat gesagt, nur solange keiner den Fernseher nutzen will«, erwiderte Manu und setzte die Milchpackung an seine Lippen.
Ben startete das Programm auf seinem Tablet neu. »Du hättest mir Bescheid geben können«, murmelte er.
»Ich bin hier, oder nicht? Das reicht ja wohl als Warnung.« Manus Stimme war desinteressiert und genervt. Er zappte wild durch die Kanäle. Bei den Nachrichten blieb er für einen Moment hängen. Schwelende Gebäudegerippe zierten die Mattscheibe, während eine Reporterin von den neuesten Attacken der Kineten berichtete. Seine Lippen verzogen sich zu einem schmalen Strich. »Die muss man gezielt ausräuchern«, sagte er missbilligend.
Ben wandte den Kopf und starrte aus dem Fenster. In der Ferne konnte er den Rauch sehen, der sich in dunklen Wolken am Randbezirk zusammenballte. Den ganzen Tag über hatte er Explosionen gehört. Eine Fabrik war in die Luft geflogen. Die Regierung ging davon aus, dass Kineten die Ursache für die Flammen waren, die plötzlich aus dem Gebäudedach schlugen.
Er war jedes Mal zusammengezuckt, wenn ein Donnern über die Stadt gefegt war. Die Fabrik lag nah am Randbezirk, wie auch ihre Siedlung. Die Kineten könnten genauso schnell bei ihnen sein und Häuser anzünden. Er verbot sich den Gedanken daran.
Manu zappte weiter, schien jedoch nichts zu finden. Also startete er den Streamingdienst und suchte einen Film heraus. Zufrieden lehnte er sich zurück und stellte den Ton lauter. Wenige Minuten später hallten die Geräusche explodierender Gebäude und der Lärm von Schusswaffen durch das Wohnzimmer.
Ben schüttelte den Kopf. In den Nachrichten lief eine Endlosschleife aus Hinrichtungen und Katastrophenberichten. Am Horizont türmten sich fast täglich Wolken aus Asche und Ruß auf, trotzdem wurde Manu der Kriegsfilme nicht leid. Als wäre das Leben nicht schon grausam genug. Zumal das Ende der Filme vorhersehbar war: Die Kineten verloren immer.
Er gab es auf, weiter am Projekt zu arbeiten, und holte sich etwas zu trinken. Von der Küche aus hörte er seinen Bruder lachen und mit den Soldaten reden. Ben überlegte, ob er sich in seinem Zimmer noch einmal vors Tablet setzen sollte, als es an der Tür klingelte.
Er zögerte, doch da Manu nicht reagierte, ging er zur Haustür. Draußen stand seine Kommilitonin Helena. Überraschung huschte über ihre Züge, als sie Ben in der Tür entdeckte. Ihre Wangen färbten sich tiefrot und sie strich sich verlegen das blonde Haar aus dem Gesicht. »Oh, hallo Ben«, stammelte sie. »Ist Manu da?«
Ben nickte und deutete in Richtung Wohnzimmer. Zögerlich drückte sie sich an ihm vorbei und eilte zu seinem Bruder. Ben schloss die Tür, während der Lärm abrupt verstummte. Manu begrüßte Helena herzlich.
»Du hast gesagt, wir wären allein«, sagte sie vorwurfsvoll.
Bittersüßer Schmerz durchzuckte Ben. Darum hatte sie ihn nach einem Monat Beziehung in den Wind geschossen. Es beruhigte sein schlechtes Gewissen, sich nicht genug um sie bemüht zu haben. Zwischen Manu und ihr hatte es gefunkt, als Ben sie das erste Mal mit nach Hause gebracht hatte. Als sein Bruder die Tage mit seiner heißen, neuen Freundin geprahlt hatte, hätte er den Wink mit dem Zaunpfahl begreifen müssen.
Manu zuckte mit den Schultern. »Es ist doch nur Ben.«
Nur Ben … für seinen Bruder war er schon immer nur Ben gewesen. Jemand, den man schnell vergaß.
Er seufzte und holte sein Tablet aus dem Wohnzimmer. Helena warf ihm einen verlegenen Blick zu. Immerhin schien ihr die Situation peinlich zu sein. Er zwang sich zu einem freundlichen Lächeln und zog sich in sein Zimmer zurück.
Ben warf sich aufs Bett und zoomte die Kuppel seiner Kapelle heran. Gedankenverloren starrte er die Zeichnung an. Dreizehn Tage bis zur Abgabe und sein Projekt war noch immer voller Fehler. Sollte er Philip um Hilfe bitten?
Er schickte seinem Kommilitonen eine Nachricht und versuchte, sich zu konzentrieren. Wieder begann er, die Zahlen zu überprüfen, nahm sich jede zur Brust. Er zog seine Bücher heran und prüfte die Formeln.
Wenig später lenkte ihn Helenas albernes Kichern im Flur ab. Er hörte, wie die beiden die Treppe hinaufkamen und in Manus Zimmer verschwanden. Ihre Stimmen drangen dumpf durch die Wand.
Ben stöhnte, als kurz darauf ein rhythmisches Klopfen ertönte. Spätestens jetzt war es vorbei mit seiner Konzentration. Er schaltete das Tablet aus und drehte sich auf den Rücken. Die Decke war mit Sternen gespickt, ein Überbleibsel seiner Kindheit.
Widerwillig lauschte er den Geräuschen aus dem Nachbarzimmer. Sein Körper war zum Zerreißen gespannt, seine Hände gruben sich in die Bettdecke. Warum traf Manu Helena hier?
Er wollte nicht dabei sein, ihnen zuhören. Seine Muskeln schmerzten, so stark baute sich der Widerstand in ihm auf. Das rhythmische Klopfen wurde in seinen Ohren immer lauter. Abrupt schoss er aus dem Bett und verließ sein Zimmer. Er schnappte sich Jacke, Schlüssel und schlüpfte in seine Schuhe. Sobald ihm die frische Nachmittagsluft um die Nase strich, durchströmte ihn Erleichterung.
Er holte seinen Drahtesel und schwang sich in den Sattel. Sein Wohnviertel lag am Rand der Stadt, in der Nähe des stillgelegten Industriegeländes und unweit des gefährlichen Randbezirks. Die meisten Wege waren Spielstraßen, auf denen mehr auf Kinder als auf Autos geachtet werden musste.
Ben schlug automatisch den Weg ein, der ihn zu den Gleisen führte. Sie schlängelten sich zwischen den letzten Häusern hindurch und suchten sich ihren Weg entlang der Fabrikgebäude. Verlassene Hallen reihten sich in der trostlosen Gegend aneinander.
Seit der Säuberung vor rund zwölf Jahren arbeitete hier niemand mehr. Die Kriege hatten das Industriegebiet zerfleischt. Es war nun ein Ödland aus leeren Gebäuden, dass die Grenze zwischen den Wohnvierteln und dem Randbezirk bildete. Die Häuser waren teilweise eingestürzt, die Scheiben eingeschlagen. Rostende Bauelemente ragten aus dem Mauerwerk. Die Straßen lagen ausgestorben da. Pflanzen brachen durch den Asphalt. Einzig die Schienen wurden regelmäßig genutzt und gepflegt.
Ben liebte die Ruhe in dem Teil der Stadt. Hier musste er Manu weder beim Sex noch bei den lautstarken Diskussionen mit seinen Freunden zuhören. Am schlimmsten waren die Debatten darüber, welche Todesart für Kineten die angemessenste war. Sie waren gefährlich, das stand außer Frage. Aber am Ende waren es infizierte Menschen - keine Figuren in einem Computerspiel.
Er bog auf eine kleine Seitenstraße ein und näherte sich dem verlassenen Firmengelände. Neben der Fabrik mit flachem Dach erhob sich ein mehrstöckiger Kastenbau. Beide Gebäude waren einst mit einer Brücke verbunden. Nun wirkte es, als hätte sie ein Riese herausgerissen und zu Boden geworfen. Die Trümmer ragten wie Speere in die Luft.
Ben rollte in den Hinterhof, in dem früher die Lastwagen entladen worden waren. Halb verwitterte Paletten und Kisten stapelten sich zu kleinen Türmen. Er schloss sein Fahrrad an einer Laterne an und lauschte aufmerksam. Bis auf das leise Rauschen der Straßen in weiter Ferne konnte er nur die Natur hören. Kein verdächtiges Geräusch.
Vorsichtshalber drehte er eine Runde über den Hof. Der wirkte unangetastet, wie er ihn bei seinem letzten Besuch zurückgelassen hatte. Zufrieden trat er an einen der Palettenstapel entlang der Fabrikmauer.
Er schob seine Hand in einen Spalt zwischen den Paletten und tastete sich vor bis zur Wand. Rau fühlte sich der Putz unter seinen Fingerspitzen an. Er fand das faustgroße Loch und zog die Plastiktüte hervor. Darin verbarg sich sein wertvollster Besitz - der Grund, warum er sich regelmäßig in den Sattel schwang und die halbe Stunde hierher radelte.
Ein schwarzer Musikplayer, der nicht größer als eine Streichholzschachtel war. Ben hatte ihn auf dem Dachboden in den Sachen seiner Mutter gefunden. Sie hatte ihn entgegen den Gesetzen nicht entsorgt, sondern gut versteckt für sich behalten.
Die Zeit hatte dem kleinen Gerät übel mitgespielt und den Bildschirm zerstört, doch es war noch immer funktionstüchtig. Erwartungsvoll steckte Ben sich die Kopfhörer in die Ohren und wartete sehnsüchtig auf die erste Note.
Als sie endlich erklang, durchströmte ihn Erleichterung. Jedes Mal, wenn er hierherkam, fürchtete er, der Player würde nicht mehr funktionieren. Doch er trotzte seit Jahren hartnäckig Wind und Wetter in seinem Plastikbeutel.
Ben entfernte sich von den Paletten und drehte die Musik lauter. Er kannte die Lieder in der Playlist in- und auswendig. Vermutlich beherbergte der Player noch mehr, doch er traute sich nicht, blind danach zu suchen. Am Ende fand er nicht zu dieser Liste zurück und konnte gar keine Musik mehr hören.
Mit geschlossenen Augen lauschte er den ersten Takten. Sein Fuß begann sich von allein im Rhythmus zu bewegen, wippte erst auf und ab, suchte sich dann seinen Weg über den nassen Asphalt. Nach und nach übernahmen die Noten auch die Kontrolle über den Rest seines Körpers.
Er ließ sich von der Musik leiten, tanzte völlig zwanglos. Der Stress der letzten Tage bröckelte ab: die beiden Klausuren, die anstanden, das fehlerhafte Projekt, Manus Verhalten und die angespannte Situation zuhause. Er löste sich davon mit jeder Bewegung, geleitet durch die Lieder.
Sie halfen ihm, den Druck in seinem Inneren abzubauen. Nur so konnte er die Gefühle, die sich in ihm ansammelten, wieder loswerden. Das Tanzen war für ihn wie ein Rausch, der alles andere lächerlich erscheinen ließ.
Nach dem zweiten Lied blieb Ben erlöst stehen. Seine Brust hob und senkte sich aufgeregt, während die Musik in seinen Knochen vibrierte. Seine Gedanken hatten sich beruhigt, waren träge geworden. Das Gefühl, gleich zu platzen, war verschwunden.
Philip konnte ihm sicherlich helfen, den Fehler zu finden. Ansonsten würde ihm ein anderer Weg einfallen, das Problem zu beheben. Notfalls musste er die Kuppel entfernen und einen neuen Entwurf zeichnen. Ihm blieben immer noch zwei Wochen, in denen nur die Klausuren und das Projekt zählten.
Zufrieden schob er die Gedanken beiseite. Er genoss die erfrischende Abendluft bei den schlechter werdenden Lichtverhältnissen. Der Geruch von Regen lag in der Luft, der Herbst eilte mit langen Schritten auf die Stadt zu.
Ben mochte den Herbst, das fallende Laub und das Rascheln. Die Tiere, die sich auf den Winterschlaf vorbereiteten und der Regen, der gegen die Scheiben prasselte. Die Welt wurde geschäftig und aufregend, wenn die kalten Tage kamen.
Sein Finger schwebte unsicher über den Tasten seines Players. Er rang mit sich, drückte dann auf Play. Ein Lied konnte er noch spielen, dann wurde es zu gefährlich.
Dieses Mal war er verspielter. Er probierte aus, ob er zu altbekannten Noten neue Bewegungen finden konnte. Auf seinen Lippen lag ein gelöstes Lächeln.
Dann jedoch erhellten Scheinwerfer einen Teil des Hinterhofes. Ben erstarrte. Sein Herz setzte kurz aus und begann dann panisch zu rasen. Angespannt sah er in Richtung Hofeinfahrt. Das Auto rumpelte die unebene Einfahrt entlang auf ihn zu. Glücklicherweise versperrten Paletten, Kisten und ein Wagenwrack den Weg. Während der Wagen zum Stehen kam, eilte Ben zu der Wand. Ihm blieb keine Zeit mehr, den Player zurück in sein Versteck zu legen. Doch er schob die Plastiktüte so weit wie möglich zwischen die Paletten und entfernte sich dann rasch von dem Holzstapel.
Er flüchtete durch den Hof, fort von der Einfahrt.
»Halt, stehen bleiben!«
Ben warf einen schnellen Blick über seine Schulter. Ein Mann stand in der Einfahrt, eine Hand schützend vor den Augen, um trotz der Abendsonne sehen zu können.
Ben wurde nicht langsamer. Wenn er beim Tanzen gesehen worden war, erwarteten ihn nur Ärger und harte Strafen. Darauf konnte er gut verzichten.
»Halt! Polizei!« Der Ruf drang leise an seine Ohren, als er um die Ecke verschwand.
Von Polizisten beim Tanzen erwischt zu werden, war eins der Horrorszenarien, die er sich täglich ausmalte. Nun würde er erst recht nicht mehr stehen bleiben. Wenn er schnell genug war, entkam er dem Polizisten vielleicht.
Leider hatte er die Rechnung ohne die junge Polizistin gemacht. Sie war ihrem Kollegen nicht gefolgt. Stattdessen sprang sie Ben vor die Füße, als er um die nächste Ecke biegen wollte. Hart packte sie ihn an den Oberarmen und nutzte seinen eigenen Schwung, um ihn zu Boden zu werfen.
Mit einem Schlag entwich die Luft aus seinen Lungen. Ben japste und rang um Atem, leistete keinerlei Widerstand. Sie hatten ihn erwischt, der Kampf war vorbei. Er ließ sich von ihr zu Boden drücken und die Handschellen anlegen.
»Keine Dummheiten mehr!«, zischte sie.
Er nickte. Sie musterte ihn mit schmalen Augen, dann half sie ihm wieder auf die Beine, hielt aber seinen Arm fest. »Wie heißt du, Junge?« Der Polizist, der gerade erst zu seiner Kollegin aufgeschlossen hatte, schaute ihn mit kühlem Blick an.
»Ben Portz«, murmelte Ben ergeben.
»Ausweis dabei?«
Ben nickte. »In meiner Brusttasche.« Der Polizist öffnete den Reißverschluss und zog sein Portemonnaie heraus. Er schrieb sich die Personalien auf und trat dann ein paar Schritte weg, um sie bei der Zentrale prüfen zu lassen.
Die Polizistin musterte ihn derweil. »Warum hast du die Flucht angetreten?«
Bens Herz schlug ihm bis zum Hals. Er wusste, wie viel jetzt von seinem schauspielerischen Talent und den richtigen Worten abhing. »Weil ich nicht hier sein sollte«, gestand er mit schuldiger Miene.
»So?« Die Polizistin hob eine Augenbraue.
»Naja, der Randbezirk ist nicht mehr weit entfernt. Es ist gefährlich und … ich … ich will nicht für einen Sympathisanten der Kineten gehalten werden«, druckste er herum.
»Warum lungerst du dann hier herum?«
Eine wirklich gute Frage, dachte er. Ihm kam eine Idee, wie er die Situation noch zu seinen Gunsten drehen konnte. Allein der Gedanke trieb ihm die Röte ins Gesicht. »Ich … ähm … habe Capoeira geübt«, gestand er dann.
Die Stille, die seinen Worten folgte, war bedrückend. Bens Herz raste. Die Ungewissheit erschwerte ihm das Atmen, während sein ganzer Körper vor Anspannung steif wurde.
»Capoeira«, wiederholte die Polizistin ungläubig.
Ben nickte. Der Kampfsport, der bis vor einigen Jahren noch als Kampfkunst gegolten hatte, war seine Chance. Die Bewegungen waren geschmeidig und leichtfüßig, ähnelten ein wenig seinem Tanzstil.
Der Polizist trat wieder zu ihnen. Seine Kollegin sah ihn an. »Er behauptet, es war Capoeira.«
Auch die Augenbrauen des Mannes wanderten in die Höhe. Sein Blick wanderte über Bens dürre Gestalt. »Wieso gehst du nicht in eine Kampfschule?«
Ben schlug den Blick nieder und starrte auf den unebenen Erdboden zu seinen Füßen. Fieberhaft suchte er nach einer zufriedenstellenden Antwort. »Da blamiere ich mich nur.« Er zuckte mit den Achseln. Sollte er es mit Mitleid versuchen? »Ich wollte etwas trainieren. Mein Bruder geht bald zur Schutzwache und ich will ihn nicht beschämen.«
Das Schlimmste an seiner Geschichte war, dass sie verdammt nah an der Wahrheit lag. Ben hatte eine Zeit lang eine Kampfschule besucht. Allerdings war er nach drei Wochen wieder ausgetreten, weil er nicht länger verprügelt werden wollte.
Seitdem zog Manu ihn damit auf, wie unsportlich und talentfrei er war. Sein älterer Bruder lebte für sämtliche Kampfsportarten, trieb sich täglich in der Kampfschule herum und verfolgte jeden Beitrag im Fernsehen. Es wunderte niemanden, dass er zur Schutzwache gehen wollte.
Ben wagte einen Blick zu den Polizisten. Die Mundwinkel der Frau zuckten, als versuche sie, ein Lächeln zu verbergen. Ja, irgendwie amüsierte das jeden. Sie schaute ihren Kollegen an. »Was sagt die Zentrale?«
»Kein Eintrag. Der Junge ist noch nie irgendwo aufgefallen.« Der Polizist überlegte kurz. »Lass ihn uns nach Hause bringen. Dann können wir überprüfen, ob seine Geschichte stimmt.«
Seine Kollegin nickte und führte Ben zum Wagen. Nach einem warnenden Blick löste sie die Handschellen und bedeutete ihm, einzusteigen. »Was ist mit meinem Fahrrad?«, fragte Ben zögerlich.
»Kannst du die Tage abholen.«
Wenn es dann noch da war, dachte Ben, gab sich jedoch geschlagen. Er stieg ein und schnallte sich an. Die Polizisten wechselten ein paar Worte miteinander, dann setzte sich der Mann zu ihm auf die Rückbank, während seine Kollegin hinter dem Lenkrad Platz nahm. Nun wurde er also wie ein ausgerissener Teenager nach Hause gebracht. Hoffentlich war Manu nicht mehr zuhause, wenn er ankam.
Der Wagen setzte sich in Bewegung und holperte über den unebenen Asphalt. Ben schwieg und versuchte, die beiden Polizisten auszublenden, obwohl er den prüfenden Blick des Mannes auf sich ruhen spürte. Er betete, dass niemand die Paletten untersuchte, bis er die Gelegenheit gehabt hat, seinen Musikplayer in der Lücke zu verstecken. Wenn die Polizisten zurückkehrten …
Die beiden Beamten unterhielten sich entspannt, als wäre Ben nicht anwesend. Ein wiederkehrendes Thema ihres Gespräches waren die Kineten und ihr Angriff auf die Fabrik. Er versuchte, nicht hinzuhören. Jeder sprach darüber: die Medien, die Verkäufer, seine Kommilitonen und Professoren, selbst die Kinder auf der Straße. Es mochte sein, dass ihre unkontrollierbaren Fähigkeiten eine Bedrohung waren, aber deshalb mussten sie nicht allgegenwärtig sein.
Ob sein Vater schon zuhause war? Wenn Ben eines nicht glaubte, dann, dass er von ihm Unterstützung erwarten durfte. Egal, in was für einen Zustand er ihn antraf.
Sein Vater wollte keinen Ärger mit der Polizei. Er würde für keinen seiner Söhne lügen. Die Vergangenheit hatte ihn gebrandmarkt. Vor allem würde er seine Hand nicht für seinen schwächlichen Sohn ins Feuer legen.
»He, Portz!«
Ben schreckte aus seinen Gedanken. Die Polizistin musterte ihn durch den Rückspiegel. »Ja?« Seine erste Antwort ging jedoch im Verkehrslärm unter. Die Gesetzeshüterin warf dem Auto, das ihr soeben die Vorfahrt genommen hatte, einen bösen Blick zu und murmelte etwas. »Ja«, wiederholte Ben lauter.
»Wieso willst du kämpfen lernen?«
Ben brauchte nicht lange, um sich eine Antwort zu überlegen. »Falls ich mich gegen einen Kineten verteidigen muss.«
»Du glaubst, du hättest eine Chance gegen Kineten?« Skeptisch zog sie eine Augenbraue hoch.
Ben lachte leise und schüttelte den Kopf. »Nein, aber wenn ich ein paar Sekunden für mich herausschlagen kann, hat es sich doch gelohnt, oder nicht? Dann war mein Training nicht umsonst.«
»Du solltest die Schutzwache informieren und flüchten, wenn du einen siehst«, merkte der Polizist stirnrunzelnd an.
Ben schenkte ihm ein schwaches Lächeln. »Kämpfen ist sicher nicht meine erste Wahl«, murmelte er. Der Mann nickte und wandte sich wieder nach vorne, um mit seiner Kollegin zu quatschen.
Die restliche Fahrt ließen ihn die beiden in Ruhe. Ben hüllte sich in Schweigen und beobachtete die Menschen auf der Straße. Der Himmel wurde allmählich dunkler, während die Stadt zu leuchten begann.
Der Streifenwagen drängelte sich zwischen den Autos hindurch. Ein Grund, warum Ben die Hauptstraßen mied und das Industriegebiet vorzog. Trotz der Obdachlosen, Straßenkinder und Kineten war es dort deutlich ruhiger.
Bens Kopf sank gegen die Nackenlehne. Er schloss die Augen und versuchte, den Frieden vom Tanzen festzuhalten. Er wünschte sich zurück auf den Hinterhof. Erst als der Lärm draußen abnahm, öffnete er seine Lider wieder.
Der Streifenwagen bog in die Spielstraße ein, in der er wohnte. Hüfthohe Hecken verdeckten die Vorgärten. Der Asphalt war mit Kreidebildern übersät. Das Haus, in dem er den größten Teil seines Lebens verbracht hatte, hatte ein schiefergraues Dach. Das Weiß der Wände war über die Jahre hinweg ergraut. Ein paar kreisrunde Abdrücke von Fußbällen zierten den Putz.
Im Vorgarten stand eine bunte Kinderschaukel, die nur die Nachbarskinder manchmal nutzten. Unter den weiß-grünen Blättern des Bäumchens neben der Tür versteckte sich ein Rentier. Das Getier aus Reisig war ein Überbleibsel des letzten Weihnachtsfests und in Vergessenheit geraten.
Die Polizistin parkte quer hinter dem schwarzen Firmenwagen. Ben runzelte die Stirn. Noch nicht einmal neun Uhr und sein Vater war schon zuhause? Hatte er keinen Grund mehr gefunden, länger in der Firma zu bleiben?
Er wartete, bis die Polizisten ihn aufforderten, auszusteigen. Die Frau packte ihn hart am Oberarm, als fürchtete sie, er würde einen weiteren Fluchtversuch starten. Ihr Kollege klingelte.
Im Haus blieb es sekundenlang still, dann ertönte ein Quietschen, als würde ein Stuhl über Fliesen geschoben werden. Ben seufzte und betrachtete das Kopfsteinpflaster zu seinen Füßen.
Sein Vater öffnete die Tür. Verblüfft musterte er das Bild, das sich ihm bot, während er sich mit einer Hand auf die Oberkante der Haustür stützte. Seine Krawatte hing nur noch locker um seinen Hals, das Hemd war leicht geöffnet. In der anderen Hand hielt er ein Glas, zur Hälfte mit goldorangener Flüssigkeit gefüllt.
»Was ist passiert?«, brummte er und musterte seinen Sohn stirnrunzelnd.
Ben wich dem Blick seines Vaters aus. Er konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie Manu die Treppe halb hinunterkam. Er beugte sich über das Geländer, um mehr erkennen zu können, ein breites Grinsen im Gesicht.
»Guten Abend, Herr Portz«, grüßte der Polizist. »Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nichts Schlimmes. Wir wollten nur Ihren Sohn nach Hause bringen, nachdem wir ihn im Industriegebiet aufgegabelt haben.«
Eine Augenbraue seines Vaters wanderte in die Höhe. »Im Industriegebiet?«, wiederholte er. »Was hat er da getrieben?« Seine blassblauen Augen durchbohrten Ben, der sich unwohl wand.
Der Polizist schenkte ihm einen Seitenblick mit nichtssagender Miene. »Er behauptet, er hätte Kampfsport trainiert.«
»Kampfsport?«, spielte sein Vater die Rolle des Papageis weiter. Ben warf ihm einen vorsichtigen Blick zu. Er wirkte irritiert, allerdings wurde der Ausdruck nach und nach von Belustigung abgelöst. Ein paar trockene Lacher lösten sich aus seiner Kehle und wehten den Geruch von Alkohol zu ihm. Bens Wangen begannen vor Scham zu glühen. Wie viele Gläser Scotch hatte sein Vater wohl schon intus? Machte auf jeden Fall einen guten Eindruck auf die Beamten.
»Sag bloß, du trainierst heimlich«, feixte Manu. Ben mied seinen Blick. »Wenn ich du wäre, würde ich das auch nur machen, wenn mich niemand sehen kann.«
Bens Vater warf seinem älteren Sohn einen langen Blick über die Schulter zu. Dann wandte er sich wieder den Polizisten zu. »Ben hat keine Dummheit gemacht.« Er schien zu wissen, welche Anschuldigung in der Luft hing. »Wenn er sagt, er war Kampfsport trainieren, dann war er es auch.«
Ben fiel ein Stein vom Herzen. Er hatte nicht damit gerechnet, doch sein Vater schien ihm zu helfen, bewusst oder unbewusst. Allerdings hörte er auch, wie schwer die Wörter über seine Zunge rollten.
Die beiden Polizisten zögerten. »Sie müssen verstehen, dass wir uns versichern müssen … Was er da gemacht hat, wirkte wie Tanzen auf uns.«
Sein Vater lachte rau. »Das verstehe ich. Mein anderer Sohn hat schon Recht, wissen Sie. Ben ist … sportlich ungeschickt.« Er holte tief Luft, als müsse er seine Gedanken ordnen. »Er hat zwei linke Füße, wie seine Mutter.«
Ben wünschte sich ein Loch im Boden. Die Worte hinterließen kleine Wunden in seinem Herzen. Wenn er ihm nur zeigen könnte, dass er nicht unbegabt war. Dass er tanzen konnte. Aber das würde nie möglich sein.
Er versuchte, den Schmerz wegzuatmen. Eigentlich half ihm die Einstellung seines Vaters, auch wenn sie wehtat.
Die beiden Polizisten lächelten höflich, schienen aber endlich überzeugt. Die Frau wandte sich noch einmal an Ben. »Halt dich vom Industriegebiet fern, Junge. Da treiben sich zwielichtige Gestalten herum und der Randbezirk ist nicht weit.« Ben nickte folgsam. Die Dame fasste sich kurz an ihre Mütze. »Dann wünschen wir noch einen schönen Abend.«
Sie drehte sich auf dem Absatz um und marschierte zurück zum Streifenwagen. Ihr Kollege hingegen zögerte. »Kann ich dich noch einmal kurz sprechen?«
Ben nickte verwirrt und folgte ihm ein paar Meter fort von der Tür. In gedämpfter Stimme fragte er ihn: »Trinkt dein Vater öfters?«
Ben zuckte mit den Schultern. »Gelegentlich. Ist aber nicht schlimm.«
Der Mann runzelte die Stirn. »Trainierst du wirklich, um dich gegen die Kineten verteidigen zu können? Oder …« Sein Blick huschte kurz zu Bens Vater, der in der Tür stand und sie beobachtete.
Ben ahnte, an welches Thema der Beamte sich gerade herantastete. »Keine Sorge. Mein Vater ist friedlich. Wenn er trinkt, schaut er fern und geht dann ins Bett. Mehr nicht.« Er zwang ein Lächeln auf seine Lippen. »Ich trainiere echt für die Kineten.«
»Du weißt, wenn er … die Hand gegen euch hebt, dass ihr die Polizei rufen könnt.« Ben nickte. Der Polizist wirkte nicht völlig überzeugt, klopfte ihm jedoch auf die Schulter und ging.
Ben sah ihm mit gemischten Gefühlen hinterher. Die Besorgnis hatte er nicht erwartet. Der Mann war ein guter Gesetzeshüter. Er konnte zwischen den Zeilen lesen. Leider gab ihm genau das zu denken.
Es war keine Lüge gewesen. Sein Vater war nicht aggressiv oder gewaltbereit. Überhaupt zeigte er selten Gefühle. Nur was den Alkoholkonsum anging, da war er nicht ehrlich gewesen. Wann immer sein Vater so früh zuhause war, griff er zum Scotch. Vermutlich, um tiefgehende Gespräche mit seinen Kindern zu vermeiden.
Ben seufzte und kehrte zum Haus zurück. Sein Vater trat wortlos zur Seite. Er spürte seinen Blick auf sich ruhen, während er Schuhe und Jacke auszog. Als Ben die Treppe hochgehen und in seinem Zimmer verschwinden wollte, fragte er: »Was hast du da draußen gemacht?«
»Kampfsport«, sagte Ben. Oben im Flur brach Manu erneut in Gelächter aus. Ben ignorierte ihn, seine Hand klammerte sich an das Geländer.
»Hm«, brummte sein Vater. Er starrte ihn mit vernebeltem Blick an. »Soll ich dich wieder in der Kampfschule anmelden?«
Ben schüttelte den Kopf. »Nein, danke«, murmelte er. »Das eine Mal war peinlich genug.« Er wünschte sich nichts sehnlicher, als das Gespräch zu beenden.
Glücklicherweise hatte auch sein Vater kein Interesse daran, es zu vertiefen. Er wanderte ins Wohnzimmer und nahm den Scotch von der Kommode. Ben biss sich auf die Unterlippe.
»Papa, meinst du nicht, du hattest heute schon genug?«, fragte er leise. Sein Vater drehte sich zu ihm um und starrte ihn wortlos an. Nach ein paar Sekunden gab Ben auf und ging nach oben.
Manu wartete in seiner Zimmertür. »Ich glaube, ich wäre vor Scham gestorben«, sagte er grinsend. »Wenn ich erwischt worden wäre und man mir nicht mal glauben würde, dass ich kämpfen übe.«
Ben verkniff sich eine Antwort und drückte die Tür hinter sich ins Schloss. Mit geschlossenen Augen lehnte er sich an die Wand und atmetet tief durch. Das war knapp gewesen.
03. September
Aus dem Wohnzimmer dröhnte der Lärm von Explosionen und Maschinengewehren an seine Ohren. Als stünde er neben den Soldaten auf dem Schlachtfeld. Frustriert ließ Ben sein Tablet sinken und fuhr sich durch die kurzen Haare.
Seit Minuten starrte er auf die gleiche Stelle, ohne einen klaren Gedanken fassen zu können. Ein derber Fluch von Manu schallte durchs Haus. Ben schloss die Augen und lehnte sich zurück.
Die Schüsse kitzelten an einer alten Erinnerung. Verzweifelt versuchte er, sich auf etwas Anderes zu konzentrieren, doch ihm fehlte die Konzentration. Als die ersten Bilder aufblitzten, kniff er die Augen zusammen und presste die Hände auf die Ohren. Sein Körper hatte sich in ein hartes Brett verwandelt, hielt ihn bewegungsunfähig gefangen. Sein Bett vibrierte und jagte ihm den Schreck seines Lebens ein. Mit zitternden Fingern griff er nach seinem Handy. Es war eine Nachricht von seinem Kommilitonen Philip. Er wollte sich mit ihm treffen, ihre Projekte durchsprechen. Erleichterung durchflutete Ben. Philip bot ihm unwissend die Gelegenheit, dem Kriegsgebiet zu entkommen. Rasch antwortete er, packte seine Sachen und flüchtete aus dem Haus.
Der Campus der Universität war belebt. Die Klausurenphase hatte begonnen und trieb die Studenten in die Bibliothek und zu den Aufbaukursen. Ben musste noch zwei Prüfungen ablegen, dann war er für das Semester erlöst.
Philip wartete bereits am Eingang der Bibliothek. Er hatte einen Projektraum gemietet, in dem sie sich ungestört unterhalten konnten. Als Ben die Tür hinter sich ins Schloss drückte und die Geräusche zu einem dumpfen Summen wurden, atmete er erleichtert durch.
Er schenkte Philip ein flüchtiges Lächeln und rutschte auf den zweiten Stuhl. Sie bastelten zuerst an Philips Entwurf. Er hatte wie Ben vor allem Schwierigkeiten mit der Statik. Sein Gebäude war an einigen Stellen instabil, doch glücklicherweise waren seine Probleme viel grundlegender. Ben zeigte ihm ein paar Tricks, mit denen er sein Haus einfach, aber sicher vor dem Einsturz bewahren konnte. Philip machte sich eifrig Notizen.
Nach der Mittagspause wechselten sie zu Bens Projekt. Philip seufzte, als er die Zeichnung sah. »Eine Kapelle mit Kuppel? Warum nimmst du nicht ein Haus? Einfach und solide.« Ben zuckte mit den Schultern und erklärte, wo sein Problem lag. Grummelnd arbeitete sich Philip in die Materie ein, konnte ihm jedoch nicht weiterhelfen. Irgendwann gab er auf, weil er nicht mehr aufnahmefähig war. »Ich muss gleich los zum Training. Ich sehe es mir zuhause nochmal an, okay?«, bot er an.
Ben nickte und gab ihm eine Kopie der Zeichnung mit. Philip verließ die Bibliothek mit beschwingten Schritten und ließ Ben alleine in der Kabine zurück. Der setzte sich noch einmal an sein Projekt und beseitigte Flüchtigkeitsfehler. Genoss die Ruhe, die er beim Arbeiten hatte und den entsprechend klaren Kopf.
Die Bibliothek hatte sich merklich geleert, als er Schluss machte. Draußen dunkelte es bereits, nur wenige Studenten wühlten sich noch durch dicke Wälzer. Ben packte seine Sachen und gab den Schlüssel zum Projektraum ab, bevor er sich auf den Weg zur Bushaltestelle machte.
Er war beschwingt, nachdem er den ganzen Tag an seinem Projekt gearbeitet hatte, ohne von Manu gestört zu werden. Wenn er nun noch sein Fahrrad abholen und vielleicht einen kleinen Tanz einlegen konnte, war seine Welt wieder in Ordnung. Am liebsten wäre er gestern schon dorthin gefahren, doch er hatte sich so kurz nach der Festnahme nicht getraut, zurückzukehren. Langsam nahm die Sorge jedoch überhand. Alles drängte ihn zur Fabrik. Er zwang sich, die schlimmen Szenarien aus seinem Kopf zu verbannen. Positiv bleiben, sagte er sich. Beides würde noch da sein. Es musste.
Ein paar Minuten, bevor der Bus um die Ecke bog, begann es zu nieseln. Feiner Sprühregen wehte ihm ins Gesicht, sodass er seine Augen zusammenkneifen musste. Er sprang rasch ins Innere des Busses, sobald sich die Türen öffneten.
Der Bus war leerer als am Vormittag. Ben musste nicht mehr eingeklemmt zwischen einem schwitzenden Anzugträger und einem nörgelnden Mädchen stehen. Stattdessen ergatterte er sogar einen Sitzplatz am Fenster.
Die Lampe über ihm flackerte. Nach einer Bodenwelle wurde es schlagartig dunkel im hinteren Teil des Busses. Bens müde Augen hießen die Dunkelheit dankbar willkommen.
Er nickte mehrmals ein und verpasste beinahe die Haltestelle, an der er umsteigen musste. Angewidert stieg er hinaus in den stärker werdenden Regen, während kühler Wind um seine Ohren fegte. Er trieb die Müdigkeit aus seinen Gliedern, bis der nächste Bus endlich auftauchte.
Er war der einzige Fahrgast. Der Fahrer fragte ihn miesepetrig nach der gewünschten Haltestelle. Er fuhr los, bevor Ben saß, sodass er durch den Bus schlitterte. Er ließ sich auf den nächsten Sitz fallen und rutschte wieder ans Fenster.
Der Busfahrer schoss mit Schwung an den leeren Haltestellen vorbei, als müsse er einen Geschwindigkeitsrekord brechen. Ben betrachtete die regennasse Scheibe. Die Tropfen perlten an ihr herab, bildeten kleine Rinnsale. Der Regen nahm zu, minderte seine Lust auf die Heimfahrt.
Nahe der Fabrik stieg er aus und lief zu Fuß. Als er die leerstehende Fabrik erreichte, klebte seine Kleidung an ihm. Seine Zehen waren eiskalt, nachdem Wasser in seine Schuhe geschwappt war.
Wie angewurzelt blieb er stehen, als er sein Fahrrad erblickte. Es war noch an der Laterne angekettet, soweit die gute Nachricht. Allerdings hatte jemand die Räder abmontiert. Ben seufzte. Seine Laune sank ins Bodenlose.
Hoffentlich war seinem Musikplayer nichts passiert. Er machte sich auf den Weg in den Hinterhof. Seine Augen schweiften unablässig über das Gelände, untersuchten jeden Schatten. Regen und Dunkelheit machten es ihm schwer, viel zu erkennen. Da sich nichts auffällig bewegte, trat er an den Palettenstapel heran. Er schob seinen Arm in die Spalten. Erleichterung durchflutete ihn, als er die Plastiktüte ertastete. Sein Player war noch da, funktionstüchtig und gut geschützt.
Ben wog ihn nachdenklich in der Hand. Er war versucht zu tanzen, um den Stress abzuschütteln. Andererseits musste er samt Fahrrad durch den Regen zurück zur Bushaltestelle und nach Hause. Eine lauter Knall gefolgt von einem Knirschen und Rumsen nahm ihm die Entscheidung ab. Ben zuckte zusammen, sein Kopf fuhr herum. Die Farbe wich aus seinem Gesicht, als er beobachtete, wie unweit vom Industriegebiet eine Wolke aus Rauch und Schmutz in die Luft stieg. Verdammt, die Kineten waren in der Nähe.
Mit wild klopfendem Herzen verstaute er seinen Musikplayer sicher in seinem Versteck und hastete dann zu seinem Fahrrad. Er schloss die Kette auf und schulterte den Rahmen. Besser, er verschwand schnell, bevor ihn die Polizei oder die Kineten fanden. Er wollte keinem der beiden über den Weg laufen.
Der Rahmen fraß sich unbarmherzig in seine Schulter, als er zur Bushaltestelle rannte. Dort erwartete ihn die nächste böse Überraschung. Der letzte Bus, der hier vorbeikam, war der gewesen, in dem er gesessen hatte. Fassungslos betrachtete er den Fahrplan. »Shit«, flüsterte er und fuhr sich durch die Haare. Nun stand ihm ein langer Fußmarsch durch den Regen bevor.
Er warf einen kurzen Blick auf seine Uhr und zog sein Handy aus der Hosentasche. Wenn er Glück hatte, war sein Vater noch nicht zuhause und konnte ihn abholen. Mit einem nervösen Blick über seine Schulter drückte er auf den Entsperren-Knopf. Der Bildschirm blieb schwarz, das Handy gab keinen Mucks von sich. Vermutlich war der Akku leer.
Ben seufzte und machte sich auf den Weg nach Hause. Der Regen lief in Rinnsalen über seine Jacke. Seine Schultern schmerzten von dem Gewicht des Fahrrads und seine Ohren brannten, weil ihm der Wind entgegen heulte.
Er hielt sich entlang der schwach beleuchteten Bahnstrecke. Zu Beginn waren seine Schritte von der Angst getrieben, sobald er jedoch Abstand zwischen sich und die Explosion gebracht hatte, wurde er langsamer. Zwischenzeitlich musste er Schutz in einem Bahnhäuschen suchen, als der Regen zu einer Sintflut anschwoll. Regentropfen seilten sich Bindfäden gleich vom Himmel herab. Manche hüpften widerwillig vom Asphalt hoch, streckten sich dem Himmel entgegen und klammerten sich verzweifelt an alles, was ihren Weg kreuzte. Bens Hosenbeine wurden mit jeder Minute nasser, obwohl er unter dem Dach stand.
Er fuhr sich durch die Haare. Tropfen hatten ein Spinnennetz in seinem Haar geflochten und hefteten sich begierig an seine Hand. Er versuchte sie an der Hose trocken zu wischen, hatte jedoch nur mäßigen Erfolg.
Die Welt um ihn herum war erfüllt von einem Konzert aus Rauschen und Plätschern. Der Regen spielte sein Lied und brachte alles andere zum Schweigen. Der ferne Verkehr wurde vom Heulen des Windes erstickt.
Ein paar Tropfen trafen seinen Nacken. Der Regen hatte sich einen Weg durch das Dach gesucht. Ben wich einen Schritt zur Seite. Halb im Nassen stehend wartete er auf das Ende des Gusses.
Es kam nicht.
Irgendwann gab er auf und setzte seinen Weg fort. Er war durchnässt und vor ihm lag ein langer Weg. Er konnte nicht ewig warten.
Der kühle Wind brachte ihn zum Zittern. Seine Jeans klebte wie Kaugummi an seinen Beinen und seine Schuhe gaben bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch von sich. Seine Schulter protestierte unter dem Gewicht des Fahrrads, brannte wie eine kleine Flamme.
Die Kälte drang mühelos durch seine nassen Sachen. Das Unwetter bremste ihn immer wieder aus, der Wind rüttelte an allem, was er finden konnte. Die Bäume beugten sich dem Erdboden entgegen und selbst die Strommasten wiegten sich im Sturm.
Ben kniff die Augen zusammen, bekämpfte den Schmerz und die Kälte. Mehr als einmal musste er eine Pause einlegen und das Fahrrad absetzen. Er schüttelte seine Arme, doch sobald er den Rahmen wieder hochhob, begannen sie zu brennen.
In einer der ungewollten Pausen verfing sich die Kette in seiner Hose. Grummelnd versuchte er in dem Unwetter etwas zu sehen, während ihm das Wasser kalt den Rücken hinunterlief.
Ein lautes Ächzen und Quietschen lenkte ihn ab. Mit aufgerissenen Augen beobachtete er, wie der Strommast unweit von ihm den Geist aufgab. Das morsche Holz splitterte, Kabel sprangen funkenschlagend durch die Gegend.
Ben wich einen Schritt zurück, stolperte über sein am Boden liegendes Fahrrad und stürzte. Hart prallte er auf den Asphalt, schrie vor Schmerz und Schock auf. Dann schlug der Mast neben ihm auf die Erde. Das funkensprühende Kabel berührte die Straße, die vom Regen in einen Bach verwandelt worden war.
Ben hatte das Gefühl, dass jede Nervenfaser seines Körpers verbrannte, als die Elektrizität durch ihn hindurchraste. Der Schrei blieb in seiner Kehle stecken.
Dann wurde alles schwarz.
Seine Muskeln fühlten sich taub und fremd an. Ben konnte seine Augen vor Erschöpfung nicht öffnen. Doch nach und nach kroch die Kälte in seine Glieder. Er begann zu zittern, seine Muskeln zuckten in dem verzweifelten Versuch, sich zu wärmen.
Mit dem Frösteln kam auch die Nässe zurück. Ben spürte die Tropfen, die auf sein Gesicht prasselten und die Kleidung, die an seiner Haut klebte. Er zwang seine Augen auf und setzte sich langsam hin. Seine Muskeln schmerzten wie nach einem Marathon, seine Gedanken kamen nur schwer wieder in Gang.
Neben ihm knisterte etwas. Er drehte den Kopf und beobachtete eine schwarze Schlange, die glühend und zischelnd über den Boden sprang. Nein, keine Schlange, ein Kabel. Blaue Blitze zuckten neben ihm, ließen seinen Körper kribbeln.
In ihm summte es, allmählich meldete sich die Angst vor dem gefährlichen Strom. Mühsam schob er sich fort von dem Kabel, doch sein Hosenbein hing in der Kette des Fahrrads fest. Mit steifen Fingern zerrte er an dem Stoff, bis er nachgab und riss. Ben kämpfte sich hoch auf alle viere, um aufzustehen. Seine Beine gaben unter ihm nach, er taumelte, knickte wieder ein. Seine müden Muskeln protestierten. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, durch die Kopfschmerzen und die Verwirrung hindurch einen klaren Gedanken zu fassen. Er musste nach Hause. Langsam erhob er sich und zog sein Fahrrad hoch. Mit bedächtigen Schritten trat er den Heimweg an. Jede Bewegung fühlte sich so schwer an wie in einem Schwimmbecken, ließ seine Muskeln brennen und lodern. Der Regen rann ihm in Strömen über das Gesicht.
Er hatte keine Ahnung, wie er es bis in die Einfahrt seines Hauses schaffte. Am Ende seiner Kräfte ließ er das Fahrrad fallen und schlurfte zur Tür. Seine Beine waren zu schwer, um sie anzuheben. Noch immer waren seine Gedanken wirr, er konnte sich wenig an die letzten Stunden erinnern.
Mit weit aufgerissenen Augen versuchte er den Schlüssel ins Schlüsselloch zu schieben. Er sah kaum etwas und seine Finger waren so steif wie nach einer Schneeballschlacht.
Bevor er die Tür öffnen konnte, wurde sie aufgezogen. Sein Vater musterte ihn aus verhangenen Augen. Überraschung zeichnete sich auf seinen Zügen ab, als er den Zustand seines Sohnes bemerkte. Nach einem Moment trat er zur Seite, um ihn einzulassen.
»Was’n passiert?«, nuschelte er.
Ben wollte sich an ihm vorbei die Treppe hochschieben, doch sein Vater versperrte ihm den Weg. Der Geruch nach Alkohol hüllte ihn ein und drehte ihm den Magen um. Er atmete tief durch und setzte zu einer Erklärung an. »Ich … mein Fahrrad … keine Reifen. Der Sturm …« Seine taube Zunge und der klappernde Kiefer erschwerten ihm das Sprechen.
Sein Vater blinzelte. »Wieso hast du nicht angerufen?«
»Akku leer«, stieß Ben hervor. Er sehnte sich nach einer heißen Dusche. »Wärst du … nüchtern gewesen?«
Sein Vater presste die Lippen zusammen. »Vielleicht.« Als Ben wieder versuchte, sich an ihm vorbeizuschieben, ließ er ihn passieren. »Ist alles okay mit dir?«, erkundigte er sich zögerlich.
Seine Kleidung tropfte stetig, er zitterte am ganzen Leib und sein Vater wollte wissen, ob alles in Ordnung war?
»Kalt … Dusche«, wich Ben aus und schenkte ihm ein schwaches Lächeln, während er sich die Treppe hoch schleppte.
Er wartete die Antwort nicht ab, sondern schlurfte ins Badezimmer. Mühsam schälte er sich aus seinen Klamotten, die sich verzweifelt an ihn klammerten. Irgendwann gab er auf und stellte sich samt Kleidung unter die Dusche. Das heiße Wasser weckte seine Lebensgeister und klarte seinen Kopf auf. Ben schloss die Augen.
Seine Nerven erwachten prickelnd zum Leben. Ben stöhnte und zog langsam die restlichen Sachen aus. Achtlos warf er sie in die Badewanne. Dann sank er zu Boden und genoss die Wärme. In seinem Kopf waberte dichter Nebel umher. Seine Erinnerung an den Stromschlag kam nur etappenweise zurück.
Das ständige Summen übertönte alle anderen Geräusche. Das Knistern und Brummen trieb ihn in den Wahnsinn. Gedankenverloren wischte er sich mit der Hand über die Schläfe, um es zu vertreiben. Das Licht ging aus und ließ ihn im Dunkeln zurück.
Na super, dachte er, als es schon wieder flackernd ansprang. Hatte es einen Stromausfall gegeben?
Er griff nach dem Shampoo. Das Summen wurde präsenter und verbannte seine anderen Gedanken aus dem Kopf. Wie eine lästige Mücke, die um seine Ohren schwirrte. Hatte er von dem Stromschlag und dem einsetzenden Fieber Tinnitus bekommen? Oder war es eine Nachwirkung? Wenn es nicht in den nächsten Tagen abklang, musste er zum Arzt.
Er presste die Hände auf die Ohren, doch das Geräusch ließ sich nicht vertreiben. Ben schloss die Augen und atmete tief durch. Vielleicht waren seine Kopfschmerzen stärker, als er sich eingestehen wollte. Er rieb sich über die Schläfe. Die Lampe flackerte und erlosch, sprang jedoch gleich wieder an. Vermutlich war die Glühbirne am Ende ihrer Kräfte angekommen.