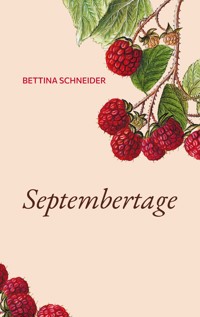
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
No risk, no fun? Die Enddreißigerin Carolin hat im Leben gern alles unter Kontrolle und überlässt nichts dem Zufall. In den idyllischen Cotswolds im Herzen Englands hat sie sich auf ein paar ruhige Urlaubstage eingestellt. Mit der Ruhe ist es schnell dahin, als ihr der charismatische Schriftsteller Leonard Angermann über den Weg läuft. Ein Mann, der das völlige Gegenteil ihrer Person zu verkörpern scheint. Dubios, unsolide, undurchschaubar ist er. Voller Überraschungen. Kein Mann, in den sich Carolin verlieben könnte. Oder doch? Was passiert, wenn sich Gegensätze plötzlich nicht mehr abstoßen? Und nichts so ist, wie es zu sein scheint?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle Menschen, die wie Carolin und ich an die Liebe und das Happy End glauben.
Wenn ein Traum Wirklichkeit wird …
Ich danke meiner Familie und den Menschen, die mich bestärkt und es mir ermöglicht haben, diesen Roman zu schreiben und zu veröffentlichen.
Anmerkung: Der Ort Lower Millbury entspringt der Fantasie der Autorin.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 1
Das Thermometer meines Mietwagens zeigte sechsundzwanzig Grad Außentemperatur. Ich hatte alle Fenster heruntergefahren und der warme Fahrtwind umwehte mich. Es duftete nach Spätsommer. Nach frischer Erde auf abgeernteten Feldern. Nach trockenen, gelben Stoppeln, sommerlichem Asphalt und Sonne. Aber es war mehr: Die Luft, die durch das geöffnete Autofenster hereinströmte, trug den Duft von Glück in sich.
Wieder und wieder hatte ich mich an diesen Ort zurückgesehnt. Unzählige Jahre waren vergangen, ohne dass die Erinnerung in mir verblasst wäre. Einige Male war ich knapp davor gewesen, eine Reise hierher zu buchen, aber es hatte sich letztendlich immer zerschlagen. Einmal war mir ein im Preisausschreiben gewonnener Kurztrip nach Prag, häufig die Arbeit, zweimal ein Partner, der ausschließlich Strände unter Palmen für den Urlaub bevorzugte, dazwischengekommen.
Die Sehnsucht war geblieben.
Und jetzt war ich hier.
Seit knapp zwei Stunden war ich nun unterwegs. Ich hielt mich an dem kleinen Lenkrad des Sportcoupés wie an einem Rettungsring fest. Unter normalen Umständen hätte ich mich als souveräne Autofahrerin bezeichnet, hier aber fühlte ich mich bisweilen wie eine Fahranfängerin kurz nach der Führerscheinprüfung. Der englische Linksverkehr und die schmalen Straßen strengten mich an. Wenn mir ein Auto begegnete, benötigte ich jedes Mal eine Sekunde, um mich daran zu erinnern, auf welche Seite der Fahrbahn ich gehörte. Ich bewegte mein Kinn im Halbkreis von rechts nach links und wieder zurück über meinen Brustkorb. Mein Nacken, meine Schultern schmerzten, mittlerweile war mein ganzer Oberkörper verspannt.
Ich mache eine Pause, schoss es mir durch den Kopf, wenigstens für einen Moment. Auch wenn es nur noch wenige Kilometer bis zu meinem Ziel waren. Aber ich musste meine Muskulatur lockern, einmal tief durchatmen.
Als auf der nächsten Erhebung ein offenes Gatter in Sicht kam, drosselte ich die Geschwindigkeit und rumpelte ein paar Meter weiter vorsichtig von der Straße an den Rand eines Feldes. Während ich mich aus dem Sitz des Sportwagens schälte (warum trug ich noch immer diesen schmal geschnittenen Rock?), sog ich die Luft tief in meine Lungen. Zusammen mit den Sommerdüften atmete ich frische ländliche Aromen — das absolute Kontrastprogramm für meine an Großstadtgerüche gewöhnte Nase. In mir stieg ein Gefühl auf wie Bläschen in einem Glas. Prickelnd und erfrischend. Als flüsterte mir das Leben zu: Alles ist wunderbar.
Alles ist möglich.
Aufbruchsstimmung.
Wann hatte ich sie zuletzt gespürt?
Ich streckte meinen Rücken durch, kreiste ein paar Mal die Schultern vorwärts, dann rückwärts, während mein Blick über die Landschaft schweifte. Es war, als wäre ich in einen Kaninchenbau gefallen, um in einer anderen Welt zu landen. Heute früh das hektische Berlin und jetzt das: Nichts als sanft wogende Hügel in Grün- und Brauntönen, soweit ich schauen konnte. Von Hecken gesäumte Felder und Weiden. Darin vereinzelt schwarze, braune oder weiße Punkte. Rinder und Schafe wie aus einer Spielzeugkiste. Am Horizont verschmolzen die Buckel im Dunst mit dem Vergissmeinnicht-Blau des Himmels. Wie ein schmales graues Band schlängelte sich die Straße durch die wellige Landschaft, in der ein paar Minuten weiter mein Ziel wartete.
Heckenrosen, moosbewachsene Steine. Fehlten nur Scones und Clotted Cream, Jagdhunde, Lord und Lady, ein edler Herrensitz und Oldtimer, um das Klischee vollends zu erfüllen.
Bilderbuch-England. Ländliche Idylle.
Cotswolds.
Heiß wie im Juli brannte die Sonne, goss ihr Licht über die Landschaft und brachte das Land zum Flimmern. Der Zauber eines Sommertages lag in der Luft, dabei zeigte der Kalender bereits September.
Es war wie damals. Wie vor zwanzig Jahren. Nichts schien sich verändert zu haben. Die Landschaft, das Licht, die Wärme. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Damals hatten sich Bilder in meinem Gehirn eingenistet, um fortan wie kleine tröstende Geschenke ausgepackt zu werden. Immer dann, wenn meine Seele danach lechzte.
September vor dem Abitur. Es war, als blätterte mein Leben auf die Schnelle ein paar Kapitel zurück. Das letzte Schuljahr. Ein magisches Jahr, hatte es meine beste Freundin Emma genannt. Eine Zeit mit einem Gefühl, ich wäre die Sonne der Welt. Lebenshungrig, so begierig auf die Zukunft war ich. Voller Energie und einem sehr gesunden Selbstbewusstsein, weil ich glaubte, das Schicksal meinte es gut mit mir und ich könnte alles erreichen. Naiv, unverbraucht vom Leben war ich damals, sagte mir der Rückblick. Aber ich hatte die Zeit und die damit verbundenen Gefühle nicht vergessen. Und immer wenn sich der Sommer dem Ende neigte, tastete sich in mir zögerlich ein Gefühl hoch, das wehmütiger Sehnsucht am nächsten kam. Immer dann schwelgte ich in Erinnerungen an die Tage, die ich hier verbracht hatte.
Heute war es keine Erinnerung. Ich spürte die Wärme auf meinen Armen, das Postkartenpanorama lag vor meinen Augen, die Gräser der Wiese wiegten sich elastisch in einer sanften Brise. Alles war lebendig. Alles war zum Greifen nahe. Ich bückte mich und zupfte einen braunen Grashalm ab, den ich zwischen Daumen und Zeigefinger zwirbelte. Knäuelgras. Dactylis glomerata. Manchmal überraschte es mich, zu welchen Glanzleistungen mein Gedächtnis fähig war. Vor langer Zeit hatte es eine Phase in meinem Leben gegeben, in der ich jede unbekannte Pflanze, die mir unterkam, in einem abgegriffenen Bestimmungsbüchlein nachgeschlagen hatte. Biologie Leistungskurs. Die Botanik hatte es mir damals besonders angetan.
Um mich herum zwitscherten und flöteten Vögel, nicht mehr so laut wie im Frühling, aber immer noch freudig und munter.
Ich bekam das Lächeln nicht mehr aus meinem Gesicht.
Alles war möglich. In der Luft lag irgendetwas, das von Neuanfang sprach. Als atmete ich mit der Landluft das Selbstvertrauen von damals und die vielen Möglichkeiten der Jugend. Du klingst wie eine Oma, flüsterte mir eine Stimme zu. Dabei war ich achtunddreißig. Mein Gott, Carolin, reiß dich zusammen, ermahnte ich mich.
Ich lebte, ich war jung.
Und ich war in Weltumarmungslaune.
Mein Blick fiel auf zwei Ballen aus goldgelbem Stroh, die am Rande der Weide lagerten. Warum nicht?
Ich breitete die Arme aus, ganz weit streckte ich sie, drehte mich mehrmals um mich selbst. Ich hopste wie ein Fohlen, das noch keine Herrschaft über seine Beine besaß, über die Wiese — das lag an meinen unpraktischen Pumps und dem unebenen Untergrund — und trudelte immer weiter. Mit einem lauten Juchzer, der wie ein Echo durch die Landschaft hallte, ließ ich mich rücklings auf die Strohballen fallen. Wow!
Weitaus härter als erwartet war meine Unterlage, aber ich lag in einer sehr angenehmen Position. Blau, schönstes, makelloses Blau sah ich über mir. Während sich mein Atem langsam wieder beruhigte, versank ich in der Betrachtung des endlosen Himmels, das sonnenwarme Stroh unter meinem Rücken. War der Himmel hier anders als in der Stadt? Weicher, sanfter. Irgendwie bauschig. Grenzenlos. In der Stadt schien er sich häufig unfreundlich, in einem Farbton, der mehr grau als blau war, wie ein Deckel auf die Häuserlandschaft zu legen.
Alles war Sonne. Alles war herrlich. Und ein weiteres vergessenes Gefühl wallte in mir auf. Diese Freude, die ich von früher kannte, wenn die langen Sommerferien in den Startlöchern gestanden hatten und mir die Zeit so unfassbar lang vorgekommen war wie ein halbes Leben.
Sechs Wochen Urlaub waren es in diesem Spätsommer nicht, aber eine Woche hatte ich meinem Chef abschwatzen können. Jedes Mal, wenn ich bei Lutz Wernecke Urlaub beantragte, gab es einen Riesenaufstand, als wäre es ein Verbrechen, sich ein paar freie Tage zu nehmen. Nach langem Bitten und Betteln, dieses Mal hatte ich tatsächlich seit Pfingsten im Abstand von ein paar Tagen vor seinem Schreibtisch gestanden, um ihm eine Woche Urlaub aus den Rippen zu leiern. Fünf Tage! Wenn er guter Laune gewesen war, was nur selten vorkam, hatte ich sofort beiläufig erwähnt, dass er über die Genehmigung meines Urlaubs nachdenken wollte. Gnädigerweise hatte er sich dann irgendwann herabgelassen, mir die Tage zu genehmigen. Nicht viel, aber wenigstens etwas.
Ich seufzte laut, rekelte mich von oben bis unten durch, bevor ich mich aus dem Stroh aufraffte. Die nächsten Minuten verbrachte ich damit, mich von den unzähligen Halmen, die an meinem Rock und meiner Bluse hafteten, zu befreien. Ehe ich wieder in meinen Wagen stieg, warf ich einen letzten Blick auf die pittoreske Szene vor mir.
Ich ließ den Motor an und lenkte das Gefährt langsam auf die Landstraße zurück. Die Sonne brannte auf die Motorhaube und spiegelte sich. Ich klappte die Sonnenblende herunter. Links fahren, bläute ich mir ein. „Links fahren“, sagte ich laut zu mir. „Immer schön links fahren.“
Heute war alles wie am Schnürchen gelaufen. Die paar Stunden auf der Arbeit (ich war mit dem übereifrigen Wirtschaftsprüfer noch die letzten Unterlagen durchgegangen), die Anreise zum Flughafen (keine Zugausfälle, keine Klimakleber), pünktlicher Flug. Unkomplizierte Einreise. Und bei der Autovermietung in Heathrow hatte ein freundlicher Mann mit pakistanischen Wurzeln mir ein Upgrade, ein nagelneues Sportcoupé, gegeben. Der Mann hatte nicht zu viel versprochen, als er mir den Schlüssel über den Tresen gereicht hatte. Das Auto fuhr sich blendend, beschleunigte wie eine Rakete.
Alles war gut, alles war bestens. Ich liebte es, wenn alles reibungslos und wie geplant ablief. Und gerade jetzt versetzte es mich in Hochstimmung. Wenn auch noch das Wetter für die nächsten Tage mitspielte, kam das einem Sechser im Lotto gleich. Später würde ich noch einmal auf die Wetter-App schauen, nur um mich abermals zu vergewissern, dass die Vorhersage auch wirklich fantastisch aussah.
Urlaub. Endlich! Ich hatte Urlaub. Wie befreit atmete ich auf. Und ich hatte es geschafft. Ich war hier. Nach zwanzig Jahren war ich tatsächlich wieder hier. Und die kleine Mission, die ich mir selbst auferlegt hatte, würde ich auch erfüllen. Das war mir wichtig. So wichtig, dass ich auch nach zwanzig Jahren immer noch daran dachte. Am besten, ich erledigte es schnell. Erst danach würde ich meine Zeit hier in vollen Zügen genießen können.
Die Straße verengte sich weiter, ich ging vom Gas. Ich hatte extra diesen Umweg durch das Herz der Cotswolds gewählt, um mich auf den Urlaub einzustimmen. Ich erblickte Pferde. Rinder mit zottligem Fell, die aussahen, als trügen sie einen Flokati als Mantel. Spät geborene Lämmer grasten neben ihren Müttern auf saftig grünen Wiesen. Schwalben, die übermütig vor mir über den Asphalt schossen, um dann wieder in den Himmel aufzusteigen. In den Orten zogen honigfarbene Steinfassaden von Häusern, die aus einer längst vergangenen Epoche stammten, an mir vorbei. Tickten die Uhren hier langsamer? Zumindest schien es, als hätte das Leben mindestens einen Gang, wenn nicht gar zwei Gänge runtergeschaltet.
Noch eine halbe Stunde bis zu meiner Unterkunft, sah ich auf dem Navi. Gleich war ich am Ziel. Genüsslich lehnte ich mich in den schwarzen Ledersitz zurück und hörte mich wohlig seufzen. Gleich könnte ich mich aus Rock und Bluse schälen und in bequeme Kleidung steigen.
Die Straße beschrieb eine Kurve. Ein gelbes Stoppelfeld schob sich in mein Gesichtsfeld. Wie kleine Geier hockten schwarze Vögel, Heerscharen von Krähen, auf dem abgeernteten Acker. In einer Ecke hatten Wildschweine die Erde umgepflügt. Am Ende des Feldes, dort, wo es an ein Waldstück grenzte, äste ein Reh. Und ich entdeckte ein zweites. Die Tiere beäugten das Auto, aber ließen sich nicht stören. Wieder stieg ein Wohlgefühl, Freude, in mir auf.
Als ich meinen Blick auf die Straße lenkte, kam mir ein Auto entgegen. Mitten auf der schmalen Fahrbahn. Mit hoher Geschwindigkeit. Ja, es raste auf mich zu. Ein Sportwagen. Ein dunkler Porsche, stellte ich nach einer weiteren Schrecksekunde fest. Instinktiv riss ich das Steuer nach rechts, das Auto reagierte ohne Verzögerung und fuhr nach rechts. Zu meinem Entsetzen tat der entgegenkommende Wagen das Gleiche.
Er fuhr direkt auf mich zu.
War der Typ verrückt?
Mein Herz setzte einen Schlag aus, bevor ich, immerhin noch geistesgegenwärtig, hart auf die Bremse trat. Reifen kreischten. Wie auf einer vereisten Bahn schlitterte ich vorwärts. Es qualmte, roch merkwürdig nach Chemie. Gleich knallt es, schoss es mir durch den Kopf.
Ich wartete auf den Aufprall.
Im letzten Augenblick zog der andere Fahrer sein sportliches Gefährt auf die gegenüberliegende Straßenseite, legte eine Vollbremsung hin und landete halb im Graben.
Stille. Komplette Stille umgab mich. Als hätte die Welt aufgehört zu atmen. Nur mein Herz trommelte, als hätte ich einen Sprint hinter mir, während sich in meinem Kopf die erlebte Szene in einer Endlosschleife abspielte. Ich schloss die Augen, schickte ein Dankgebet zum Himmel und versuchte, meinen rasenden Puls wieder auf Normalwert zu bringen. Gleichmäßig atmen, befahl ich mir. Ein und aus. Ein und aus. Gott sei Dank, es war noch einmal gut gegangen. Nichts war passiert. Kein Zusammenstoß. Kein Unfall.
Meine Hände zitterten, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken (das hatte ich heute wahrscheinlich auch getan). Als ich mich aus dem Sitz schob, was ich in dem Rock und meinem momentanen Gemütszustand nur auf sehr unelegante Art bewältigte, bemerkte ich, ich zitterte am ganzen Körper. Für ein paar Sekunden lehnte ich am Auto und atmete weiter, gleichmäßig und bewusst. Tief ein und aus. Als ich mich etwas besser fühlte, stakste ich durch das hohe Gras um den Wagen, hielt mich dabei an der Karosserie fest. Langsam klackerte ich über den Asphalt auf den Porsche zu. In meiner Aufmachung kam ich mir auf der Landstraße in etwa so passend vor wie im Faschingskostüm auf einer Taufe. Warum trug ich diesen dunkelblauen Rock und die hellblaue Seidenbluse und hatte nicht am Flughafen mein Arbeitsoutfit gegen etwas Urlaubstaugliches getauscht? Warum hatte ich mich heute am Samstag so angezogen? Warum hatte ich mich überreden lassen, überhaupt am Samstag noch ein paar Stunden auf der Arbeit zu erscheinen? Eine Endloskette der Gedanken. Aber das alles tat hier gerade nichts zur Sache.
Der andere Fahrer, ein Mann wie vermutet, hatte seinen Sportwagen bereits verlassen und raste wie ein aufgescheuchter Gockel um das Gefährt herum. Als er fluchend und vor sich hin schimpfend die Seite begutachtete, die im Graben hing, verschwand er selbst bis zur Hüfte in der von Grassoden bewachsenen Vertiefung. Das Auto hatte ein deutsches Kennzeichen, stellte ich fest, und mir fiel ein Stein vom Herzen. Ein Deutscher wie ich — es würde die Kommunikation erleichtern.
„Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“, rief ich ihm zu. „Sind Sie okay?“
Der Fahrer stieg aus dem Graben. Mit hektischen Bewegungen klopfte er die Hosenbeine aus, als hätte er in einem Ameisenhaufen gestanden, und entfaltete sich neben seinem Wagen zu voller Größe. Zu einer beachtlichen Größe.
Gorilla — der erste Gedanke, der mir bei seinem Anblick durch den Kopf schoss. King Kong. Die Gestalt hatte eine dunkle Zottelmähne — ungebändigte Locken —, einen wallenden Bart und einen finsteren Gesichtsausdruck. Dunkle Augen, in denen glühende Wut funkelte, starrten mich an. Sein kräftiger Körper, der in einem unförmigen, aschgrauen Jogginganzug aus Sweatshirt-Stoff steckte, verstärkte den Eindruck, einen Primaten vor mir zu haben. Dieser Anzug, huschte mir unsinnigerweise durch den Kopf, hatte bestimmt einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, auf dem Buckel, denn er war vollkommen aus der Mode.
Mit jeder Pore strahlte der Mann Aggressivität aus. Und er maß bestimmt knapp dreißig Zentimeter mehr als ich. Ein mulmiges Gefühl machte sich in meiner Magengegend breit, als er auf mich zu stapfte.
King Kong.
Das Unheil in Person.
Meine rechte Hand krampfte sich um das Handy, das sich in der Tasche meines Rockes befand. Es gab irgendwo die Notruftaste, rief ich mir zur Beruhigung ins Gedächtnis.
„Sind Sie verletzt?“, fragte ich.
„Sind Sie wahnsinnig?“, donnerte der Mann, ehe ich eine Entschuldigung nachschieben konnte. „Sie hätten uns umbringen können. Wissen Sie nicht, dass man in England links fährt?“
Wenn Blicke töten könnten ...
„Wer hat Sie bloß aus dem Stall auf die Straße gelassen?“
Er sah nicht nur wie ein Gorilla aus, er verhielt sich auch nicht anders als ein wild gewordener Affe. Fehlte nur, dass er sich auf die Brust trommelte. Für den Moment verschlug es mir die Sprache. Aber sicher, er hatte recht, für einen winzigen Augenblick war ich auf der falschen Straßenseite gefahren. Aber musste man deswegen einen solchen Aufstand machen? Schließlich war alles glimpflich verlaufen.
Er musterte meinen Wagen, dann mich. Sein Blick huschte einmal über meinen Körper, blieb an meinem Rock, genau genommen dort, wo er aufhörte, hängen, wanderte hoch zu meiner Bluse, um abermals zu stoppen. Nur eine Nanosekunde, aber ich registrierte es. Was für ein widerlicher Kerl. Unwillkürlich verschränkte ich die Arme vor der Brust. Von der ersten Sekunde an konnte ich ihn nicht leiden. Warum musste gerade dieser Deutsche mir hier in England über den Weg laufen oder vielmehr über die Straße fahren? Ich ertastete einen vergessenen Strohhalm im Ausschnitt, den ich wegschnippte. Und auch am Rocksaum, sah ich nun, hing ein Stängel. Egal, darum würde ich mich später kümmern. Bloß nicht ablenken lassen. Ich nahm den Mann abermals ins Visier.
Chewbacca. In einer Geisterbahn hätte er, ohne sich zu verkleiden, für den gruseligen Sondereffekt sorgen können. Es verging ein langer Moment, in dem wir uns beide nur anstarrten, ehe er erneut eine Reihe von Flüchen, untermalt von Schimpfwörtern und Beleidigungen, die offensichtlich alle mir galten, in seinen Bart zu brabbeln begann. Hatte er mich Karrierezicke genannt?
Sein Verhalten schob ich auf den Schockzustand, in dem er sich befand. Obwohl sich urplötzlich eine Palette ganz anderer Gefühlswallungen in mir breitmachte, beschloss ich, höflich, freundlich und ruhig zu bleiben, das waren meine Stärken. Kill them with kindness. Es reichte, wenn sich einer wie ein Ochsenfrosch aufblähte.
„Carolin Bäumler.“
„Was?“ Seine Miene blieb unbeirrt finster.
Keine Manieren hatte der Typ.
„Ich habe mich Ihnen vorgestellt“, fuhr ich mutig fort. Wenn er sich nicht verletzt hatte, augenscheinlich war der Wagen nicht zu Schaden gekommen, hoffte ich, dieser Situation umgehend entfliehen zu können. Also, das Unvermeidliche tun (das war ich von meiner Arbeit gewohnt), kurz mit ihm reden, die Fakten klären, eventuell die Personalien aufnehmen und Adiós oder besser Bye Bye. Und das war es.
„Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“ Als ich seinem Blick folgte, der nachdenklich zu seinem Porsche schweifte, setzte ich nach: „Und natürlich auch bei Ihrem Auto?“
„Hoffen wir es!“, knurrte der Gorilla. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging er um seinen Wagen herum, öffnete die Beifahrertür, zog ein ledernes Notizbuch aus dem Handschuhfach und kehrte zurück. Das Büchlein drückte er mir zusammen mit einem glänzenden Kugelschreiber irgendeiner Edelmarke in die Hand, wobei er den größtmöglichen Abstand zu mir hielt. Als hätte ich eine ansteckende Krankheit oder mehrere Wochen nicht geduscht. Und das bei seinem eigenen Aufzug ...
„Schreiben Sie mir Ihre Telefonnummer auf!“, befahl er in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. „Falls sich herausstellen sollte, dass Sie etwas kaputt gemacht haben!“
Na schön. Wenn er mich so nett bat. Der Typ konnte mich kreuzweise. Schwungvoll kritzelte ich meine Handynummer in das Büchlein und reichte es ihm zurück. „Ich hoffe, Sie bekommen keinen Ärger mit Ihrem Chef!“ Den Satz konnte ich mir nicht verkneifen.
„Welchem Chef?“, fragte er und riss das Buch nebst Stift wieder an sich.
„Gehört der Wagen Ihnen?“, erkundigte ich mich. Neugier war auch eine meiner dominanten Charaktereigenschaften, wobei ich nicht wusste, ob es sich dabei um einen Vorzug handelte.
„Ja, natürlich.“ Er verzog sein Gesicht zu einem fratzenartigen Grinsen. „Hoffentlich bekommen Sie nicht Ärger mit Ihrem Mann, wenn er erfährt, dass Sie wie eine Irre Autofahren und dabei unschuldige Menschen in den Graben drängen.“
„Ich bin niemanden Rechenschaft schuldig.“
„Wundert mich nicht.“
Eine Haarsträhne, bemerkte ich, hatte sich aus meinem am Morgen akkurat frisierten Knoten gelöst. Umgehend strich ich sie hinter das Ohr, straffte den Rücken und sammelte das letzte Quäntchen Beherrschtheit, das mir geblieben war.
„Es ist nichts passiert. Uns ist nichts passiert. Es ist ein herrlicher Tag. Schönster Spätsommer. Blauer Himmel. Schauen Sie sich um. Wie herrlich die Welt ist. Ich weiß nicht, welche Laus Ihnen über die Leber gelaufen ist, aber ...“
„Blabla, blabla ...“
Nicht die Spur von Manieren hatte er ...
„Ich sage es Ihnen: Eine Karrierezicke in einem Sportwagen, die nicht Autofahren kann!“
Eine Ohrfeige, schoss mir durch den Kopf, wäre die passende Antwort auf die Unverschämtheiten dieses Großmauls. Oder eine Anzeige. Wegen Beleidigung und Sexismus. Oder Macho-Verhalten. Bis vor zehn Minuten war ich vollkommen ausgeglichen gewesen. Ja, ich hatte mich beschwingt und fröhlich gefühlt. Jetzt kochte es in meinem Inneren wie in einem Kessel, der kurz vor dem Platzen stand. Atmen! ermahnte ich mich, immer schön atmen. Ein und aus. Ein und aus. Tiefenatmung. Um mich herum sangen weiterhin die Vögel, Schmetterlinge tanzten durch die Luft, eine Libelle, schillernd wie der Panzer eines Rosenkäfers, schwirrte über die auf Hochglanz polierte Motorhaube des Porsches. Alles war schön. Bis auf den Typen, der mir wie eine schwarze, bedrohliche Gewitterfront gegenüberstand. Ich atmete weiter tief ein und aus und es half: Ich befand mich wieder im Urlaubsmodus.
Nun ja.
Beinahe.
„Ich weiß, dass ich Autofahren kann — entgegen allen Klischees und ...“
„Aber nicht auf der richtigen Straßenseite!“, unterbrach er mich erneut. „Gemäß allen Klischees können Sie rechts nicht von links unterscheiden!“
Plötzlich hob er seine Hand und schob sie in Richtung meines Gesichtes. Was tat er da, um Himmels willen? Er lachte laut auf und zog einen Strohhalm aus meinem Haar, ehe seine Miene wieder versteinerte. Trotzdem sah ich den Spott in seinen Augen. Und dann, als hätte er sich besonnen, wie wütend er war und in welcher Situation er sich befand, warf der Flachland-Yeti mir einen letzten, besonders grimmigen Blick zu, bevor er in seinen Porsche sprang. Mehrfach ließ er den Motor aufheulen, wie ein jugendlicher Angeber, der sich ausschließlich über sein Auto definierte. Dann fuhr er endlich, vorsichtig, als transportierte er Kisten feinstes Porzellan, auf die Straße und brauste, sobald sich die vier Räder auf dem Asphalt befanden, grußlos weg.
Prolet.
Wahnsinniger.
IDIOT.
Ich lenkte meinen Blick in das heitere Himmelsblau, das sich über meinem Kopf spannte und sprach mein Mantra: „Lächle und das Leben lacht zurück.“ Ich ließ mir den Tag nicht verderben. Vor allem nicht von so einem ...
Egal. Eigentlich hatte ich die Begebenheit schon vergessen, ebenso den Gorilla.
War da überhaupt etwas gewesen?
Kapitel 2
Lower Millbury. Niedlich und klein. Ein winziges Dorf. An den Ausläufern der Cotswolds Hills gelegen. Ich war erleichtert, als ich die drei schlanken Pappeln entdeckte, die wie Wächter neben der Unterkunft standen und an die ich mich jetzt wieder erinnerte, weil sie mir schon vor zwanzig Jahren als Wegweiser gedient hatten.
„Sie haben Ihr Ziel erreicht“, sprach das Navi.
Da lag sie. Die Bluebell Hill Farm, und mein Herz pochte voller Vorfreude. Als ich von der Straße zur Farm einbog, knirschte Kies unter den Reifen. Den großen Hof umschlossen einzelne Gebäude: mehrere, aus goldfarbenen Kalksteinen der Cotswolds erbaute zweistöckige Cottages in einer Reihe, eine ehemalige Scheune, die jetzt als Garage oder riesige Lagerhalle diente, ein Stall und das neben der Einfahrt gelegene frei stehende Haus des Verwalters, das die Eigentümer beherbergte. In diesem Haus sollten sich die Gäste melden, darauf wies ein dezentes Schild neben der Haustür hin. Wilder Wein kletterte an den Fassaden und leuchtete in flammendem Rot. Neben jeder Tür rankten in Perlmuttfarben blühende Rosen. Den Mittelpunkt des Hofes bildete eine zwergwüchsige Platane, in deren lichten Schatten eine getigerte Katze auf einer Holzbank schlief.
Die ehemalige Farm träumte in der Sonne und ich fühlte mich sofort wieder heimisch. Tiefe Dankbarkeit durchströmte mich. Alles war so, wie es in meinem Gedächtnis haften geblieben war.
Kein Mensch war zu sehen. Die Luft war völlig reglos. Auf der Farm herrschte die träge Stille eines spätsommerlichen Nachmittages. Viele Touristen schien es um diese Jahreszeit nicht hierher verschlagen zu haben, was mir absolut recht war. Ich sehnte mich nach Ruhe und Alleinsein.
Ich sprang aus dem Wagen — inzwischen gelang es mir besser, mein Gefährt halbwegs elegant zu verlassen — und spazierte auf das Haus des Verwalters zu. James, der Schwarm meiner jungen Jahre. Und nicht nur ich hatte für ihn geschwärmt, fast alle Mädchen hatten ihn angeschmachtet. Manche hatten bei ihm Erfolg gehabt, er war einem Flirt nicht abgeneigt gewesen. Aber mich hatte er damals verschmäht. Ob ich ihn wiedererkennen würde? Würde er mich erkennen? Die Website nannte ihn und seine Frau Elenor als Eigentümer, die ihre Gäste herzlich auf der Farm willkommen hießen. Heiß brannte die Sonne auf den Hof herab und ich wischte mir unwillkürlich über die Stirn. Auch wenn die Temperaturen an einen hochsommerlichen Tag erinnerten, war das Licht anders. Viel weicher, gnädiger, mit einem bernsteinfarbenen Ton, nicht grell und stechend wie noch vor wenigen Wochen.
Septemberlicht. Das Licht, das die Ahnung des Herbstes bereits in sich trug.
Gegenüber der Farm, quer über die Dorfstraße, befand sich die alte Kirche, umgeben vom Friedhof. Windschiefe Grabsteine, an denen der Zahn der Zeit genagt hatte, ragten, als hätte Gott sie aus dem Himmel auf die Erde fallen lassen, aus der Grasfläche. Um meine Lippen spielte ein Lächeln, als ich mir ins Gedächtnis rief, wie dieser Kirchhof vor zwanzig Jahren meine Fantasie angeregt hatte. Besonders am Abend, wenn der Nebel aus den umliegenden Wiesen gekrochen war, sich über das Dorf wie ein Schleier gelegt hatte und alles nur schemenhaft wahrzunehmen war. Dann hatte die Atmosphäre in dem kleinen Ort für wohlige Gruselgefühle gesorgt.
Im Garten des Verwalterhauses trockneten Bettlaken und Handtücher auf Leinen verteilt. Klammern in Form von Micky Mäusen hielten die Wäsche. Auf der weitläufigen Rasenfläche lag das Spielzeug von Kindern. Große Plastikbausteine neben einer roten Tonne mit Schaumstoffbällen, Fußbälle und Tischtennisschläger, Springseile und ein blau-weißes Dreirad. Ein Gummikrokodil. In einem Gehege aus Maschendraht in einer Ecke des Gartens knabberten vier Meerschweinchen an Salatblättern. Daneben stand ein Apfelbaum, der schwer an seinen roten Früchten trug und von dem ein Kletterseil herab baumelte. Gepflegte Beete rahmten den Rasen. Dahlien bunt wie Lampions, eine Sorte hübscher als die andere, und weiße Astern standen in voller Blüte. Auf der schattigen Seite des Gartens drängten sich an eine Bruchsteinmauer mannshohe Hortensien, die von löschpapierfarbenen Dolden übersät waren. Aus der Ferne drang das leise, träge Glucksen von Hühnern, die vermutlich ein Nickerchen irgendwo unter Büschen hielten.
In Ermangelung eines Klingelknopfes zog ich die Kette der Schiffsglocke neben der Haustür, die im Schatten eines riesigen Blauregens lag. Wie schön musste es aussehen, wenn er blühte. Mein Herz klopfte vor Aufregung. James. Was sollte ich sagen, wenn er mich erkannte?
Ich hatte mich auf Hundegebell eingestimmt, ein Schild wies auf einen Labrador hin, der in diesem Haus wohnte, aber nichts dergleichen war zu hören. Kaum war der Ton der Glocke verklungen, öffnete eine zierliche junge Frau die Tür, das dunkle Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Auf dem Arm trug sie ein Kleinkind mit Krümeln um den Mund und einem angebissenen Keks in der Mini-Hand.
„Dachte ich mir doch, dass ich einen Wagen gehört habe. Herzlich willkommen! Sie müssen Carolin Bäumler sein!“ Die junge Frau in einem mädchenhaften blassblauen Kleid sprach akzentfreies Deutsch und streckte mir die Hand entgegen. „Ich bin Elenor und das ist Ken!“
Verschämt blickte der kleine Junge zur Seite und schlang die Arme um den Hals seiner Mutter.
Elenor hatte einen kräftigen Händedruck. Bestimmt stand sie mit beiden Beinen fest im Leben. Sie ist mir auf Anhieb sympathisch, dachte ich. Und jetzt schnupperte meine Nase den Duft frischgebackenen Kuchens, vermengt mit dem von Kaffee. War es Pflaumenkuchen? Oder Apfelkuchen? Unwillkürlich begann mein Magen zu knurren.
Elenor bat mich ins Haus, aber ich wollte nicht stören, denn eigentlich wollte ich so schnell wie möglich in mein eigenes kleines Häuschen, um mich umzuziehen. Ein paarmal ging es hin und her, letztendlich blieben wir in der Tür stehen, was uns nicht daran hinderte, in eine angeregte Unterhaltung zu verfallen. Mit manchen Menschen gelang es auf Anhieb. Während der nächsten Minuten schwärmte ich Elenor von meinem ersten Besuch vor. Dass der Ort mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen war. Und wie schön es war, alles so vorzufinden, wie ich es in Erinnerung bewahrt hatte.
Elenor nickte. „Ich kann Sie gut verstehen. Ich liebe diesen Landstrich, der mit meiner Hochzeit zu meiner Heimat geworden ist. Und wie witzig, auch ich war auf Klassenreise hier und habe mich in meinen Mann James und alles verliebt. Ich bin in meinem Paradies hängengeblieben“, sagte sie mit einem kleinen Seufzer. „Allerdings ist es auch ein arbeitsintensives Paradies.“
Ich spürte für einen Moment in mich hinein und konnte nichts anderes feststellen, als dass ich mich für die beiden freute ... Und es erklärte, warum sie akzentfreies Deutsch sprach. Wir sprachen über Vergangenes, Veränderungen und schließlich berichtete Elenor von den Modernisierungen, die sie hatten durchführen lassen. Aber James habe einiges auch selbst gemacht, sagte sie mit Stolz in der Stimme. Trotzdem sei vieles beim Alten geblieben, meinte sie mit einem fröhlichen Augenzwinkern.
„Bin gleich wieder da. Ich hole den Schlüssel. Ich habe Sie im Haus zwei einquartiert“, sagte meine Vermieterin, als ein Wecker im Haus penetrant zu piepen begann und sie wahrscheinlich an ihren Kuchen im Backofen erinnerte. „Sie haben Glück, momentan sind keine Gäste hier. Sie werden also ein paar sehr ruhige Tage haben.“
Elenor setzte den Kleinen auf dem hell gefliesten Boden ab und stürmte davon. Der Junge lief ein paar wacklige Schritte und umarmte einen dunklen Labrador (oder vielleicht hielt sich der Junge auch an dem Hund fest), der inzwischen in den Flur getrottet war.
„Es gibt nur einen Dauergast, einen Schriftsteller, der quasi zur Familie gehört“, sagte Elenor, als sie wieder zu mir zurückkehrte und die Hausschuhe gegen ausgetretene Clogs tauschte und dabei mit dem Schlüssel klimperte, „aber von ihm werden Sie so gut wie nichts mitbekommen. Er arbeitet Tag und Nacht und kommt selten aus seinem Haus. Momentan lebt er wie ein Einsiedler.“
Nun schön, ein einzelner Mensch würde mich nicht im Urlaub stören.
Langsam gingen wir nebeneinander auf die Cottages zu. Aus der offenstehenden Tür der Scheune watschelte ein Hund, eine kräftige Englische Bulldogge, um sich dann erstaunlich flink in Bewegung zu setzen und sich zu uns zu gesellen. Elenor bückte sich, klopfte dem Tier liebevoll auf den breiten Brustkorb und befreite sein Fell von Strohhalmen.
„Das ist unser Charly, unser Hofhund. Unser Wachhund. Aber eigentlich ein lieber Kerl, vollkommen ungefährlich, auch wenn er bisweilen furchteinflößend aussieht. Er stromert gerne durch das Gelände und wird Sie sicherlich öfters besuchen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ach ja, wenn Sie etwas essen möchten, gibt es einen Pub im Dorf. Der steht auch noch dort, wo er vor zwanzig Jahren gestanden hat“, setzte sie schmunzelnd hinzu. „Und am Nachmittag ist ein kleiner Laden geöffnet. Beides liegt in die Richtung“, sie deutete vage nach links. „Und mittlerweile haben wir uns den Milchmann zurückerkämpft. Also, falls Sie frische Milch benötigen, sagen Sie es mir. Wenn Sie sonst etwas brauchen: Bei uns ist fast immer jemand im Haus.“ Mit diesen Worten schloss Elenor die Tür des Häuschens Nummer zwei auf und zog einen Lappen aus der Tasche ihres Kleides, um zwei Spinnweben in der Ecke neben der Tür zu entfernen. „Es ist September, da fühlen sich die Spinnen hier besonders wohl“, sagte sie entschuldigend und rollte mit den Augen.
Ein lichterfüllter Raum. Sonnenstrahlen auf dem hell gefliesten Boden. Lilafarbener Phlox, dessen Duft mir entgegenströmte. Ein Strauß auf einem Beistelltischchen.
„Was sagen Sie?“ Elenor schaute mich erwartungsvoll an.
Nachdem ich über die Schwelle des Hauses getreten war, ließ ich meinen Blick durch den großen Raum, in dem in der Mitte eine Treppe in das Obergeschoss führte, schweifen. Ein Esstisch mit zwei Bänken, alles aus Kiefernholz, stand unweit der Eingangstür vor dem Sprossenfenster zum Hof. Rote Polster, augenscheinlich neuer Stoff, schmückten die Bänke. Eine funktionale, moderne weiße Küchenzeile und eine cremefarbene Sitzgruppe, bestehend aus Sofa und zwei Sesseln um ein Glastischchen, befanden sich auf der anderen Seite des Raumes zum Garten hin. Eine rote Decke aus Fleece lag für kühlere Stunden auf einem Stuhl bereit. Behagliche Gemütlichkeit. Ein Ort, wo ich mich wohlfühlen würde und zur Ruhe kommen konnte.
„Es ist wunderbar. Ganz wunderbar!“, sagte ich.
„Ich finde den Ausblick herrlich ... Und warten Sie ab, bis Sie hier einen Sonnenuntergang erleben. Dann ist es ein Traum!“
Ich sah durch die gegenüberliegenden Fenster nach draußen. Der Ausblick war tatsächlich das Schönste. Zwei Fenster und eine Flügeltür, gerahmt von weißen hauchzarten Gardinen, gaben den Blick zu der großflächigen Terrasse mit Pool frei. Einladend schimmerte das türkisgrüne Wasser in der Sonne. Auf der Terrasse, die sich an alle Cottages schmiegte, standen Kübel mit roten und weißen Geranien. Ich sah Beete mit Lavendelpflanzen, dick wie Kissen, die vereinzelt noch ihre lilafarbenen Blüten trugen. Dahinter lag die Streuobstwiese, auf der locker gesetzte Apfelbäume wuchsen. Die von Hunderten von Gänseblümchen weiß getupfte Wiese erstreckte sich bis zu der niedrigen Mauer, die das Gelände der Farm umschloss. Und dahinter fiel mein Blick auf die malerische Landschaft: Bis zum Horizont — ja, ich konnte bis zum Horizont schauen, was für ein Luxus — Wiesen und Weiden. Über allem wölbte sich dieser makellose blaue Himmel. Ein Blick wie ein Gemälde. Auch dafür war ich hergekommen. Allein für diesen Blick. Wenn ich mich in eine Landschaft verlieben würde, dann in diese. Aber wahrscheinlich war ich schon verliebt. Schockverliebt. Wie beim letzten Mal vor zwanzig Jahren.
Nachdem sich Elenor verabschiedet hatte, stieg ich mit meinem Koffer die Treppe hinauf in das obere Geschoss, in dem Schlafzimmer und Bad unter der Dachschräge lagen. Der herrliche Duft frisch gewaschener Wäsche breitete sich in der gesamten oberen Etage aus. Auf dem Nachttisch stand auf einer Decke aus weißer Spitze ein kleiner Strauß pinkfarbener Rosen. Blaue Glockenblumen zierten die Bettwäsche auf dem geräumigen Doppelbett. Weiße, flauschige Frotteehandtücher lagen bereit. Alles war da, alles war hübsch.
Ich wuchtete meinen Koffer auf die Ablage und begann den Inhalt in dem Kleiderschrank und der kleinen Kommode zu verstauen.
Als ich mich eine Viertelstunde später im Spiegel am Treppenabgang betrachtete, dachte ich, ich sah viel zu streng aus. Wie eine Gouvernante.
Oder wie eine Karrierezicke.
Ich verdrehte die Augen. Umgehend löste ich meinen Knoten, fand einen weiteren Strohhalm darin, lockerte meine braunen Haare, bauschte sie auf, bis sie mein Gesicht lockig umschmeichelten. Wenn ich jetzt aus meinem Businessoutfit in Freizeitklamotten stieg, sah ich wie eine ganz passable achtunddreißigjährige Frau aus, die sich im Urlaub befand. Meine Schwester Tina hätte mir angesichts dieses Satzes einen Hieb versetzt. Wie oft hatte sie mir erzählt, zwei ihrer Bekannten fänden mich scharf. Ich schnitt eine Grimasse, meine grünen Augen blitzten. In letzter Zeit hatten sie oft einen müden Eindruck gemacht. Vielleicht sah ich tatsächlich jünger als achtunddreißig aus. Womöglich sah ich tatsächlich scharf aus. Der nette Mann vom Flughafen hatte mir augenzwinkernd nachträglich zum dreißigsten Geburtstag gratuliert. Okay, es war schleimig und übertrieben gewesen und wirkte irgendwie wie aus der Zeit gefallen; gefreut hatte ich mich trotzdem.
Während ich mich umzog, trieben Gedanken wie Wellen, die kamen und gingen, durch meinen Sinn. Gedanken an die Arbeit, meine berufliche Zukunft verbot ich mir umgehend, schließlich hatte ich Urlaub. „Urlaub!“, sagte ich laut zu meinem Spiegelbild, um mich selbst noch einmal zu erinnern. Ich dachte an die Unternehmungen der nächsten Tage, wahrscheinlich hatte ich mir wie üblich viel zu viel vorgenommen. Mein Körper sehnte sich nach Ruhe, nach Nichtstun und Schlaf. Meiner Seele erging es nicht anders.
Vielleicht bliebe ich einfach auf dem Hof. Hier war es friedlich und ich fühlte mich von der ersten Sekunde an wohl. Als geradezu tröstlich empfand ich es, dass so vieles beim Alten geblieben war. Es war wie ein Nach-Hause-Kommen. In dieser schnelllebigen Zeit gab es zum Glück Orte, die sich kaum veränderten und die das wohltuende Gefühl der Beständigkeit verströmten. Ich war eben oldschool, sagte meine Schwester, und ich stand dazu. Hier schien das Leben sicher, unwandelbar, vielleicht ein bisschen langweilig. Aber es war das, was ich in meinem eigenen Leben vermisste. Dabei brauchte ich Strukturen, Verlässlichkeit, Kontinuität wie die Luft zum Atmen. Nicht umsonst umgab ich mich mit penibel ausgearbeiteten Listen, auf der Arbeit und in meinem Leben. Mit Spiegelstrichen versehene, akribisch ausformulierte Punkte, die ich nach Erledigung abhaken konnte. Allerdings neigte ich inzwischen dazu, jede Aufgabe in viele kleine Arbeitsschritte zu zerlegen, um möglichst viel abhaken zu können. Nichts befriedigte mehr, als einen Haken hinter ein To-do zu setzen. Ja, so tickte ich. Diese Listen entlockten meinen Mitmenschen regelmäßig Worte des Spotts. Aber das war ich gewohnt.
Und dann gab es noch die eine große Liste. Aber anders als die To-dos meines beruflichen Daseins ließen sich die Punkte meiner Lebensliste nicht ohne Weiteres abarbeiten. Auch wenn ich mir große Mühe gab, ein für mich wichtiges Ziel zu erreichen. Nachdem meine letzte Beziehung auf unschöne Weise in die Brüche gegangen war, war es für eine Weile okay gewesen, Single zu sein. Aber es war kein Zustand, der mir auf Dauer behagte. Seit einem Jahr war ich aktiv auf Partnersuche, hatte mich auf Dating-Apps, sogar auf Tinder rumgetrieben. Ich war beim Speeddating und Slowdating und auf Matching-Partys gewesen, nur um festzustellen, Erfolge dieser Art ließen sich nicht erzwingen. Natürlich nicht. Auch wenn die Vermittlungsagenturen genau das — wissenschaftlich basiertes Matching nannten sie es — versprachen und ich dieses Projekt genauso ernsthaft wie meine Arbeit angegangen war. Liebe passierte eben. Oder auch eben nicht. Nach einem dreiviertel Jahr der aktiven Suche war ich in ein regelrechtes Dating-Burn-Out gerutscht. Ich hatte keine Lust mehr auf verkrampfte Zusammentreffen, das Suchen nach den richtigen Worten, dem Sich-immerwieder-neu-Einlassen auf fremde Männer. Außerdem fehlte mir die Zeit, schließlich hatte ich einen fordernden Job. In einem Monat hatte ich ein Herztrifft-Herz-Wochenende in einem romantischen Hotel in den Alpen gebucht. Ein letzter Versuch. Egal wie er ausginge, im Anschluss würde ich die aktive Suche nach einem Partner ad acta legen. Dafür würde ich eben Karriere machen. Oder ins Ausland für ein Sabbatical gehen. Oder ich könnte mir ein Hobby zulegen: Bienenstöcke auf dem Dach halten oder Gemüse auf meinem Balkon züchten. Es gab immer eine Alternative im Leben.
Mein Coach neigte sich zu wiederholen, wenn er sagte: Ich müsse mehr Spontanität in mein Leben lassen, weniger kontrollieren. Die Zügel locker lassen. Ich müsse auch mal ein Wagnis eingehen. Ohne mich zuvor zu versichern. Ohne zu planen. Einfach einmal springen. Und in Liebesdingen müsse ich mir Zeit geben, mich in Geduld üben. Ich seufzte und warf mir einen aufmunternden Blick im Spiegel zu. Hör auf zu grübeln, ermahnte ich mich, es brachte nichts.
Mein Blick fiel auf die Laufhosen und das Shirt. Kleidung, die ich mir bereits auf dem Stuhl bereitgelegt hatte... Laufen half immer, um auf gute Gedanken zu kommen.
Kapitel 3
Der Raubvogel thronte majestätisch auf dem Holzpflock eines Weidezaunes, die Umgebung fest im Blick. Sein bräunliches Rückengefieder schimmerte in der Abendsonne, die weiße Brust streckte er der milden Brise entgegen, die seine Federn leicht auffächerte. Was für ein Vogel war es? Bussard? Habicht? Ich hatte keine Ahnung.
Da ich nicht wusste, wohin die abzweigenden Feldwege führten, trabte ich in gleichbleibendem Tempo auf der kleinen Landstraße, auf der kaum ein Auto fuhr. Ab und zu begegneten mir Traktoren, deren Fahrer freundlich nickend grüßten oder mir winkten. Engländer waren höflich und rücksichtsvoll und die Wahrscheinlichkeit, noch einmal auf so einen Idioten wie den Porsche-Gorilla zu treffen, ging gegen null. Ich musste Elenor fragen, vielleicht hatte sie einen Tipp für eine gute Laufstrecke. Heute hatte ich einen Rundkurs gewählt und ließ mich vom Navi führen. Sicher war sicher.
Mäuse huschten wie Schatten über die Straße, einmal wäre ich fast auf eine dicke Kröte gesprungen, die sich unter einem überstehenden Grasbüschel gegen den Asphalt duckte. Mücken schwirrten im Licht. In der Luft zog ein weiterer Raubvogel seine Kreise, schraubte sich immer weiter nach oben in das Himmelsblau und stieß dabei lang gezogene Schreie aus.
Wieder diese Idylle.
Die Straße wand sich einen Hügel hinauf. Gut so, ich liebte es, meinen Körper zu fordern. Auf der Anhöhe suchte ich mir einen Findling, der sich zum Stretchen der Beine eignete, und gönnte mir im Anschluss eine Verschnaufpause. Ich betrachtete die zu meinen Füßen liegende Landschaft, diesen grünen Flickenteppich, am Horizont war ein Waldstück ein kleiner Schatten.
Frieden. Harmonie. Der Anblick der Natur im goldenen Abendlicht war Balsam für die Seele. In mir wurde es still. Ich fühlte eine Ruhe in mir hochsteigen, wie ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr empfunden hatte. Es war, als hätte jemand meinen Stecker gezogen, mich vom Netz genommen und flößte mir stattdessen das angenehme, schwere Gefühl der Entspannung ein.
Weiter unten am Hügel entdeckte ich einen Jogger, einige Laufminuten von mir entfernt, der ebenfalls meine Route gewählt hatte. Ich war nicht die Einzige, die sich um diese Stunde sportlich betätigte, dachte ich und setzte mich langsam wieder in Bewegung, nicht ohne in einem letzten Blick auf die Szenerie, dieses harmonische Bild, zu versinken.
Bergab lief es sich leicht. In einiger Entfernung arbeitete ein Traktor auf dem Feld, einen Schleier aus Staub hinter sich herziehend, auf einer Wiese entdeckte ich ein plüschiges Tier und ich benötigte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass es sich bei diesem Flauschball um ein Lama handelte.
Jetzt lief ich der Sonne entgegen, der Asphalt vor mir glänzte im schräg stehenden Licht. Es dauerte nicht lange, bis ich Schritte hinter mir hörte. Es musste dieser Läufer sein, den ich von Weitem gesehen hatte. Mit der Geschwindigkeit, die er an den Tag legte, sollte er mich binnen Sekunden überholen. Ob er mich grüßen würde? Hoffentlich nicht in ein Gespräch verwickeln, ich wollte jetzt alleine sein. Die Straße schlängelte sich nach rechts.
Ich wartete, nichts geschah. Im Gleichklang tönten unsere beiden Schritte auf dem Asphalt. Trab, trab. Trab, trab. Ich spürte den Blick des Joggers unangenehm im Rücken. Wie ich es hasste, wenn jemand direkt hinter ihr lief. Dieser Jemand war nahezu auf meiner Höhe, bemerkte ich am Schatten, der mich rechter Hand begleitete. Warum zog der Typ nicht einfach an mir vorbei?
Abermals schoss eine Feldmaus über die Straße. Ich konzentrierte mich auf meinen Lauf, atmete ruhig und gleichmäßig, hielt den Blick starr nach vorne gerichtet. Wenn der Läufer mich nicht gleich überholte, würde ich stehen bleiben. Als ich das nächste Mal auf die Straße sah, erblickte ich ein sich windendes Etwas.
Himmel! Eine Schlange!
Zu Tode erschrocken keuchte ich laut auf, ich konnte nicht anders. Gleichzeitig machte ich einen ungelenken Satz zur Seite.
Und prallte gegen etwas Festes.
„I’m sorry“, japste ich und sah den anderen Läufer erschrocken an.
Ich erstarrte innerlich mitten im Lauf.
Der Gorilla.
Unverkennbar.
Wieder in diesem grässlichen Jogginganzug, in dem er sich bei den Temperaturen zu Tode schwitzen musste. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß. Die Haare, die ihm nicht nass auf der Stirn klebten, kringelten sich um den Kopf wie die Schlangen bei Medusa.
Ohne meinen Lauf zu verlangsamen, entfuhr mir ein ärgerliches „Schon wieder Sie!“ Eindeutig ein schlechter Scherz des Lebens, diesem Mann ein zweites Mal zu begegnen.
„Als ich Sie von hinten betrachtet habe, ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, dass Sie das sein könnten.“
Jetzt heftete er sich an mich und machte keinerlei Anstalten, sein vorheriges Tempo aufzunehmen. „Sie haben sich ziemlich verändert in den letzten zwei Stunden.“
„Sie dagegen überhaupt nicht!“
Meine Antwort entlockte ihm ein gurgelndes Geräusch.
„Richtig hip sind Sie! Wow!“
Ohne dass ich es verhindern konnte, gab ich ein missbilligendes Schnalzen von mir. Hip! Wer gebrauchte dieses Wort? Hip. Männer wie er, die sich für jung hielten. Männer wie dieser Typ waren alles andere als hip, auch wenn er sich selbst wahrscheinlich für megahip hielt ... Überhebliche, arrogante, männliche Selbsteinschätzung.
„Aber auch in diesem Outfit stellen Sie sich anderen Leuten gerne in den Weg!“
„Das bin ich als Karrierezicke gewohnt, ich habe darin inzwischen eine gewisse Routine!“
Sein Lachen klang wie ein Schnauben durch die Nase.
Mach schon, dachte ich, lauf weiter! Lass mich in Ruhe! Merkst du nicht, dass du gewaltig störst? Aber nein, wie alle Störenfriede merkte er es natürlich nicht. Gleichmäßig trabte er neben mir. Ich würde mir definitiv eine andere Joggingstrecke suchen müssen. Nicht, dass ich ihm von nun an häufiger über den Weg lief. Das fehlte mir gerade noch.
„Ich habe Angst vor Schlangen“, gestand ich und hätte mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Ich war ihm keine Rechenschaft schuldig und unterhalten wollte ich mich erst recht nicht mit ihm. Ich wollte ihn ignorieren. „Ich habe mich erschreckt. Deswegen bin ich zur Seite gesprungen.“
Ich schüttelte innerlich den Kopf über mich. Warum erklärte ich mich?
Ich hörte ihn neben mir abermals auflachen. „Dabei war das Tierchen ganz harmlos ... Und auch keine Schlange, sondern eine Blindschleiche.“
Na gut, Mr Besserwisser.
„Ich mag keine Reptilien!“
„Alles klar.“
Trab, trab. Trab, trab. Mach einen Abgang! Trab, trab. Trab, trab. Die Minuten, die er an meiner Seite klebte, dehnten sich zu einer Ewigkeit.





























