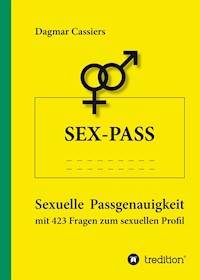
5,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dagmar Cassiers, Diplompädagogin und HP für Psychotherapie Paar-Therapeutin und systemisch-lösungsorientierte Beraterin und Coach in Berlin In meiner langjährigen Tätigkeit als Paartherapeutin komme ich immer wieder mit Menschen in Kontakt, die trotz viel guten Willens einfach keine echte Befriedigung miteinander erleben. Dabei schafft eine sexuell stimmige Beziehung eine Harmonie, die in den Alltag ausstrahlt. Eine erfüllte Sexualität ist eine starke, Beziehung stützende und tragende Basis. Sex macht glücklich oder extrem unglücklich. Je nachdem, ob das Liebesleben richtig rund läuft oder vor sich hin dümpelt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob der Sex "gut" oder "schlecht" ist, sondern ob zwei Menschen sexuell zueinander passen. Mit 423 Fragen gibt das Buch die Möglichkeit, das eigene Sexual-Profil zu konkretisieren und mit dem des Partners oder potenziellen Partners abzugleichen Das führt zum sexuellen Ich und zum sexuellen Du und im Idealfall zum sexuellen Wir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dagmar Cassiers
SEX-PASS
Sexuelle Passgenauigkeit
mit 423 Fragen zum sexuellen Profil
© 2016 Dagmar Cassiers
Umschlaggestaltung, Satz: Mani Wollner, Bonn
Lektorat, Korrektorat: Christian Rief, Ulm
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7345-2004-4
ISBN Hardcover: 978-3-7345-2005-1
ISBN e-Book: 978-3-7345-2006-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Idee zu diesem Sachbuch hatte ich bereits vor 3 Jahren. Dass aus der Idee dann dieses Buch entstanden ist, verdanke ich ...
• der Unterstützung einer Vielzahl meiner Klienten, die mir mit großer Offenheit berichtet haben, was sie schon immer mal über Sexualität wissen wollten und welche Fragen sie dazu sich selbst und ihren Partnern stellen wollen. Und die sich dann als Test-Personen zur Verfügung gestellt haben, um sich mit dem Fragen-Katalog zu beschäftigen,
• der Unterstützung meines Hausarztes, der mir geduldig einige Aspekte der Sexualität aus medizinischer Sicht erklärt hat,
• der Unterstützung meines Sohnes, der den Vorschlag zur Gestaltung des Fragen-Rasters gemacht hat,
• und der Unterstützung meiner Lektorin Sabrina, die mich als Autoren-Neuling sehr professionell, aber auch sehr einfühlsam, wertschätzend und unaufdringlich an die Hand genommen hat.
Der Mythos von der Liebe auf den ersten Blick
Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen in jedem Alter träumen von der großen Liebe auf den ersten Blick. Von diesem entscheidenden ersten Blick zweier sich zufällig begegnender Menschen, der wie ein Blitz aus heiterem Himmel bei beiden gleichzeitig einschlagen und ein loderndes Liebesfeuer entfachen soll, das niemals erlischt, bis dass der Tod uns scheidet.
Das hört sich zweifellos sehr romantisch an und mag tatsächlich schon einmal vorgekommen sein.
Nüchtern betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, die ewig währende Liebe auf den ersten Blick zu treffen, jedoch etwa so groß wie die Jackpot-Gewinnchance bei der Ziehung der Lottozahlen.
Es stimmt, dass wir auf den ersten Blick – genau gesagt in den ersten drei Sekunden einer Erstbegegnung – unser Gegenüber scannen und entscheiden, ob wir an einem Kontakt interessiert sind. Es sind die Äußerlichkeiten, die in diesem Augenblick unsere Entscheidung beeinflussen. Finde ich den anderen optisch attraktiv? Mag ich seine Haar- und Augenfarbe, den verträumten Blick? Sind es die Muskeln, die sich unter dem T-Shirt abzeichnen und meine bewundernden Blicke auf sich ziehen? Sind es die breiten Schultern, die zum Anlehnen einladen? Verzaubert mich das blendend weiße Zahnpastalächeln? Betört mich der Duft des Parfüms oder Rasierwassers?
Die viel zitierten inneren Werte können es zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht sein. Bestenfalls können wir bestimmte Rückschlüsse ziehen. Die Tatsache, dass die Begegnung an einem Ort gemeinsamer Interessen stattfindet, erleichtert die Kontaktaufnahme, weil sich spontan Gesprächsthemen ergeben. Ist es Zufall oder ein Wink des Schicksals, dass wir uns denselben Film, dasselbe Theaterstück, dieselbe Ausstellung anschauen, dass wir dieselbe Sportveranstaltung besuchen, in dieselbe Disco oder Kneipe gehen?
Oder habe ich dem Schicksal auf die Sprünge geholfen, weil ich von Kopf bis Fuß auf Flirten eingestellt bin und Paarungsbereitschaft signalisiere? Und schon sind sie da, die Schmetterlinge im Bauch, die weichen Knie, die Herzchen in den Augen. Das Herz klopft bis zum Hals., die Hormone fahren Achterbahn. Kein Zweifel: Das muss sie sein, die Liebe auf den ersten Blick. Viele warten ein Leben lang vergeblich auf sie – ich hab sie gefunden, hier und heute, und ich lasse sie nie mehr los! Das besiegeln wir bei romantischem Kerzenlicht und teurem Rotwein mit leidenschaftlichen, intimen Umarmungen und Küssen.
Und nun zurück zur Realität. Wissenschaftliche Untersuchungen (Dr. Ben Jones, University of Aberdeen; Prof. Manfred Hassebrauck, Bergische Universität Wuppertal) sorgen für Ernüchterung: Die Liebe auf den ersten Blick ist in der Regel nichts anders als das Ergebnis des Zusammenspiels von Neugier, optischen Ähnlichkeiten und visueller Anziehungskraft. Und zu allem Unglück ist sie oftmals eher einseitig und wird nicht im gleichen Maß vom Objekt der Begierde erwidert. Nur äußerst selten stellt sich spontan und gleichzeitig dieses synchron ablaufende Gefühlsgewitter ein. Das Wunschdenken und die Überzeugung, die „never ending love at first sight“ gefunden zu haben, verklären den Blick und erschweren die Einsicht, sich einseitig in Oberflächlichkeiten verguckt zu haben. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn sich dieses Verliebtsein dann als alltagsuntaugliche Mogelpackung herausstellt, fällt es schwer, die getroffene Partnerwahl als Fehlentscheidung einzugestehen. Der Frust ist groß, dass mich der erste Blick auf die falsche Fährte geführt und mir eine rosa Brille verpasst hat. Wie sagt der Volksmund: Liebe macht blind. Vermutlich gilt das überwiegend für die ersehnte Liebe auf den ersten Blick.
Der erste Blick kann keinesfalls das gesamte Spektrum der beziehungsstiftenden und beziehungsstabilisierenden Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen erfassen, geschweige denn die sexuelle Passgenauigkeit zweier beziehungswilliger Partner. Dafür braucht es mehr als nur einen Blick. Die Liebe auf den ersten Blick macht blind und erweist sich in den meisten Fällen als Strohfeuer. In diesem hormonellen Ausnahmezustand wird Störendes, Trennendes, Unpassendes einfach ausgeblendet nach dem Prinzip Hoffnung: Das wird sich schon irgendwie von alleine regeln. Wenn wir dann die rosarote Brille des Verliebtseins abgelegt haben, stolpern wir immer häufiger über die Passungenauigkeiten. Aber dann stecken wir schon mittendrin in einer Beziehung ...
Zahlreiche Klienten haben mir bestätigt, dass sie erst auf den vierten oder auch erst auf den zehnten Blick die Liebe gefunden haben, die diesen Namen verdient. Und sie haben bestätigt, dass es sich lohnt, den Unterschied zu erkennen zwischen einem heißen Flirt und echtem Interesse, zwischen dem Gefühl von blindem Verliebtsein und dem Gefühl einer passgenauen Beziehung, zwischen einem Strohfeuer und einer lodernden Liebesflamme.
Inhaltsverzeichnis
Ein Mythos
Einführung
Sexualität
Menschliche Sexualität
Entwicklung menschlicher Bedürfnisse
Entwicklung des Sexualverhaltens
Häufigkeit sexueller Kontakte (Sexuelle Quantität)
Sexuelle Beziehungsfallen
Sexuelle Zärtlichkeitsfalle
Sexuelle Machtfalle
Sexuelle Alltagsfalle
Sexuelle Altersfalle
Sexuelle Vertrautheitsfalle
Sexuelle Verlagerungsfalle
Sexuelle Sprachlosigkeitsfalle
Sexuelle Bedürfnisse (Sexuelle Qualität)
Befriedigung und Orgasmus
Intensität des Orgasmus
Wunsch und Wirklichkeit oder sexuelle Funktionsstörungen
Geschichten aus dem Praxisalltag
Kevin und Linda: Sexuelle Gegensätze
Helga: Kurzes Glück
Kristina und Harald: Trennung trotz Liebe
Anita und Paul: Zärtlichkeit und Nähe
Angelika und Werner: Falsche Partner
Karl-Heinz: Die neue Freiheit
Elke und Ralph: No sex
Jutta und Jürgen: Ersatzbefriedigung
Kathrin und Mathias: Unbefriedigte Bedürfnisse
Marlene und René: Passt nicht
Peer und Marion: Bondage
Robert und Heidi: Let’s talk about sex
Silvia und Thorsten: Pornografie
Ellen und Wolfgang und Malte: Buddelkastenfreundschaft
Sexuelle Vorlieben – Das sexuelle Persönlichkeitsprofil
Wesentliche Punkte für eine sexuelle Passgenauigkeit
Da war doch noch etwas – Liebe!
Fragenkatalog – Sexuelle Passgenauigkeit
Zärtlichkeit
Erotik
Petting/Vorspiel
Lust und Leidenschaft/Libido
Intimität, Lust versus Ekel
Voyeurismus und Exibitionismus
Sexuelle Berührung
Küsse
Temperament
Dauer des Sexualaktes – Timing
Sexuelle Praktiken
Sexuelle Stellungen
Sexueller Höhepunkt
Rollenspiele und Fetisch
Sadomasochistische Aspekte
Sexuelle Hilfmittel
Autoerotik in und außerhalb der Beziehung
Die Lust an der Lust des Partners
Verbalsex
Fantasien beim Sex und sexuelle Gedanken
Sexuelles Neugierverhalten
Sexuelle Räumlichkeiten – Ambiente
Passgenaue Äußerlichkeiten
Charaktertyp des Sexualpartners
Monogamie – Polygamie – Seitensprünge – Treue
Gespräche und Wünsche
Verhütung und sexuelle Lust
Bedeutung der Sexualität für die Parnerschaft
Umgang mit dem Fragenkatalog
Meine sexuellen Bedürfnisse
Die sexuellen Bedürfnisse meines Partners
Die sexuellen Bedürfnisse meines potenziellen Partners – Wie finde ich den passgenauen Partner?
Sexuelle Probleme in der Beziehungsberatung
Wie wir Liebe lernen
Jenny und Marc – eigentlich passt alles
Zwiegespräche nach Lukas Möller
Psychographie – wie wir gestrickt sind
Gegenseitiges Gefallen – Gleich und gleich gesellt sich gern
Liebe mit allen Sinnen
Durchsetzen oder anpassen
Was nicht gefragt wird, wird nicht gesagt
Fallbeispiele zur Bedeutung von red, yellow und green flags
Eine Geschichte zum Schmunzeln
Was können wir von den Pinguinen lernen?
Einführung
Leo Tolstoi beginnt seinen Roman „Anna Karenina“ mit dem berühmten Satz: „Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich“. Diese Aussage wird auch als Anna-Karenina-Prinzip bezeichnet und geht davon aus, dass bei den glücklichen Paaren alle Lebensbereiche zusammenpassen müssen, bei den unglücklichen aber schon ein Konfliktbereich reicht, um die Beziehung zu gefährden. Vielleicht ist es aber ganz anders! Vielleicht müssen bei allen glücklichen Paaren nicht alle Lebensbereiche passend sein, und bei den unglücklichen muss nicht irgendein Bereich unpassend sein. Vielleicht handelt es sich jeweils nur um einen besonders zentralen Bereich: die Sexualität. Das heißt glückliche Paare passen sexuell gut zueinander, unglückliche passen sexuell schlecht zusammen. Die anderen Beziehungsbereiche treten hinter diesen zentralen Bereich zurück.
In meiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Beziehungsberatung habe ich den Eindruck gewonnen, dass nur ein sehr kleiner Teil aller Partnerschaften sich als glücklich bezeichnen würde. Diese Menschen trifft man natürlich – weil sie keine Paarprobleme haben – sehr selten in der Beratung. Die restlichen trennen sich über kurz oder lang wieder, lassen sich scheiden oder leben mehr schlecht als recht weiterhin zusammen. Ob die Sexualität der Partner gut oder schlecht zusammenpasst, ist den jeweiligen Paaren überhaupt nicht bewusst. Bei den glücklichen stimmt sowieso alles, und sie erkennen überhaupt nicht den Stellenwert der Sexualität für ihr Glück, die unglücklichen streiten sich über alles und jedes, doch auch ihnen gerät ihre unpassende Sexualität aus dem Blick.
Vielleicht ist die sexuelle Passgenauigkeit das entscheidende Kriterium für glückliche oder unglückliche Partnerschaften. Vielleicht entscheidet das Schlüssel-Schloss-Prinzip der Sexualität, ob es passt oder nicht, ob die Sexualität zum Klebstoff oder Sprengstoff für ein Paar wird. Unzählige Beziehungen werden als unglücklich erlebt, der Beziehungsalltag ist oftmals geprägt von Lustlosigkeit, Lieblosigkeit, verloren gegangener Anziehungskraft und gefühlter innerer Trennung, weil Partner aneinander festhalten, obwohl sie sexuell nicht zusammenpassen. Es gibt zahlreiche Sex-Ratgeber mit Tipps und Tricks, um eine schlechte Beziehung zu reparieren, mit dem Ziel, etwas passend zu machen, was nicht passend ist. Dabei wird lediglich am Symptom herumkuriert, die Ursache bleibt unberücksichtigt.
Sex begegnet uns auf Schritt und Tritt und drängt auch immer mehr in die Medien. Aber was wissen wir von unseren sexuellen Bedürfnissen und erst recht von denen unseres Partners? In keinem privaten Bereich wird so viel geschwiegen, gelogen, getäuscht und betrogen wie in der Sexualität.
Dieses Buch unterscheidet sich von den gängigen Sex-Ratgebern, weil es davon ausgeht, dass jeder Mensch einen individuellen, genetisch disponierten und lebensgeschichtlich bedingten sexuellen Fingerabdruck hat, sein sexuelles Persönlichkeitsprofil. Sexuelle Befriedigung und Treue lassen sich am ehesten in einer Partnerschaft erleben, in der die sexuellen Fingerabdrücke der Partner nahezu deckungsgleich sind.
Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis mit vielfältigsten Möglichkeiten der Befriedigung. Die steigende Zahl gescheiterter Beziehungen gibt Anlass zu der Vermutung, dass der Stellenwert von partnerkompatibler Sexualität als beziehungsstiftendes und beziehungsstabilisierendes Element unterschätzt und vernachlässigt wird. Die viel zitierten Gegensätze verlieren im Beziehungsalltag ihre anziehende Wirkung und stoßen eher ab. Aus Gegensätzlichkeiten werden Unverträglichkeiten.
Je mehr die individuellen sexuellen Bedürfnisse in einer Beziehung divergieren, desto wahrscheinlicher ist das Ausweichen in eine Außenbeziehung. Dabei bekommt das Wort Fremdgehen eine neue Bedeutung. Die Partner fühlen sich fremd in der eigenen Beziehung und gehen auf die Suche nach dem passgenauen sexuellen Pendant, das sie in der Beziehung vermissen.
Eine sexuell stimmige Beziehung schafft eine Harmonie, die in den Alltag ausstrahlt. Partnerschaftliche Unterschiede in anderen Lebensbereichen sind leichter zu kompensieren als sexuelle Unterschiede. Eine befriedigende Sexualität ist eine starke beziehungsstützende und beziehungstragende Basis und gibt der Beziehung eine vielversprechende Zukunftsperspektive.
Dieses Buch gibt bestehenden und zukünftigen Partnerschaften Gelegenheit herauszufinden, wie groß die gemeinsame Schnittmenge an sexuellen Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf Quantität und Qualität ist. Guter Sex, schlechter Sex, häufiger Sex, seltener Sex, verführerischer Sex, langweiliger Sex sind pauschale Kategorisierungen, die keinen Sinn ergeben und nichts darüber aussagen, wie befriedigend der Sex in der Beziehung erlebt wird. Sex ist dann gut, wenn beide Partner ihn als befriedigend erleben. Das kann einmal im Monat sein oder dreimal täglich, das kann der sogenannte Blümchen-Sex oder Sadomaso-Sex sein. Was beide authentisch mögen und wollen, ist erlaubt und wunderbar.
Schlechten Beziehungen mangelt es meistens an befriedigendem Sex. Oftmals orientiert sich individuelle Sexualität an Klischees, an gesellschaftlichen Moralvorstellungen, an familiären Vorbildern, an fremdbestimmten Erwartungen. Es wird viel über Sex geredet und geschrieben, meistens bewertend und vorurteilsbehaftet, häufig ausgehend von Mythen und Schubladendenken. Solange es nur vage Vorstellungen von den Kriterien gibt, die aus einer Paarbeziehung eine sexuell befriedigende Beziehung machen, und solange darüber Sprachlosigkeit herrscht, werden beide Partner enttäuscht sein. Entweder resignieren sie und arrangieren sich mit ihrer Enttäuschung, oder sie gehen in die Offensive und beschuldigen sich wahlweise gegenseitig als Versager, Opfer oder Fremdgänger.
Zuallererst ist es sinnvoll, die eigenen sexuellen Bedürfnisse aufzuspüren, zu entdecken, zu analysieren, um dann gemeinsam zu schauen: Auf welche Weise können wir uns gegenseitig sexuell gut tun, damit die Sexualität zum Klebstoff in der Beziehung wird? Was ist sexuell wichtig, auf was können wir verzichten? Und zwar ganz authentisch, ohne faule Kompromisse, ohne vorübergehende Anpassungsleistungen und Zugeständnisse, die uns Überwindung kosten, ohne Vortäuschung falscher Tatsachen, denn sonst wird die Sexualität zum Sprengstoff in der Beziehung. Es geht darum, konkret anzusprechen, auszusprechen und herauszufinden, welchen gemeinsamen sexuellen Nenner die Partner aufgrund ihres individuellen sexuellen Bedürfnisprofils in die Beziehung mitbringen.
Das Buch hat eine Lotsenfunktion bei der Entdeckung sexueller Bedürfnisprofile. Die Fragen dazu sind sehr konkret, sehr direkt und detailliert und können sowohl alleine als auch von Paaren gemeinsam oder in einem therapeutischen Setting beantwortet werden. Ehrliche Antworten auf die strukturierten und kategorisierten Fragen bringen Klarheit und Entmystifizierung in einen Lebensbereich, der von enormer Bedeutung für individuelle und partnerschaftliche Lebenszufriedenheit ist. Der ausgefüllte Fragenkatalog stellt gleichsam einen Sex-Pass der eigenen sexuellen Persönlichkeitsstruktur dar.
Die Kenntnis vom eigenen sexuellen Bedürfnisprofil kann von vornherein hilfreich bei der Partnerwahl sein. Damit erhöht sich die Chance, dass Schloss und Schlüssel sich finden und optimal zueinander passen. Bei unglücklichen Beziehungen kann die Kenntnis von der Unterschiedlichkeit der sexuellen Bedürfnisprofile ein wichtiger Impuls sein, um vorwurfsfrei die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und gemeinsam nach Lösungen im Umgang miteinander zu suchen.
Zunächst wird auf die Bedeutung der Sexualität im Allgemeinen und die menschliche Sexualität im Speziellen eingegangen. Im Weiteren folgt die Darstellung der gesellschaftlichen Entwicklung der Sexualität und der Sexualmoral in den letzten Jahrzehnten – besonders unter Berücksichtigung der Situation im Nachkriegsdeutschland.
Die Unterschiede im sexuellen Verhalten lassen sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Zunächst geht es in dem Buch um die quantitativen Unterschiede, die unterschiedliche Libido und die Wünsche nach der Häufigkeit sexueller Kontakte. Eine große Rolle spielen dabei auch einschleichende Veränderungen, die ich „sexuelle Beziehungsfallen“ nenne. Unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse und Wünsche, die Frage nach Befriedigung und Orgasmus und die Intensität des Orgasmus werden erläutert. Ein weiteres Kapitel bezieht sich auf die Frage nach Wunsch und Wirklichkeit in der Sexualität und erläutert die Frage der sogenannten sexuellen Funktionsstörungen.
Ein wesentliches Kapitel bezieht sich auf meine Erfahrungen aus der Paartherapie. Da ich die Frage nach der Sexualität immer sehr direkt anspreche, bekomme ich auch oft sehr direkte und ehrliche Antworten. Diese Erlebnisse führten auch dazu, dass ich das Thema der sexuellen Passgenauigkeit näher betrachtet und dieses Buch geschrieben habe. Alle Geschichten sind natürlich anonymisiert, entsprechen aber authentischen Berichten aus meiner Praxis.
Die sexuellen Wünsche sind so spezifisch, vielfältig und unterschiedlich wie unsere Gene. Das heißt, es gibt niemals zwei Partner, die identisch sind. Im Kapitel „Sexuelle Vorlieben“ zeige ich die Bestandteile sexueller Wünsche und Strukturen auf. Mit Hilfe des Fragenkatalogs kann jeder für sich seine Wünsche klären und sie mit denen seines Partners abgleichen. Wenn die individuellen Teilaspekte wieder zusammengesetzt werden, ergibt sich daraus die persönliche sexuelle Struktur.
Abschließend gehe ich der Frage nach, wie man mit dem Fragebogen umgehen und welche Konsequenzen man daraus ziehen kann. Außerdem beschäftige ich mich mit dem Thema der sexuellen Passgenauigkeit im Zusammenhang mit unterschiedlichen Bindungstypen und deren Bedeutung für die Paartherapie.
Zur besseren Lesbarkeit und Klarheit habe ich auf die ständige Wiederholung der weiblichen und männlichen Form von Worten wie „mein Partner/meine Patnerin“ oder – noch sperriger – „mein/e Partner/in“ verzichtet und in der Regel die männliche Form „Partner“ für beide Geschlechter verwendet.
Sexualität
Die Sexualität gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen.
In der ersten Entwicklungsstufe der Lebewesen konnten sich die Einzeller vor rund 600 Millionen Jahren nur durch Zellteilung vermehren. Mit jeder Zellteilung entstand eine neue, identische Zelle. Eine genetische Weiterentwicklung oder Anpassung an veränderte Umweltbedingungen war so nicht möglich.
Erst die geschlechtliche (sexuelle) Fortpflanzung führte bei den Nachkommen zu neuen genetischen Verknüpfungen und damit zu Variationen neuer Erbanlagen. In der Konfrontation mit der belebten und unbelebten Umwelt konnten sich so über viele Millionen Jahre immer besser angepasste Individuen entwickeln. So hatten zum Beispiel Lebewesen mit längerer Lebensdauer auch die besseren Voraussetzungen für die geschlechtliche Weitergabe ihrer Erbinformationen. Die Sexualität, also die Möglichkeit der geschlechtlichen Weitergabe und Entwicklung der Gene, verbesserte die Fort- und Weiterentwicklung der jeweiligen Art. Auch bei den Menschen gehört Sexualität damit natürlich zu den existentiellen Grundbedürfnissen.
Grundbedürfnisse sind die vitalen Bedürfnisse der Lebewesen, die der Erhaltung des Individuums und der Erhaltung der Art dienen. Vom biologischen Ansatz her ist das Interesse des Individuums der Arterhaltung untergeordnet. Langfristig gilt in der Biologie immer das Ziel, die eigene Art gegenüber anderen Arten in eine Vorteilsposition zu bringen. Das Individuum muss jedoch auch ausreichende Lebensbedingungen haben, um die Nachfahren großziehen zu können. Zu diesen existentiellen Dingen zählen z. B. Nahrungs-, Flüssigkeits- und Sauerstoffzufuhr, Schlaf- und Erholungsmöglichkeiten, Schutz vor zu großer Hitze und Kälte und Schutz vor Krankheiten und anderen Bedrohungen.
Der Sexualtrieb gehört zu den angeborenen Instinkten. Auch Lebewesen, die völlig isoliert großgezogen wurden, finden ohne Anleitung zur sexuellen Vereinigung. Ausgelöst durch entsprechende Schlüsselreize kommt es zu sexuellen Handlungen, die im Gegensatz zum Essen, Trinken, Atmen und Schlafen primär der Vermehrung und Arterhaltung dienen. Sekundär dient die Erzeugung der Nachkommenschaft aber auch dem Wohlergehen der erzeugenden Individuen, also der Elterngeneration. Mit zunehmendem Alter sind diese nämlich auf die Hilfe der Jüngeren angewiesen. Zum einen muss eine kontinuierlich erzeugte Nachkommenschaft die älteren Gemeinschaftsmitglieder unterstützen, zum anderen müssen die Älteren die Jungen anlernen und ihre Erfahrungen weitergeben.
Die biologische Funktion der Sexualität dient also der Selbsterhaltung der Art und der Verbesserung der Lebensbedingungen von Gruppen und Individuen innerhalb der Art. Bei der Auswahl der Partner für die sexuelle Vereinung sind vermeintliche genetische, konstitutionelle und soziale Eigenschaften von Bedeutung. Der Wunsch nach Schutz vor Feinden, Verbesserung der Aufzuchtbedingungen und Ressourcenbeschaffung spielen bei der geschlechtlichen Partnerwahl eine entscheidende Rolle. In der Steinzeit waren daher die Auswahlkriterien relativ einfach zu verstehen. Der große, starke Häuptling mit der dicken Keule bot natürlich offensichtliche Vorteile, wie auch auf der anderen Seite die rundliche, temperamentvolle Frau mit dem gebärfreundlichen Becken. Rundlich war angesagt, um über den langen Winter zu kommen, und stark sowieso. Seither hat sich das Leben erheblich verändert, und auch die Attraktivität eines vermeintlichen Sexual- oder Lebenspartners war über Jahrtausende einem starken sozialen und ökonomischen Wandel unterworfen. Das Leben ist vielschichtiger geworden, und die Auswahlkriterien wesentlich komplizierter.
Körperliche Stärke allein zählt nicht mehr. Intelligenz, Wissen und Machtstrukturen sind bei der Partnerwahl wichtig, Äußerlichkeiten lassen sich leicht ändern und unterliegen Modeströmungen. Die menschliche Vielfalt, die veränderten Lebensbedingungen und die allgemeine soziale Vielschichtigkeit erschweren zunehmend die sexuelle Partnerwahl. Die darwinistischen Gesetze der Weitergabe der stärksten und mächtigsten persönlichen Merkmale wurden durch Medizin, technischen Fortschritt und soziale Veränderungen modifiziert. Es setzt sich nicht nur das Starke durch, das Schwache wird durch neue Möglichkeiten kompensiert. Wer körperlich nicht besonders gut zum Jagen oder Kämpfen geeignet ist oder nicht den archaischen Schönheitsidealen entspricht, kann heutzutage auf dem Partnermarkt eventuell trotzdem sehr attraktiv sein. Reichtum ist nicht mehr an körperliche Stärke, sondern oft an ökonomische Herkunft oder Intelligenz gebunden.
Menschliche Sexualität
Während im Tierreich die Sexualität im Wesentlichen durch die genetisch veranlagten Triebe geprägt und gesteuert ist, hat sich mit der Menschheitsentwicklung ein ausgesprochen kompliziertes sexuelles Geflecht gebildet.
Mit der Entwicklung des menschlichen Gehirns zu differenzierten Denk- und Gefühlsleistungen, mit der Entwicklung eines umfänglichen Gedächtnisses, mit der Entwicklung der Sprache und dem Festhalten von menschlichen Erfahrungen in Bild und Schrift streben die menschlichen Verhaltensweisen in eine unendliche Vielfalt.
Diese Vielfalt wird getragen durch eine große Zahl unterschiedlich strukturierter Individuen: Menschen mit unterschiedlichen Gefühlen, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Menschen mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen, Menschen, die in unterschiedlichen Teilen der Erde, in unterschiedlichen Kulturen und Religionen und sozialen Schichten aufgewachsen sind. Diese Menschen besitzen unterschiedliche genetische Voraussetzungen und unterscheiden sich zusätzlich noch in einem wesentlichen Punkt: dem Geschlecht. Mann und Frau unterscheiden sich genetisch, kulturell und sozial in ihren Entwicklungsbedingungen.
Entwicklung menschlicher Bedürfnisse
Jeder von uns macht immer wieder die Erfahrung, dass wir besonders leistungsstark und erfolgreich sind, wenn unsere individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten in unterschiedlichen Lebenssituationen zum Tragen kommen, idealerweise in Kombination mit Lust und Spaß. Schon Säuglinge handeln nach dem Prinzip der Lust- und Bedürfnisbefriedigung, wenn sie gestillt werden, Körperkontakt suchen und entdecken, dass das Lutschen am eigenen Daumen sehr angenehm ist.
Die Fähigkeit, sich an unseren individuellen Bedürfnissen orientieren zu können, muss sich entwickeln dürfen. Dazu braucht es ein verständnisvolles und tolerantes soziales Umfeld, in dem Raum und Möglichkeit zum Ausprobieren zur Verfügung stehen. Immer häufiger bestätigt sich im Rahmen meiner therapeutischen Tätigkeit, dass das Fördern, Zulassen und Aushalten individueller Bedürfnisse sowohl im privaten als auch im institutionellen Rahmen auf Ablehnung und Widerstand, mindestens aber auf Einschränkung stößt.
Individuelle Bedürfnisse müssen sich vielmehr institutionellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen unterordnen. Das wird spätestens mit dem Schuleintritt deutlich. Grundsätzlich sind Kinder wissbegierig und neugierig und wollen lernen. Schulunterricht orientiert sich jedoch weitestgehend an Vorgaben von politischer Ebene. Von Kindheit an wird uns die Fähigkeit abtrainiert, lust- und bedürfnisorientiert zu lernen und zu handeln. In den Vordergrund treten stattdessen fremdbestimmte Anpassungsleistungen.
Kinder, die die eigenen Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse des Schulsystems unterdrücken, fallen oftmals durch schlechte Schulnoten, mangelnde Motivation und Lernbereitschaft oder fehlende Aufmerksamkeit und Konzentration im Unterricht auf. Diese Auffälligkeiten werden dann als Störung wahrgenommen, die behandelt und „wegtherapiert“ werden muss, so der Anspruch von Schule und Elternhaus.
Dabei haben Schulkinder ganz konkrete Vorstellungen davon, wie ihre Lernbereitschaft erhalten und gefördert werden kann: Der Unterricht soll spannend sein, die Themen zeitgemäß und altersgerecht, und die Unterrichtsmethoden sollten alle Sinnesorgane ansprechen, sie sollten fördern ohne Unter- oder Überforderung und Spaß machen. Dieses frühe Abtrainieren unserer Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu entdecken, stellt die Weichen für den späteren Umgang mit Bedürfnissen.
Was Hänschen nicht erfahren und ausprobieren durfte, muss Hans sich nun mühsam erarbeiten: die Fähigkeit, Bewusstsein und Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Das schließt ausdrücklich die individuellen sexuellen Bedürfnisse ein. Die Kenntnis der eigenen sexuellen Bedürfnisse sollte die Haltung, Wahrnehmung und Kommunikation beim Beziehungsaufbau zu einem Partner oder einer Partnerin schärfen.
Auf der Grundlage genetischer Unterschiede, hormoneller Beeinflussung sowie sozialer und kultureller Unterschiede ist die menschliche Sexualität so individuell wie die menschlichen Fingerabdrücke. Ich behaupte, dass es – ähnlich wie bei den Fingerabdrücken – keine gleich strukturierte Sexualität zwischen zwei beliebigen Menschen auf der ganzen Welt gibt, sondern höchstens Ähnlichkeiten.
Wenn diese eigentlich naheliegende Aussage stimmt, hat die möglichst hohe Ähnlichkeit oder sexuelle Passgenauigkeit zwischen zwei Partnern eine viel größere Bedeutung, als ihr allgemein in der Gesellschaft zugemessen wird. Je passender die Sexualität bei der Partnerwahl, desto besser ist die Lebensqualität, Sicherheit und Überlebenswahrscheinlichkeit der Partnerschaft, desto stimmiger, befriedigender und stabiler ist die Beziehung zwischen zwei Menschen und hält, wenn gewünscht, im Extremfall lebenslang.
Berechtigt ist natürlich die Frage: Was ist eigentlich Sex? Sex bezeichnet sexuelle Handlungen die ein Mensch alleine, zu zweit oder mit mehreren Partnern ausübt. Sex dient der Befriedigung sexueller Lust (Libido), der Fortpflanzung und der sozialen Interaktion. Er kann angenehme Gefühle der Lustbefriedigung, der Zärtlichkeit, der Zuneigung und der Liebe auslösen. Die Sexualpraktiken, die zu diesen Gefühlen führen, können sehr unterschiedlich sein. Sensible, verbale, visuelle, Geschmack und Geruch betreffende Aspekte spielen dabei eine entscheidende Rolle. Eine genauere Differenzierung und Klassifizierung der unterschiedlichen partnerschaftlichen sexuellen Vorlieben ist ein wesentlicher Teil des vorliegenden Buches. Sie soll in Form eines Fragebogens helfen, sexuelle Wünsche, Vorlieben und Fantasien zu erkennen und mit seinen Partnern abzuklären.
Wir lernen in der Schule, wie es die Bienen oder die Schmetterlinge „machen“, und wir lernen, wie es die Blumen und die anderen Pflanzen „machen“. In aufgeklärten Schulen lernen wir manchmal auch, wie es die Menschen „machen“. Aber ist das bei den Menschen wirklich so einfach wie bei den Schmetterlingen?
Die Tiere folgen ihren Trieben und vermehren sich, wie es ihnen ihre Natur vorgibt. Die Menschen hingegen haben durch ihr Denken und Fühlen der Sexualität einen zentralen Stellenwert in ihrem Leben gegeben. Diente der sexuelle Trieb anfangs nur der Fortpflanzung, so entwickelte sich später in der Befriedigung der sexuellen Triebe ein Lustgewinn, der in seinen vielfältigen Formen zur Selbstverwirklichung von Individuen und Paaren in den Mittelpunkt rückte. Vielleicht ist das Geheimnis langjähriger glücklicher Partnerschaften viel stärker von der Kompatibilität sexueller Strukturen und Bedürfnisse, also der sexuellen Passgenauigkeit der beiden Partner bestimmt, als allgemein angenommen wird.
Traditionelle Partnerwahlen waren, was die sexuelle Kompatibilität anbelangt, oft Zufallsprodukte – bestimmt von den Eltern oder der Familie oder Liebesheiraten ohne ausreichende Klärung von sexuellen Wünschen und Passgenauigkeit. Selbst heute wissen Paare mit sexuellen Vorerfahrungen wenig über ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse und erst recht nichts über die Wünsche und die exuelle Struktur der Auserwählten.
Entwicklung des Sexualverhaltens
In den Nachkriegsjahren haben sich das Bewusstsein für Sexualität und das sexuelle Verhalten in Deutschland erheblich verändert. Nach den ersten Jahren des Wiederaufbaus und der beruflichen und ökonomischen Neuorientierung rückte das Thema Sexualität zunehmend wieder in das öffentliche und private Interesse. Es gab jedoch enorme Unterschiede in der gesellschaftlichen Entwicklung in den zwei Teilen Deutschlands.
In der Bundesrepublik Deutschland schwappte in den sechziger Jahren eine Aufklärungswelle über das Land. Es gab Aufklärungsserien von Oswalt Kolle in den Zeitschriften Quick und Neue Revue. Später waren seine sensationellen Aufklärungsfilme in aller Munde und führten zu einer zunächst noch zaghaften Auseinandersetzung über sexuelle Verhaltensweisen. Es folgten die Bücher „Dein Mann, das unbekannte Wesen“ und „Deine Frau, das unbekannte Wesen“. Die damals allgemein diskutierten Inhalte der Aufklärungsfilme, Zeitschriften und Bücher waren ein relativ unverfänglicher Anlass, um über das Thema Sexualität gesellschaftlich und privat ins Gespräch zu kommen.
Eine weitere Veränderung wurde durch die vereinfachte Schwangerschaftsverhütung mit der Verbreitung der Pille in den sechziger Jahren ausgelöst. Ab Ende des Jahrzehnts gab es einen neuen Schub für die sexuelle Aufklärung Jugendlicher. Die Jugendzeitung Bravo veröffentlichte die wöchentliche Kolumne von „Dr. Sommer“ zu sexuellen Themen. In diesen Beiträgen wurden durch die Fragen der Leser und die entsprechenden Antworten von „Dr. Sommer“ ganz offen und direkt die „heißen Eisen“ angegangen. Zeitweise trafen drei- bis fünftausend Fragen monatlich in der Redaktion ein. Die Zeitschriften gingen von Hand zu Hand und stellten eine neuartige sexuelle Informationsquelle außerhalb der Pornografie des Rotlichtmilieus dar. Das Unaussprechliche um die Sexualität stand dort schwarz auf weiß und teilweise auch noch durch Bilder illustriert. Die Jugendlichen stellten sich Fragen, die sie mit Hilfe der Bravo beantworten konnten: Was ist Sexualität? Wie sind sexuelle Gedanken und Handlungen zu bewerten? Wie funktioniert „es“? Was gibt es für Unterschiede? Was will ich? Was könnte mein Partner oder meine Partnerin wollen? Wie kann ich sicher verhüten? Wie geht das mit dem Petting?
Mit der Protest- und Studentenbewegung der 68er kam auch noch eine politische Dimension der Sexualität hinzu. Mit der Forderung nach Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen wurde auch die Befreiung von sexuellen Zwängen verbunden. In den Gründungen der ersten Kommunen (K1, K2 etc.) wurde eine freie Sexualität proklamiert und teilweise auch ausprobiert. Sätze wie „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“ oder „Make love, not war“ spiegeln die Politisierungsversuche dieser Zeit wider. Bücher wie Kentlers „Sexualerziehung“ oder Amendts „Sexfront“ dienten in den siebziger Jahren der Verbindung von sexueller Aufklärung mit politischer Aufklärung und Aktivierung. In der Kinder- und Schülerladenbewegung wurde die antiautoritäre Erziehung propagiert. Es wurde mit radikaler sexueller Aufklärung und „freier“ Sexualität experimentiert, und es wurden die damit zusammenhängenden Fragen endlos diskutiert.
Gerade in Studentenkreisen entwickelte sich ein anderer Umgang mit der Sexualität zu einem zentralen Thema. Freie Kommunen und Wohngemeinschaften, Gruppensex, mehrköpfige sexuelle Lebensgemeinschaften, offene Beziehungen und Ehen wurden erprobt. Anfang der achtziger Jahre kam mit dem AIDS-Schock ein Dämpfer für die Entwicklung „freier“ Sexualität. Nun konnte man nicht mehr ganz unbefangen mit jedem Partner ins Bett springen. Gleichzeitig zerfielen zunehmend die Modelle von neuen Partnerschaftsformen. Sie erwiesen sich im Alltagsleben als zerbrechlich und unverbindlich. Gruppenzwänge, sich entwickelnde hierarchische Gruppenstrukturen und Egoismen zeigten, wie groß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein kann, und wie schwierig es ist, neue Lebensformen zu schaffen.
In der DDR entwickelten sich mit dem Bemühen um den Aufbau des Sozialismus ganz andere gesellschaftliche Voraussetzungen. Die offiziellen politischen Vorgaben waren reguliert und überwacht. Das soziale System sicherte die ökonomische Existenz, die Kinderbetreuung und Krankenversorgung. Soziale Absicherung, Ausbildung und Arbeitsbeschaffung waren umfassend geregelt. Daneben entwickelte sich eine Parallelwelt des Privaten. Die engen privaten Verbindungen waren wichtig, um die Schwierigkeiten im Versorgungssystem aufzufangen. Viele Dinge regelten sich nach dem Prinzip der Tauschgesellschaft, und die Menschen rückten enger zusammen.
Im Bereich der sexuellen Aufklärung und Befreiung war gegen die offiziellen Moralvorgaben die freie Körperkultur entstanden. Mit der Nacktbadekultur wurde auch das Recht auf Gestaltung der Privatsphäre ohne staatliche Einmischung demonstriert. In Ermangelung eines Marktes für sexuelle Waren (Pornografie, Sex-Shops und Sexartikel) entwickelte sich eine eher bodenständige, urwüchsige Sexualkultur.
Es existierte aber keine staatliche Sexualitätsfeindlichkeit. Ab Anfang der siebziger Jahre gab es in der Zeitschrift „Junge Welt“ 20 Jahre lang die Rubrik „Unter vier Augen“. Weitgehend frei von jeder Zensur wurden hier, ähnlich wie in der Bravo, die sexuellen Fragen der Leser beantwortet.
Die Pille gab es in der DDR kostenlos, die Jugendlichen hatten im Durchschnitt früher sexuelle Erfahrungen als ihre Altersgenossen im Westen. Die Ehe wurde oft früh geschlossen, durchschnittlich mit 22 Jahren. Weil man keine Angst vor einem Karriereknick hatte, wurden auch die Kinder früher als im Westen geboren. Das hatte wiederum eine hohe Scheidungsrate zur Folge, weil es bei vielen jungen Paaren schnell zu Konflikten und Trennungen kam.
Wahrscheinlich war die Sexualität im Osten mit weniger Leistungsdruck befrachtet. Sie war nicht belastet durch Emanzipation und den Kampf der Geschlechter, sie war einfach weniger kopflastig. Der ostdeutsche Sex-Experte Prof. Kurt Starke formulierte es so: „Frauen, die in der DDR aufwuchsen, sind in der Partnerschaft und beim Sex viel selbstbestimmter als Geschlechtsgenossinnen im Westen. Ich sage es mal flapsig: Die Ostfrau redet nicht stundenlang über den Orgasmus – sie lässt ihn einfach zu“.
Nach der Wiedervereinigung kam es zu enormen Veränderungen und einer langsamen Annährung in den Lebensumständen und Vorstellungen. Die Anfänge waren schwer. Die Zeitschrift „SUPERillu“, die vorwiegend im östlichen Deutschland gelesen wird, machte 1991 eine Umfrage zu den Partnerwünschen. Es stellte sich heraus, dass 75 % der Ostfrauen lieber einen Ostpartner und 80 % aller Ostmänner lieber eine Ostpartnerin hätten. Ganz allmählich werden die Grenzen in den Köpfen der Menschen aber durchlässiger. Die unterschiedlichen, teilweise auch über die Folgegenerationen tradierten Erfahrungen existieren jedoch noch weiter. Es kommt aber zu einer zunehmenden sexuellen „Vermischung“ von Ost und West, was die Wahrscheinlichkeit der sexuellen Passgenauigkeit zwischen diesen Partnern nicht gerade erhöht.
Spätestens in den neunziger Jahren war die feste Zweierpartnerschaft auch im Westen wieder das kaum in Frage gestellte, dominierende Lebensmodell. Nun war es wieder wichtig, nicht nur einen kurzfristigen „Lebensabschnittspartner“ zu finden. Das Modell „lebenslang miteinander glücklich sein“ wurde wieder populär, jetzt aber auf einer höheren, aufgeklärten Ebene. Viele Frauen hatten den Prozess der Emanzipation durchlebt. Gefragt war nun die Beziehung auf Augenhöhe. Die alte Rollenverteilung, bei der sich die Frau den Wünschen des Mannes unterzuordnen hatte, wurde nicht mehr akzeptiert. Für das Sexualleben hieß das natürlich: Ich muss mich mit den Wünschen meines Partners auseinandersetzen. Das wiederum heißt natürlich auch: Ich muss sie erst einmal kennen. Und was will ich eigentlich selbst?
Viele Männer freundeten sich mit der eher weiblichen, passiven, sanfteren oder zärtlichen femininen Rolle an und schlüpften sexuell in eher weibliche Verhaltensmuster. Viele Frauen waren erstaunt. Wo waren die früher so verachteten Machos? Und was sollte „frau“ nun mit den neuen „Weicheiern“ anfangen? Die ganz Klugen wussten es gleich: So geschlechtsspezifisch sind die Wünsche zwischen Frauen und Männern überhaupt nicht, aber es gibt eben gewaltige Unterschiede bei Wünschen und Verhaltensweisen innerhalb der Geschlechtsgruppe sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Natürlich existieren auch nach wie vor einige geschlechtstypische Merkmale.
Es ist also sehr wichtig, ein wenig mehr Klarheit in die verwobenen Strukturen menschlicher Sexualität zu bekommen, wenn man sich glücklichere Beziehungen in der Gesellschaft wünscht.
Häufigkeit sexueller Kontakte (Sexuelle Quantität)
Betrachten wir zunächst die quantitativen Bedürfnisse. Das ist auf den ersten Blick noch relativ übersichtlich. Wie stark ist die Triebkraft des Einzelnen? Wie viel Lust habe ich, und wie viel Befriedigung meiner Lust brauche ich? Sicherlich spielen bei dieser Frage individuelle genetische Veranlagungen, aber natürlich auch die individuellen kulturellen und sozialen Vorgaben eine Rolle.
Aber was heißt „wie viel Lust“, und wann ist sie befriedigt? Woran liegt es, wenn Mick Jagger singt: „I can’t get no satisfaction“? Hat er die „falschen“ Bedürfnisse, hat er die „falschen“ Partnerinnen, oder steht er einfach seinen Trieben und den Befriedigungsmöglichkeiten hilflos gegenüber?
Wenn die sexuellen Triebe auch ein angeborenes menschliches Grundbedürfnis sind, so unterscheiden sie sich doch sehr deutlich in ihrer Intensität. Die Triebenergie, also die Libido, kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Durchschnittlich ist sie, wenn man den entsprechenden Umfragen trauen kann, heutzutage in den meisten Gesellschaften bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Das Denken und Fühlen dreht sich bei dem „durchschnittlichen“ Mann viel häufiger und intensiver um die Sexualität. Im Journal of Sex Research vom Januar 2012 wurde über eine Befragung von 283 Studenten im Alter von 18 bis 25 Jahren berichtet. Die Befragung ergab, dass die männlichen Studenten ungefähr doppelt so häufig am Tag an Sex dachten wie die weiblichen. Der Studie nach denken männliche Studenten 18,6 Mal, weibliche 9,9 Mal täglich an Sex.
Als Erklärung für dieses Phänomen dient oft die artspezifische Entwicklung der Menschheit mit der Bedeutung der männlichen Dominanz. Auch biologische Unterschiede der Hormone bei Frauen und Männern (z. B. die Wirkung des Testosterons) spielen eine Rolle und ganz sicher die sozialen Einflüsse der individuellen Entwicklung.





























