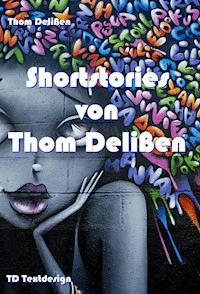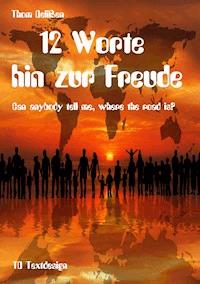Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TD Textdesign
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Themen
- Sprache: Deutsch
Sexualität [zɛks-] (sinngemäß "Geschlechtlichkeit", von spätlat. sexualis;aus lat. sexus "Geschlecht"; vgl. Sex) bezeichnet im engeren biologischen Sinne die Gegebenheit von (mindestens) zwei verschiedenen Fortpflanzungstypen (Geschlechtern) von Lebewesen derselben Art, die nur jeweils zusammen mit einem Angehörigen des (bzw. eines) anderen Typus(Geschlechts) zu einer zygotischen Fortpflanzung fähig sind. Hier dient die Sexualität einer Neukombination von Erbinformationen, die aber bei manchen Lebensformen auch durch der Sexualität ähnliche, nicht polare, Rekombinationsvorgänge ermöglicht wird. Im sozio- und verhaltensbiologischen Sinne bezeichnet der Begriff die Formen dezidiert geschlechtlichen Verhaltens zwischen Geschlechtspartnern. Bei vielen Wirbeltieren hat das Sexualverhalten zusätzliche Funktionen im Sozialgefüge der Population hinzugewonnen, die nichts mehr mit dem Genomaustausch zu tun haben müssen, so dass dann die handelnden Partner auch nicht unbedingt unterschiedlichen Geschlechts sein müssen. Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Zwischenmenschliche Sexualität wird in allen Kulturen auch als ein möglicher Ausdruck der Liebe zwischen zwei Personen verstanden. Evolution der Sexualität Die Herausbildung der Sexualität ist einer der Hauptfaktoren und gleichzeitig ein Ergebnis der biologischen Evolution. Die Entstehung von genetisch unterschiedlichen Geschlechtern und Paarungstypen gilt als Ausgangspunkt für die Entwicklung höherer Lebewesen aus ursprünglich geschlechtslosen Einzellern, die sich nur asexuell (vegetativ) fortpflanzen. Auf der Ebene der Einzeller, besonders bei den Ciliaten, gibt es auch Arten mit mehr als zwei unterschiedlichen Paarungstypen und abgestufter Fähigkeit zur Bildung von Zygoten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3574
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thom Delißen
Sexualität
Themenzusammenfassung
Peaceway
1. Auflage
2016 by TD Textdesign
Inhalt
1. Sexualität
2. Geschlechtsverkehr
3. Vagina
4. Anus
5. Sexualität des Menschen
6. Sexuelle Selektion
7. Zirkumzision
8. Weibliche Genitalverstümmelung
9. Geschlechterrolle
10.Begattung
11.Embryogenese (Mensch)
12.Geburt
13.Insemination
14.Penis
15.Sexualpraktik
16.Sexualpartner
17.Mann
18.Frau
19.Person
20.Wifesharing
21.Lebewesen
22.Körpergeschichte
23.Soziobiologie
24.Verhaltensbiologie
25.Sozialverhalten
26.Sexuelle Orientierung
27.Geschlechtliche Fortpflanzung
28.Sexualethik
29.Klimakterium virile
30.Biologie
31.Menschliche Geschlechts-unterschiede
32.Zeugung
33.Geschlechtsmerkmal
34.Humanbiologie
35.Genom
36.Humanwissenschaft
37.Grundbedürfnis
38.Interaktion
39.Instinkt
40.Empfindung
41.Unzucht
42.Todsünde
43.Zärtlichkeit
44.Wollust
45.Eifersucht
46.Schamgefühl
47.Begierde
48.Psyche
49.Liebe
50.Emotion
51.Soziale Norm
52.Intimität
53.Körperkontakt
54.Keuschheit
55.Lust
56.Vertrauen
57.Partnerschaft
58.Ehe
59.Sozialstruktur
60.Sexuelle Dysfunktion
61.Libido
62.Homosexualität
63.Bisexualität
64.Pansexualität
65.Pansexualismus
66.Transsexualität
67.Heterosexualität
68.Asexualität
69.Intersexualität
70.Infantile Sexualität
71.Sexualpräferenz
72.Hormon
73.Primaten
74.Bonobo
75.Enjokōsai
76.Prostitution
77.Katharsis
78.Psychoanalyse
79.Triebtheorie
80.Perversion
81.Triebverzicht
82.Masturbation
83.Paraphilie
84.Bigotterie
85.Freie Liebe
86.Alfred Charles Kinsey
87.Kinsey-Report
88.Kinsey-Skala
89.Klein Sexual Orientation Grid
90.Masters und Johnson
91.Sexualtherapie
92.Sexuelle Selbstbestimmung
93.Sexuelle Revolution
94.Arbeiter-Sexualität
95.BDSM
96.Bondage
97.Hermaphroditismus
98.Monogamie
99.Exhibitionismus
100.Polyamory
101.Polygamie
102.Personenstandsgesetz (Deutschland)
103.Sexualkundeunterricht
104.Sexualpädagogik
105.Sexualwissenschaft
106.Institut für Sexualwissenschaft
107.Sexuell übertragbare Erkrankung
108.Aufklärungsfilm
109.Sexuelle Aufklärung
110.Analsex
111.Anilingus
112.Pegging
113.Tabu
114.Pubertät
115.Sadomasochismus
116.Masochismus
117.Devianz
118.Sadismus
119.Sexualmedizin
120.Psychopathia sexualis (Krafft-Ebing)
121.Donatien Alphonse François de Sade
122.Leopold von Sacher-Masoch
123.Flagellantismus
124.Isidor Sadger
125.Pornografie
126.Shibari
127.Algolagnie
128.Bundesvereinigung Sadomasochismus
129.ReviseF65
130.Transvestitischer Fetischismus
131.Anomalie
132.Sexualstrafrecht
133.Amelotatismus
134.Androphilie
135.Neoterophilie
136.Chronophilie
137.Cuckold
138.Damenwäscheträger
139.Elektrakomplex
140.Fat Admiring
141.Futanari
142.Gerontophilie
143.Gynäkophilie
144.Hebephilie
145.Hybristophilie
146.Koprophilie
147.Makrophilie
148.Nekrophilie
149.Pädophilie
150.Parthenophilie
151.Saliromanie
152.Urophilie
153.Vorarephilie
154.Formicophilie
155.Tierpornografie
156.Voyeurismus
157.Zoophilie
158.Pornografisches Magazin
159.Vaginalverkehr
160.Oralverkehr
161.Dogging
162.Gruppensex
163.Urethralverkehr
164.Obszönität
165.Prüderie
166.Heteronormativität.Orgasmus
167.Ejakulation
168.Weibliche Ejakulation
169.Spanking
170.Jouissance
171.Konkupiszenz
172.Anaphrodisie
173.Frigidität
174.Sexualangst
175.Daoistische Sexualpraktiken
176.Kuschelparty
177.Injakulation
178.Metta
179.Erotik
180.Androgynie
181.Bigender
182.Drittes Geschlecht
183.Männlichkeit
184.Weiblichkeit
185.Öffentliche Prostitution
186.Prostitution Minderjähriger
187.Frauenhandel
188.Sextourismus
189.Zölibat
190.Postorgasmic Illness Syndrom
191.Autoerotischer Unfall
192.Penisverletzungen
193.Zinā.
194.Sexbeziehung
195.Magdalenenheim
196.Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
197.Zwangsheirat
198.Vergewaltigung
199.Offene Beziehung 199.Sex-positiver Feminismus
200.Neosexuelle Revolution
201.Zeitehe
202.Inzest
203.Pubertas praecox
204.Reproduktionsmedizin
205.Pornografie im Internet
206.Alt Porn
207.Gewalt und Pornografie
208.Kinderpornografie
209.Internetsexsucht
210.Jugendpornografie
211.Sex sells
212.Porno Chic
213.Anasyrma
214.Mooning
215.Johannistrieb
216.Sugar-Daddy
217.Dirty Sánchez
218.Koprophagie
219.Sexueller Fetischismus
220.Urophilie
221.Pädophilenbewegung
222.Sexueller Missbrauch von Kindern
223.Pädokriminalität
224.Kindfrau
225.Lolitakomplex
226.Erotische Kunst
227.Abstinenz
228.Empfängnisverhütung
229.Coitus interruptus
230.Sexualhygiene
231.Monatshygiene
232.Kulturgeschichte der Menstruation
233.Flatus vaginalis
234.Cumshot
235.Bukkake
236.Snowballing
237.K.-o.-Tropfen
238.Chem-Sex
239.Barebacking
240.Straight Acting
242.Straight-Queer Masculinities
243.Tunte
244.Tuntenhaus (Berlin)
245.Homophobie im Fußball
246.Antischwule Gewalt
247.Transgender
248.Queer-Theorie
249.Fisting
250.Gleitmittel
251.Lederszene
252.Analdehnung
253.Analfissur
254.Stuhlinkontinenz
255.Männer, die Sex mit Männern haben
256.Transsexualität bei Kindern und Jugendlichen
257.Transvestitismus
258.Homosexualität und Religion
259.Gender
260.Homosexualität in China
261.Coming-out
262.Homophobie
263.Gymnophobie
264.Lesben- und Schwulenbewegung
265.Bi-Bewegung
266.Geschlechtsangleichung
267.Cross-Dressing
268.Dragqueen
269.Dragking
270.LGBT
271.Queer
272.Transgenialer CSD
273.Homogamie
274.Gender Studies
275.Gleichgeschlechtliche Ehe
276.§175
277.AIDS
Sexualität
Sexualität [zɛks-] (sinngemäß „Geschlechtlichkeit", von spätlat. sexualis;
aus lat. sexus „Geschlecht"; vgl. Sex) bezeichnet im engeren biologischen
Sinne die Gegebenheit von (mindestens) zwei verschiedenen
Fortpflanzungstypen (Geschlechtern) von Lebewesen derselben Art, die nur
jeweils zusammen mit einem Angehörigen des (bzw. eines) anderen Typus
(Geschlechts) zu einer zygotischen Fortpflanzung fähig sind. Hier dient die
Sexualität einer Neukombination von Erbinformationen, die aber bei manchen
Lebensformen auch durch der Sexualität ähnliche, nicht polare,
Rekombinationsvorgänge ermöglicht wird.
Im sozio- und verhaltensbiologischen Sinne bezeichnet der Begriff die
Formen dezidiert geschlechtlichen Verhaltens zwischen Geschlechtspartnern.
Bei vielen Wirbeltieren hat das Sexualverhalten zusätzliche Funktionen im
Sozialgefüge der Population hinzugewonnen, die nichts mehr mit dem
Genomaustausch zu tun haben müssen, so dass dann die handelnden Partner
auch nicht unbedingt unterschiedlichen Geschlechts sein müssen.
Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen,
Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf
ihr Geschlecht. Zwischenmenschliche Sexualität wird in allen Kulturen auch
als ein möglicher Ausdruck der Liebe zwischen zwei Personen verstanden.
Evolution der Sexualität
Die Herausbildung der Sexualität ist einer der Hauptfaktoren und
gleichzeitig ein Ergebnis der biologischen Evolution. Die Entstehung von
genetisch unterschiedlichen Geschlechtern und Paarungstypen gilt als
Ausgangspunkt für die Entwicklung höherer Lebewesen aus ursprünglich
geschlechtslosen Einzellern, die sich nur asexuell (vegetativ)
fortpflanzen. Auf der Ebene der Einzeller, besonders bei den Ciliaten, gibt
es auch Arten mit mehr als zwei unterschiedlichen Paarungstypen und
abgestufter Fähigkeit zur Bildung von Zygoten.
Genetische Grundlagen
Die Sexualität hat sich vermutlich erst vor ca. 600 Millionen Jahren im
Neoproterozoikum etabliert. Vermochten sich die Lebewesen anfangs nur durch
einfache Zellteilung unter Vermehrung fortzupflanzen, was fast
ausschließlich zu genetisch identischen Nachkommen führte, ist am Ende
dieses Evolutionsschrittes die Fortpflanzung mit einer Vereinigung und
Neuaufteilung der Genome zweier Individuen verbunden, was zu genetisch
verschiedenen Nachkommen führt. Dadurch wird die Variabilität der
Individuen einer Population und damit deren Fähigkeit zur Anpassung erhöht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Genome vereinigt werden,
wird dadurch erhöht, dass es mindestens zwei verschiedene Paarungstypen
gibt und nur die Genome zweier verschiedener Paarungstypen vereinigt werden
können. Die Vereinigung von identischen Genomen wird so verhindert. Bei den
meisten Lebewesen kommen nur jeweils zwei Paarungstypen vor, die im Fall
der Oogamie als Geschlechter mit männlich und weiblich bezeichnet werden.
Bei vielen Einzellern besteht der sexuelle Akt aus der Verschmelzung ganzer
Individuen, einige Einzeller, wie das Pantoffeltierchen, sind fähig zur
Konjugation, bei der das Genom oder Teile davon ausgetauscht werden. Auch
manche Bakterien können durch Konjugation extrachromosomale DNA oder unter
bestimmten Bedingungen Teile des Genoms (DNA) von einem Individuum auf ein
anderes übertragen; dies geschieht unabhängig von der Vermehrung, die
meistens durch Zellteilung erfolgt. Bei höher entwickelten Eukaryoten (d.
h. Tieren, Pflanzen, Pilzen und Protisten) bedeutete die Trennung in
verschiedene Geschlechter den Übergang zur geschlechtlichen Fortpflanzung
durch den Austausch und die Rekombination des Genoms bei der Befruchtung
und die Bildung einer befruchteten Keimzelle. Dieser fand bei den Pflanzen
im Verlauf der Stammesgeschichte durch eine Verlagerung der Phasen im
Generationswechsel statt.
Die Entwicklung eines durch Hormone gesteuerten Systems war ein weiterer
Schritt zur Herausbildung sexueller Verhaltensweisen. Neben der
Fortpflanzung mittels Austausch von Erbinformationen hat geschlechtlicher
Verkehr bei höheren Organismen teils auch eine soziale Bedeutung,
insbesondere bei den Primaten (wie dem Menschen und den Bonobos).
Zoologische Grundlagen
In der Zoologie erschließt sich der Erfolg für das Prinzip „Reproduktion
durch Sexualität" erst durch das Verständnis eines zwangsläufig
begleitenden Evolutionsschrittes. Zunächst mussten Sinnessysteme
(Sinnesorgane mit nachgeordneten verhaltensrelevanten Instanzen) entwickelt
werden, die eine Suche und Findung möglicher Geschlechtspartner der eigenen
Art erst ermöglichten. Anfangs sicher noch auf biochemischen Sinnesreizen
basierend, entwickelte sich in der Folge eine Vielzahl von Sinnessystemen
im Tierreich. Diese Sinnessysteme bieten auch dem wichtigsten Aspekt des
Lebens, nämlich dem Selbsterhalt, einen Selektionsvorteil.
Für männliche Individuen vieler, jedoch bei weitem nicht aller Spezies
gilt, dass sie mit dem Geschlechtsakt ihren biologischen Anteil zur
erfolgreichen Reproduktion bereits beigetragen haben. Die ethologischen
Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen aber auch, dass für viele Tierarten
und den Menschen die gemeinsame Sexualität die Basis für vielfältigste
weitergehende Sozialstrukturen darstellt, die im Extremfall lebenslange
exklusive Sexualpartnerschaft zwischen einem Weibchen und einem Männchen
bedeuten kann.
Allen Sexualverhaltensmustern, die oft nach einem starren Schema ablaufen,
ist gemeinsam, dass sie auf etwas oder jemanden in der Außenwelt des
Individuums gerichtet sind (siehe auch Torbogenschema); in der Regel ist
dies bezüglich eines optimalen Reproduktionserfolgs ein
gegengeschlechtlicher Artgenosse. Gleichgeschlechtliche Artgenossen können
sich auf natürliche Weise nicht fortpflanzen.
Menschliche Sexualität
Beim Menschen wie auch bei anderen Primaten, ist die Sexualität im
Gegensatz zu vielen anderen Tieren kein reines Instinktverhalten, sondern
unterliegt bewussten Entscheidungsprozessen und ist in die jeweiligen
sozialen Organisationsformen eingebettet. Menschen drücken ihre sexuelle
Anziehung zum Anderen durch unterschiedliche Formen und Aspekte aus:
Zärtlichkeiten, Worte, verschiedene sexuelle Praktiken, durch
besitzergreifendes Verhalten. Die Sexualität des Menschen beeinflusst seine
Psyche, seine persönliche Entwicklung, die Formen seines Zusammenlebens
sowie – auch beeinflusst von der Sexualmoral – die gesamte Sozialstruktur,
also die Kultur und Gesellschaft, in der er lebt. Da zwischen der
Sexualität des Mannes und der Sexualität der Frau teils erhebliche
Unterschiede bestehen, führt diese Diskrepanz bei der Heterosexualität zu
mannigfaltigen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Geschlechtern.
Folgen mangelnder Anpassung auf beiden Seiten können sich auch in sexuellen
Funktionsstörungen bei Frau und Mann niederschlagen.
Außer der am weitesten verbreiteten Ausrichtung des Sexualverhaltens, der
Heterosexualität, weist das Sexualverhalten des Menschen weitere sexuelle
Orientierungen auf. Dazu gehören zum Beispiel die Homosexualität, d. h. die
Ausrichtung des Sexualtriebs auf das eigene Geschlecht, die Bisexualität,
die sich auf beide Geschlechter richtet, die Asexualität, wo kein Verlangen
nach Sex – weder mit dem männlichen noch weiblichen Geschlecht – besteht.
Es gibt auch verschiedene Sexuelle Präferenzen wie die fetischistische
Sexualität, die sich auf unbelebte Gegenstände oder bestimmte Handlungen
richtet. Früher teilweise tabuisiert und gar unter Strafe gestellt,
gewinnen etliche dieser Ausrichtungen heute in aufgeklärten Gesellschaften
an Akzeptanz und sind in vielen Ländern heute erlaubt.
Literatur
- Sexualität in der Tierwelt. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg/Neckar
2003, ISBN 3-936278-28-8
- Elia Bragagna, Rainer Prohaska: Weiblich, sinnlich, lustvoll. Die
Sexualität der Frau. Ueberreuter, Wien 2010, ISBN 978-3-8000-7475-4.
Weblinks
Commons: Sexualität – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sexualität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,
Übersetzungen
Wikiquote: Sexualität – Zitate
- Alan Soble: Philosophy of Sexuality. In: Internet Encyclopedia of
Philosophy.
- Zur Geschichte der Sexualität in Ostmitteleuropa bei Litdok
Ostmitteleuropa / Herder-Institut (Marburg)
- The International Encyclopedia of Sexuality, Bd. I - IV 1997–2001, Hrsg.
von Robert T. Francoeur
- Die Sexualität des Menschen Handbuch und Atlas Erwin J. Haeberle
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4054684-6
Sexualität des Menschen
Die Sexualität des Menschen ist im weitesten Sinne die Gesamtheit der
Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Emotionen und Interaktionen von
Menschen in Bezug auf ihr Geschlecht.
Die Humanbiologie betrachtet menschliche Sexualität hinsichtlich ihrer
Funktion bei der Neukombination von Erbinformationen im Rahmen der
geschlechtlichen Fortpflanzung. Im Zentrum stehen dabei menschliche
Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau. Im sozio- und
verhaltensbiologischen Sinn umfasst die Sexualität des Menschen die Formen
dezidiert geschlechtlichen Verhaltens zwischen Sexualpartnern. Das
Sexualverhalten des Menschen hat – wie das vieler Wirbeltiere – über
Fortpflanzung und Genomaustausch hinaus zahlreiche Funktionen im
Sozialgefüge einer Population.
Daher befassen sich die meisten Humanwissenschaften auch mit dem Thema der
menschlichen Sexualität. Besonders psychologische, soziale und kulturelle
Faktoren werden dabei als bedeutend für die Sexualität des Menschen
betrachtet. Sexualität wird zu den menschlichen Grundbedürfnissen gezählt,
und zwar sowohl in physiologischer als auch in sozialer Hinsicht, in Liebe,
Lust, Nähe und Zärtlichkeit, die mit Sexualität verknüpft sind.
Biologische Grundlagen
Die Entwicklung eines durch Hormone gesteuerten Systems war ein wichtiger
Schritt zur Herausbildung sexueller Verhaltensweisen. Neben der
Fortpflanzung mittels Austausch von Erbinformationen hat geschlechtlicher
Verkehr bei höheren Organismen teils auch eine soziale Bedeutung,
insbesondere bei den Primaten (wie dem Menschen und den Bonobos).
Sexualität und Gesellschaft
Die Sexualität des Menschen und die Sexualmoral beeinflussen seine Psyche,
seine persönliche Entwicklung, die Formen seines Zusammenlebens und die
gesamte Sozialstruktur, also die Kultur und Gesellschaft, in der er lebt.
Das Sexualverhalten des Menschen weist eine Vielzahl sexueller
Orientierungen auf. Dazu gehören neben der Heterosexualität – bei der der
Sexualtrieb auf das andere Geschlecht gerichtet ist, die Homosexualität und
die Bisexualität, bei der sich das Interesse überwiegend oder auch auf das
gleiche Geschlecht richtet. Bei der Asexualität besteht kein Verlangen nach
Sex mit dem männlichen noch weiblichen Geschlecht. Die Pansexualität als
Begehren unabhängig vom Geschlecht (z. B. sexuelles Interesse an
Transsexuellen oder Transgendern) ist im queeren Verständnis einzuordnen
(siehe Queer-Theorie).
Da sexuelle Präferenzen und insbesondere deren gesellschaftliche Akzeptanz
gesellschaftlichen Veränderungen unterliegen, verschieben sich die Grenzen
zwischen gesellschaftlich legitimen, legalen oder als schädlich
eingeschätzten sexuellen Verhaltensweisen historisch wie interkulturell.
Die Sexualität des Menschen bzw. seine sexuellen Präferenzen manifestieren
sich in der Pubertät. Welche Anteile dieser Präferenzen erlernt oder in der
Erbanlagen bereits festgelegt sind, ist Bestandteil des wissenschaftlichen
Diskurses.
Geschichte
Vor- und Frühgeschichte
Viele archäologische Funde – wie die Venus von Willendorf – zeugen davon,
dass die Beschäftigung mit der Sexualität schon früh Teil der menschlichen
Kultur war. Ihr Stellenwert lässt sich an der übergroßen Darstellung und
Einfärbung von Geschlechtsteilen der historischen Artefakte erkennen.
Vulva- und phallusartige Steinsetzungen können als Zeichen der Verehrung
von Geschlechtsorganen interpretiert werden.
Eine These ist, dass sich durch die Neolithische Revolution das Verhältnis
des Menschen zur Sexualität geändert haben könnte. Diesem Konzept nach
betrachtete der Mann die Sexualität der Frau als zunehmend gefährlich und
einer Kontrolle bedürftig. Es wird in diesem Zusammenhang darüber
spekuliert, dass die Versorgung und Pflege von Kindern nur dann lohnend
sei, wenn es sich um den eigenen, genetisch verwandten Nachwuchs handelt.
In diesem Zusammenhang soll der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass die
Frau eine verdeckte Befruchtung hat: da der Mann nicht im Nachhinein
kontrollieren kann, ob er der Erzeuger der Kinder war, fing er an, die
weibliche Sexualität mit Tabus und Verboten zu belegen. Nicht erklärt
werden kann in dieser naturalistisch-biologistischen Sichtweise, warum auch
alle anderen Formen der Sexualität mit Tabus und Verboten verbunden werden.
Altertum
In Altertum und Antike ist das Verhältnis zur Sexualität je nach Kultur und
Epoche äußerst unterschiedlich. Von einigen Hochkulturen (z. B.
Griechenland) ist bekannt, dass Prostitution und offene Homosexualität in
ihnen gesellschaftsfähig waren.
Mittelalter
Die Moral der christlichen Kirche ist seit dem Mittelalter stark
sexualfeindlich geprägt; Sexualität sollte ausschließlich der Zeugung von
Kindern dienen. Wollust wurde den Hauptlastern zugerechnet, Homosexualität
als abartig krankhaft und widernatürlich; vielmehr wurde die rigide
Einhaltung der Keuschheit propagiert und die Sexualität in den Nimbus des
Diabolischen gestellt.
Frühe Neuzeit
Während im spätmittelalterlichen Europa und in bestimmten Phasen der frühen
Neuzeit – von den mittelalterlichen Badehäusern bis zu den absolutistischen
Höfen – recht ungezwungene Sitten herrschten, breiteten sich erst mit dem
Puritanismus und den Moralvorstellungen des viktorianischen England oder
wilhelminischen Deutschland repressive Moralvorstellungen aus, mit denen
man der Sexualität insgesamt misstrauisch gegenüberstand. Sie wurde z. B.
als animalisch, roh und gefährlich angesehen, da sie die Grenzen der
Vernunft zu sprengen drohte. Insbesondere in diesen Zeiten wurde der Frau
keine selbstbestimmte Ausübung ihrer Sexualität zugestanden.
Moderne
19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert setzte eine massive Sexualerziehung ein, die vor allem
an junge Männer adressiert war. In Handbüchern wie The Young Man's Guide
(William Andrus Alcott, 1833) und Lecture to Young Men on Chastity
(Sylvester Graham, 1834) wurden diese eindringlich vor den vermeintlichen
gesundheitsschädlichen Folgen der Masturbation, aber auch vor homosexuellen
Handlungen gewarnt.
Sigmund Freud
Von wichtiger wissenschaftsgeschichtlicher Bedeutung ist das Konzept der
Triebtheorie, das der Wiener Arzt und Begründer der Psychoanalyse, Sigmund
Freud, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte. Dieses Konzept sah die
Psyche und die Entwicklung des Menschen zu einem erheblichen Teil von dem
Sexualtrieb bestimmt. Freud beschrieb den Sexualtrieb zwar als biologisch
begründet, erforschte ihn aber hauptsächlich in seiner psychologischen
Ausprägung.
Die psychologische Erscheinungsform des Sexualtriebes bezeichnete er als
Libido. Dieses Konzept spielte in der „klassischen" Psychoanalyse eine
wesentliche Rolle, da man dort annimmt, dass die psychische Entwicklung des
Kindes erheblich durch seine Sexualität beeinflusst wird. Erhebliche
Störungen in der psychosexuellen Entwicklung können zu Neurosen und
Psychosen führen. Ganz im Gegensatz zu den kirchlichen Kritikern, die in
der Entstehungszeit der Psychoanalyse, Freud vorwarfen, er würde
Pansexualismus und Unzucht fördern und zur Verrohung der Sitten beitragen,
sah Freud die reine Anerkennung der individuellen Sexualität als Merkmal
für psychische Gesundheit. Hierbei muss die Sexualität nicht ausgelebt
werden. Auch wurde Freuds frühes, und später verworfenes, Konzept der
Katharsis als Aufruf zur sexuellen Aktivität missverstanden. Freud legte
durch seine enge Verknüpfung der Sexualität und der psychischen Entwicklung
auch den Grundstein zur psychologischen Untersuchung der Perversionen, die
heute als Paraphilien bezeichnet werden. Paraphilien bezeichnen sexuelles
Verhalten, welches von der Norm abweicht.
Mit Freuds Psychoanalyse entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue
Vorstellungen der Rolle von Sexualität: Sie sei ein natürlicher Trieb, ihre
Auslebung befreiend, notwendig und positiv, ihre Unterdrückung hingegen
erzeuge Neurosen.
20. Jahrhundert
Nicht nur hinsichtlich Freud gilt das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert
der sexuellen Revolution(en).¹ So machte etwa zu Beginn des Jahrhunderts
Magnus Hirschfeld in Deutschland durch seine Forderungen nach Straffreiheit
für Homosexuelle auf sich aufmerksam. Er gründete in Berlin das weltweit
erste Institut für Sexualwissenschaft.
1917 hatte Richard Oswald den Aufklärungsfilm über Geschlechtskrankheiten
„Es werde Licht!" im Auftrag des deutschen Kriegsministeriums gedreht. Der
Film brachte eine Filmlawine ins Rollen. Allein dieser Film hatte drei
Folgen. 1919 brachte Oswald das Problem Homosexualität und Erpressung in
einer kriminalistischen Handlung unter: „Anders als die Andern". Weil vom
Ende des Ersten Weltkrieges bis 1920 keine Filmzensur in Deutschland
existierte, folgte 1919 auf die Welle der „Aufklärungsfilme" die der
eigentlichen „spekulativen Sexfilme", damals noch „Sittenfilme" genannt. In
den 1960er Jahren wiederholte sich diese kommerziell-gesellschaftliche
Entwicklung auf eine ähnliche Weise.
Seit den 1930er Jahren ermöglichten Antibiotika erstmals eine effektive
Behandlung übertragbarer Geschlechtskrankheiten, sodass das Argument,
sexuelle Freizügigkeit werde mit unheilbarer Krankheit „bestraft", von nun
an immer mehr an Bedeutung verlor.
Nach Untersuchungen der US-amerikanischen Historikerin Dagmar Herzog war
die Haltung zur Sexualität während des Nationalsozialismus nicht etwa
durchgehend repressiv, sondern „doppelbödig" und teilweise liberal² – bei
gleichzeitig starker Repression gegen Minderheiten:
„Kondome waren zugänglich, Vorschläge für bessere Orgasmen präsent,
Freude an der Sexualität war erwünscht, die ganze Diskussion war eher
sexpositiv eingestellt – für Nichthomosexuelle, Nichtbehinderte,
Nichtjuden."³
In den 1950er Jahren folgte ein Wandel zu einer deutlich konservativeren
Einstellung. Bis in die 1960er Jahre hinein blieb eine oftmals als bigott
angesehene Moral vorherrschend. So galten z. B. Zimmerwirte als Kuppler,
wenn sie unverheirateten Paaren gemeinsame Schlafräume vermittelten.
Sexualität war ein Tabu-Thema, über das in der Öffentlichkeit nicht
gesprochen wurde. Erst die Welle der sexuellen Befreiung der 68er führte –
zusammen mit der Aufklärungsliteratur (wie der von Shere Hite) und den
Aufklärungsfilmen – zu neuem Nachdenken über die sexuelle Lust.
Mit der zunehmenden Enttabuisierung der Sexualität rückte dieses Thema
zunehmend in den Blickpunkt der Wissenschaft. Alfred Charles Kinsey
erforschte ab den 1940er Jahren das menschliche Sexualverhalten und stellte
seine Erkenntnisse in den sogenannten Kinsey-Reports dar, die aufgrund
ihrer Ergebnisse heftige Kontroversen auslösten. Die Erforschung der
Sexualität und auch der sexuellen Störungen, die heute als
behandlungsbedürftig angesehen werden, geht vor allem auf die Pioniere
Masters und Johnson zurück, welche sich als Forscherduo der Sexualität
widmeten. Helen Singer Kaplan entwickelte in den 1970er Jahren die
Sexualtherapie.
21. Jahrhundert
In der Gegenwart wird die sexuelle Selbstbestimmung mehr und mehr zum
Leitgedanken der von der sexuellen Revolution veränderten Sexualmoral.
Abweichende sexuelle Praktiken, Beziehungsformen und sexuelle
Orientierungen sind zunehmend sozial akzeptiert oder wenigstens geduldet,
solange Einverständnis zwischen den (erwachsenen) Beteiligten besteht, die
Vorgaben des Strafrechts eingehalten und keine Dritten potentiell
geschädigt oder belästigt werden.
Literatur
Allgemeines
- Jan Rutgers: Das Sexualleben in seiner biologischen Bedeutung als ein
Hauptfaktor zur Lebensenergie.... Verlag Richard<sic!> A. Giesecke,
Dresden (A24) 1922.
- Vern L. Bullough, Bonnie Bullough (Hrsg.): Human Sexuality: An
Encyclopedia. Garland Publishing, New York/London 1994, ISBN
0-8240-7972-8 (Garland Reference Library of Social Science, Vol. 685;
online, hrsg. von Erwin J. Haeberle, 2006).
- Stephan Dressler, Christoph Zink: Pschyrembel Wörterbuch Sexualität. De
Gruyter, Berlin/New York 2003, ISBN 3-11-016965-7.
- Robert T. Francoeur (Hrsg.): The International Encyclopedia of Sexuality.
Bd. I–IV, The Continuum Publishing Company, New York 1997–2001 (online).
- Erwin J. Haeberle: Die Sexualität des Menschen. Handbuch und Atlas. 2003
(online; auch erschienen als: dtv-Atlas Sexualität. dtv, München 2005,
ISBN 3-423-03235-9).
- Max Marcuse (Hrsg.): Handwörterbuch der Sexualwissenschaft. Enzyklopädie
der natur- und kulturwissenschaftlichen Sexualkunde des Menschen.
Neuausgabe [Nachdruck der 2. Auflage, 1926], de Gruyter, Berlin/New York
2001, ISBN 3-11-017038-8.
- Volkmar Sigusch: Sexualität. In: Eike Bohlken, Christian Thies (Hrsg.):
Handbuch Anthropologie. J. B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2009, ISBN
978-3-476-02228-8, S. 411–414.
Einzelstudien
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Sexualität und
Kontrazeption aus der Sicht der Jugendlichen und ihrer Eltern. Eine
repräsentative Studie im Auftrag der BZgA. 3. Auflage, BZgA, Köln 2002,
ISBN 3-9805282-1-9.
- Wilfried von Bredow, Thomas Noetzel: Befreite Sexualität? Streifzüge
durch die Sittengeschichte seit der Aufklärung. Junius Verlag, 1990, ISBN
3-88506-175-9.
- Dagmar Herzog: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen
Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Siedler, München 2005, ISBN
3-88680-831-9.
- Dagmar Herzog: Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History.
Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-0-521-69143-7
(„Synthese des Forschungsstandes auf höchstem Niveau"⁴ ).
- Andreas Krass (Hrsg.): Queer denken. Gegen die Ordnung der Sexualität
(Queer Studies). Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-12248-7.
- William H. Masters, Virginia E. Johnson, Robert C. Kolodny: Liebe und
Sexualität. Neuauflage, Ullstein, Berlin u. a. 1993, ISBN 3-548-35356-8.
- Christiane Pönitzsch: Chatten im Netz. Sozialpsychologische Anmerkungen
zum Verhältnis von Internet und Sexualität. Tectum, Marburg 2003, ISBN
3-8288-8540-3.
- Helmut Schelsky: Soziologie der Sexualität. Rowohlt, Hamburg 1955 (21.
Aufl. 1977).
Kulturgeschichte
- Philippe Ariès u. a.: Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der
Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Sexualität im Abendland. Fischer,
Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-596-27357-9
- Georges Bataille: Tränen des Eros, Matthes & Seitz, Berlin 2004, ISBN
3-88221-216-0
- Franz X. Eder: Kultur der Begierde. Eine Geschichte der Sexualität. Beck,
München 2002, ISBN 3-406-47593-0 (Rezension)
- Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Bd. 1,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-28316-2
- Rüdiger Lautmann, Michael Schetsche: Sexualität im Denken der Moderne.
In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9, Sp. 730-742
- Volkmar Sigusch: Neosexualitäten. Über den kulturellen Wandel von Liebe
und Perversion. Campus, Frankfurt am Main/New York 2005, ISBN
3-593-37724-1.
- Claudia Bruns, Tilmann Walter (Hrsg.): Von Lust und Schmerz. Eine
Historische Anthropologie der Sexualität, Böhlau Verlag, Köln 2004, ISBN
978-3-412-07303-9
Weblinks
Commons: Sexualität des Menschen – Sammlung von Bildern
Wiktionary: Sexualität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,
Übersetzungen
Wikiquote: Sexualität – Zitate
- Magnus-Hirschfeld-Archiv für Sexualwissenschaft an der
Humboldt-Universität zu Berlin.
- Peter-Paul Bänziger, Julia Stegmann:Politisierungen und Normalisierung:
Sexualitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum
H-Soz-u-Kult, 5. November 2010. Umfangreicher Überblick über aktuelle
Forschung zum Thema
- Franz X. Eder: SexBiblio. Bibliography of the History of Western
Sexuality. 3. Ausgabe, Wien 2008.
- Karl Pawek: Geschichte der Sexualität, 2000 f.
Einzelnachweise
[1] Dagmar Herzog: Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History.
Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-0-521-69143-7;
Volkmar Sigusch: Neosexualitäten. Über den kulturellen Wandel von Liebe
und Perversion. Campus, Frankfurt am Main/New York 2005, ISBN
3-593-37724-1.
[2] Dagmar Herzog: Politisierung der Lust. Siedler Verlag, München, 2005,
ISBN 978-3-88680-831-1.
[3] „Die Quellen waren mit Sexualität gesättigt" [Interview von Gunter
Schmidt mit der Historikerin Dagmar Herzog]. In: taz, 20. Januar 2007,
abgerufen am 29. März 2012.
[4] Norman Domeier: Rezension zu: Herzog, Dagmar: Sexuality in Europe. A
Twentieth-Century History. Cambridge 2011. In: H-Soz-u-Kult, 29. März
2012, abgerufen am 29. März 2012.
Sexuelle Selektion
Die sexuelle Selektion (lateinisch selectio ‚Auslese') ist eine
innerartliche Selektion, die auf körperliche Merkmale wirkt und durch
Varianz im Fortpflanzungserfolg zwischen Mitgliedern desselben Geschlechts
entsteht.¹ Diese „geschlechtliche Zuchtwahl" erkannte Charles Darwin als
eine der drei Selektionsarten der Evolutionstheorie. Damit wird die
Entstehung sexualdimorpher Merkmale, d. h. der sekundären
Geschlechtsmerkmale im Erscheinungsbild der Geschlechter einer Art,
evolutionär erklärt.
Abgrenzungen
In seinem Werk „Die Entstehung der Arten" von 1859 beschreibt Charles
Darwin die künstliche und natürliche Selektion.
- Die künstliche Selektion (Züchtung) ist eine zielgerichtete Auswahl von
Individuen mit bestimmten, vom Menschen erwünschten Eigenschaften.
Individuen, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, werden strikt von
der Fortpflanzung ausgeschlossen. Dadurch können sich Formen entwickeln,
die im Freiland eine geringere Angepasstheit als ihre Vorfahren aufweisen
(Haustiere, Kulturpflanzen).
- Die natürliche Selektion findet ohne Einwirkung des Menschen statt. Es
haben diejenigen Individuen die größere Fitness, die Bau- oder
Leistungsmerkmale aufweisen, die in ihrer Umwelt im Vergleich zu anderen
Individuen eine höhere Zahl überlebender Nachkommen bewirken. Diesem
Selektionsdruck unterliegen Eigenschaften wie Anpassungsfähigkeit an
Umweltänderungen, Möglichkeiten zur Einnischung und Widerstand gegen den
Feinddruck. In der Evolutionsbiologie und Soziobiologie erklärt der
erweiterte Begriff der Verwandtenselektion altruistische
Verhaltensmuster. Als Erweiterung der natürlichen Selektion wurde die
Gruppenselektion vorgeschlagen, die in jüngerer Zeit als
Multilevel-Selektion diskutiert wird.
Dem Konzept der natürlichen Selektion widersprachen aber beobachtbare
Merkmalsausprägungen, die für ihre Träger in der jeweiligen Umwelt
eigentlich nachteilig sind. In seinem Buch „Die Abstammung des Menschen und
die geschlechtliche Zuchtwahl" von 1871 beschreibt Darwin die sexuelle
Selektion, mit der er diese Merkmalsausprägungen erklären konnte.
- Die sexuelle Selektion ist eine Auslese von Individuen durch Vorteile
beim Fortpflanzungserfolg gegenüber Geschlechtsgenossen derselben Art.
Intrasexuelle Selektion wirkt auf Merkmale, die bei der
gleichgeschlechtlichen Konkurrenz um Zugang zu Paarungspartnern eine
Rolle spielen. Intersexuelle Selektion wirkt auf Merkmale, die von
Mitgliedern eines Geschlechts eingesetzt werden, um eine explizite
Wahlentscheidung zur Paarung bei Mitgliedern des anderen Geschlechts zu
bewirken.
Intrasexuelle Selektion: Konkurrenzkämpfe zwischen Angehörigen desselben
Geschlechts
Intrasexuelle Selektion wirkt auf Merkmale (z. B. Körpergröße, Färbungen,
Lautäußerungen, Eckzähne), die für die gleichgeschlechtrige Konkurrenz beim
Paarungszugang wichtig sind. Solche Merkmale sind bei Beschädigungs-² oder
Kommentkämpfen als Waffe (z. B. Geweih) oder als Schutz vor Verletzungen
(z. B. Löwenmähne) vorteilhaft, oder sie dienen als soziale Signale beim
Imponierverhalten. Für die markante Ausprägung dieser Sexualdimorphismen
ist ein polygames Paarungsverhalten Voraussetzung. Bei monogamen Arten
entwickeln sich deshalb solche Merkmale nur schwach oder gar nicht. Die
intrasexuelle Selektion wirkt stärker auf das Geschlecht, welches den
geringeren Elternaufwand betreibt.³ Bei vielen Arten und den meisten
Wirbeltieren sind dies die Männchen,¹ bei manchen Arten auch die Weibchen.⁴
Wenn der Aufwand der Männchen für die Werbung um Weibchen groß ist,
entsteht für die Männchen ein Anreiz wählerisch zu sein. Zum Beispiel
konkurrieren die Weibchen bei den monogamen Marmosetten und Tamarinaffen um
die Paarbildung mit attraktiven Männchen.⁵
Wenn die intrasexuelle Selektion symmetrisch auf beide Geschlechter wirkt,
führt auch eine starke intrasexuelle Selektion nicht zu einem ausgeprägten
Sexualdimorphismus. Das tritt z. B. bei monogamen Paarbeziehung auf, wenn
bei einem permanenten Männchen- oder Weibchenüberschuss zahlreiche
außerpaarliche Kopulationen die Monogamie unterminieren und die genetische
Qualität der möglichen Paarungspartner stark unterschiedlich ist. Dann
besteht für beide Geschlechter ein selektiver Anreiz, Zeichen für Qualität
bzw. Gesundheit zu entwickeln. In die gleiche Richtung wirken sich
Paarungsspiele, Paarungsnachspiele bzw. Paarbindungs-Rituale unter
Beteiligung beider Geschlechter aus. Dieser Fall war bereits Charles Darwin
bewusst. Starker Dimorphismus ist tendenziell ein Zeichen für ungleiche
Systeme, bei dem die Variabilität im Fortpflanzungserfolg des einen, meist
männlichen Geschlechts höher ist als die des anderen.
Bei Arten, bei denen die Männchen Kämpfe um den Zugang zu Weibchen
austragen, ist in der Regel das Männchen größer als das Weibchen. Bei
Arten, in denen der Wettbewerb über ausgeprägte Paarungsspiele oder
-vorführungen erfolgt, sind die Männchen hingegen tendenziell kleiner. Nach
Renschs Regel, die in einer Studie bei Küstenvögeln bestätigt wurde,⁶ sind
bei Arten mit sexuellem Größendimorphismus bei großen Arten die Männchen
tendenziell größer und bei kleinen Arten tendenziell kleiner als die
Weibchen. Bei Amphibien sind in der Regel die Männchen kleiner als die
Weibchen. Bei den wenigen Arten mit größeren Männchen besteht ein
signifikanter Zusammenhang mit Paarungskämpfen der Männchen untereinander.⁷
Spermienkonkurrenz
Bei vielen Arten kann sich durch Promiskuität der Weibchen zwischen den
Männchen eine Spermienkonkurrenz entwickeln.⁸ Durch den Selektionsdruck
sind bei Männchen Anpassungen entstanden, wie z. B. Produktion besonders
schneller und leistungsfähiger Spermien,⁹ Kontrolle der Weibchen, große
Hoden, die voluminöses und spermienreiches Ejakulat produzieren, spezielle
„Kamikaze"-Spermien mit spiralförmigem Schwanz, die sich um konkurrierende
Spermien wickeln und sie zerstören können,¹⁰ oder Masturbation, um die
Fitness der Spermien für die nächste Kopulation zu erhöhen.¹¹ Die Weibchen
haben durch diese Konkurrenz Techniken und Strategien entwickelt, mit denen
sie nach der Kopulation mit mehreren Männchen wählen können, welches Sperma
zur Befruchtung kommt („kryptische" Partnerwahl),¹² bzw. nach der Theorie
des „zurückgehaltenen Spermas" von Robin Baker und Mark Bellis, welches
Sperma sie befruchten wird.¹³ ¹⁴ Durch die mehrfache Befruchtung haben
Weibchen z. B. die Möglichkeit, gute Gene für ihren Nachwuchs zu bekommen
und wenig lebensfähige oder genetisch inkompatible Spermien zu vermeiden.
Intersexuelle Selektion: Partnerwahl durch Angehörige des anderen
Geschlechts
Andere Formen von Sexualdimorphismus, wie zum Beispiel das Prachtgefieder
von Pfau oder Paradiesvogel, können nicht durch natürliche oder
intrasexuelle Selektion, aber durch die Bevorzugung ihrer Träger bei der
Partnerwahl erklärt werden. Das Geschlecht mit dem höheren Aufwand wählt
den Partner. Bei vielen Arten sind das durch den höheren Elternaufwand die
Weibchen („female choice").¹ Bei einigen Arten wählen die Männchen¹⁵ (z. B.
Odins- und Thorshühnchen). Das wählende Geschlecht kann bei einigen Arten
auch durch andere Einflüsse bestimmt sein, z. B. durch das Nahrungsangebot,
das die Menge und Qualität von Spermatophoren beeinflusst, die Weibchen von
den Männchen erhalten,¹⁶ durch den Aufwand der Partnerwahl selbst⁵ oder
durch das operationelle Geschlechterverhältnis.¹⁷
Beispiele für Auswahlkriterien:
- Rufe oder Gesang: Lautstärke (Laubheuschrecken), Frequenz (amerikanische
Kröte), Dauer (Grauer Laubfrosch¹⁸ ), Komplexität (Tungara-Frosch)
- Reichhaltigkeit des Gesangsrepertoires (nordamerikanische Singammer)
- Balzhäufigkeit (nordamerikanisches Beifußhuhn)
- Körpergröße (Buntbarsche)
- Gesundheit (nordamerikanisches Beifußhuhn¹⁹ )
Darwin hat die Evolution der intersexuellen Selektion angenommen, aber
nicht erklärt. Wenn die Paarung mit Trägern von bestimmten Eigenschaften
beim anderen Geschlecht zu einer größeren Zahl von überlebenden Nachkommen
führt, kann die Präferenz für diese Eigenschaften evolvieren. Manche
Eigenschaften wie das Prachtgefieder scheinen jedoch einen Fitnessnachteil
für das Weibchen zu haben, da ein solches Gefieder in der natürlichen
Selektion ihren männlichen Nachkommen Nachteile verschafft. Ähnliches gilt
auch für andere Merkmale. Zum Beispiel gibt es bei vielen Vogelarten
monogame, gleichzeitig aber auch polygame Männchen. Generell haben Weibchen
polygamer Männchen einen geringeren Fortpflanzungserfolg durch dessen
verminderte Hilfe bei der Jungenaufzucht. Dennoch paaren sich einige
Weibchen mit bereits verpaarten anstatt einem freien Männchen.
Erklärungen solcher Fälle durch die Evolutionstheorie müssen darauf
beruhen, dass die Träger eines selektierten Merkmals auf längere Sicht mehr
Nachkommen haben werden als diejenigen ohne dieses Merkmal. Ansonsten ist
das Merkmal allenfalls evolutionär neutral. Für die entsprechenden
Paarungssysteme sind verschiedene Modellannahmen denkbar, bei denen dies
trotz der Nachteile durch die natürliche Selektion zutrifft.
- Direkt selektierte Mechanismen: Träger des Merkmals haben durch die
Partnerwahl einen Vorteil, der direkt zu höherer Nachkommenzahl führt.
- Indirekt selektierte Mechanismen: Träger des Merkmals haben zunächst
weniger Nachkommen, die aber eine höhere Fitness besitzen, weshalb sie
sich auf längere Sicht in der Population durchsetzen. Dabei wird nicht
das Merkmal selbst, sondern ein damit korreliertes Merkmal selektiert (z.
B. lauterer Paarungsruf, korreliert mit genetischer Qualität).
- Sexueller Konflikt: Das Merkmal bringt nur Angehörigen eines Geschlechts
einen Vorteil. Da die Eltern genetisch verschieden sind, kann z. B. ein
durch den Vater weitergegebenes Merkmal gefördert werden, das den
Männchen einen Paarungsvorteil verschafft, auch wenn das Merkmal für
Weibchen direkt nachteilig sein kann.
In natürlichen Paarungssystemen müssen diese Möglichkeiten nicht exklusiv
verwirklicht sein. Ein bestimmtes Merkmal kann durch Selektion auch auf
mehreren Wegen teilweise bedingt oder gefördert werden, was die Erforschung
anspruchsvoll macht. Dasselbe Merkmal kann sowohl für die intra- wie auch
für die intersexuelle Selektion gleichermaßen bedeutsam sein, wie es z. B.
für den Schopf beim Schopfalk Aethia cristatella nachgewiesen ist.²⁰
Die Unterschiede im Körperbau und Verhalten der Geschlechter, die
Ausgangspunkt der sexuellen Selektion sind, ergeben sich nach klassischer
Sicht bereits aus den Unterschieden der Gameten. Das Geschlecht mit den
größeren Gameten ist (per definitionem) das Weibliche. Die Entstehung
dieses Unterschiedes selbst deutet man in der Regel durch „disruptive
Selektion": Ein Individuum kann sehr viele, dann aber zwangsläufig sehr
kleine, oder wenige, dann aber besser ernährte Gameten mit höherer
Überlebenswahrscheinlichkeit erzeugen. Intermediäre Individuen fallen
zwischen beide Optima. Aus der unterschiedlichen Gametengröße wird meist
geschlossen, dass das männliche Geschlecht aufgrund der viel höheren
potenziellen Fortpflanzungsrate einen größeren Vorteil davon hat, möglichst
wenig in einzelne Nachkommen und stattdessen besser in eine höhere
Nachkommenzahl zu investieren (Bateman-Prinzip). Dadurch können sich
anfangs kleine Unterschiede in der Strategie der Geschlechter verstärken.
Allerdings kann in diploiden Arten die Anzahl der Nachkommen des einen
Geschlechts diejenige des anderen nicht übersteigen (die
„Fisher-Bedingung"). Unterschiede können also darauf beruhen, dass wenige
Männchen eine Vielzahl von Weibchen befruchten und den relativen Anteil
ihrer Gene im Genpool erhöhen. Eine vergleichbare Strategie der Weibchen
ist nicht möglich.²¹
Wenn ein Individuum bestimmte mögliche Partner nicht akzeptiert, also
wählerisch ist, werden bereits Kosten, z. B. Suchkosten bzw. -risiken und
aufgewendete Lebenszeit verursacht. Eine solche Strategie bedingt daher
einen Selektionsmechanismus. Experimentell nachgewiesen worden ist dieser
Zusammenhang z. B. beim Gabelbock²² : Können Weibchen ihren Paarungspartner
frei wählen, haben sie mehr Nachkommen als bei zufälliger Paarung.
Zur Deutung des Geschlechtsdimorphismus und der Paarungssysteme bei
verschiedenen Arten wurden mehrere Theorien entwickelt. Die bekanntesten
sind die Runaway selection, d. h. Selbstläuferprozesse von R. A. Fisher und
das Handicap-Prinzip.²³
Direkte Vorteile
Ein Weibchen kann durch seine Partnerwahl direkte Vorteile für den
Nachwuchs erlangen, wenn das Männchen z. B. ein hochwertiges Territorium
verteidigt und sich an der Jungenaufzucht oder der Abwehr von Prädatoren
beteiligt. Dieser Fall galt lange Zeit als trivial und wurde daher kaum
betrachtet. Eine systematische Übersichtsarbeit²⁴ zeigte für einige
Fitnesskomponenten einen nur geringfügig größeren Effekt direkter Vorteile
durch die weibliche Partnerwahl als durch indirekte (z. B. aufgrund der
genetischen Ausstattung des Nachwuchses). Zum Erkennen solcher Vorteile
deutet das Weibchen die Signale der Männchen und muss dabei Betrüger
vermeiden, die Fitness-Signale imitieren. Wie bei der genetischen
Ausstattung besteht ein hoher Anreiz, fälschungssichere Signalsysteme zu
entwickeln.
Sensorische Präferenz
Nach der „Sensory Bias"-Theorie können sich Sexualmerkmale durch weibliche
Vorlieben auf männliche Merkmalsausprägungen wie Farbe, Größe oder
akustische Signale entwickeln. Danach bevorzugen Weibchen bei der
Partnerwahl Männchen mit solchen Merkmalen. Zum Beispiel führen die
Männchen der Gattung Anolis in einem spezifischen Paarungsritual schnelle
Aufwärtsbewegungen vor dem Weibchen aus. In der Gattung Xiphophorus gibt es
Männchen mit einem langen Fortsatz der Schwanzflosse (Schwertträger) sowie
ohne Fortsatz (Platys). In Wahlversuchen bevorzugen Weibchen ohne Fortsatz
die Männchen mit künstlich angeklebtem Fortsatz gegenüber dem Wildtyp.²⁵
Bei einigen Arten werden auch Individuen mit völlig unnatürlichen, vom
Menschen angebrachten Markierungen als Partner bevorzugt.²⁶ In Studien trat
dieser Effekt u. a. bei Vögeln auf, bei denen zur Untersuchung ganz anderer
Fragestellungen bestimmte Männchen durch den Experimentator farbig beringt
wurden. Weibchen bevorzugten signifikant Männchen mit Ringen bestimmter
Farbe gegenüber anderen.
Runaway selection
Die „Runaway selection" wurde ab 1915 durch den Genetiker und
Evolutionsbiologen R. A. Fisher entwickelt²⁷ und 1930 in seinem Buch
veröffentlicht.²⁸ Nach 1958 wurde die Theorie dann von Biologen²⁹ und
Mathematikern³⁰ aufgegriffen und weiter entwickelt. Ein Selbstläuferprozess
entsteht durch sensorische Präferenzen bei der Partnerwahl, z. B. wenn
Weibchen männliche Träger eines vererblichen Merkmals zur Paarung
bevorzugen. Sind die Gene für diese Präferenz und für das Merkmal
gekoppelt, kommt es zu einer positiven Rückkoppelung, die in evolutionär
kurzer Zeit extreme Merkmalsausprägungen bewirkt. Der Prozess kann dann nur
durch äußere Einflüsse enden, z. B. durch natürliche Selektion. Danach ist
z. B. die Schwanzlänge beim Pfauenhahn so kostspielig geworden, dass sie
einen Überlebensnachteil hat. Wenn sich der Überlebensnachteil und der
Vorteil beim Paarungserfolg die Waage halten, kann sich ein Gleichgewicht
einstellen.²³ Zum Beispiel wurde durch Vergleich der Merkmalsausprägung
innerhalb der Artengruppe mit den Vorhersagen der verschiedenen Hypothesen
über intersexuelle Selektion der Mechanismus als wahrscheinlichster Grund
für die Färbung und die Balzspiele der Männchen bei den Schnurrvögeln
identifiziert.³¹
Sexy-Son-Hypothese
Als Variante der „Runaway selection" wurde die „Sexy-Son"-Hypothese 1979
von P. J. Weatherhead und R. J. Robertson vorgeschlagen.³² Wie die „Runaway
selection" ist diese Hypothese schwierig zu testen.³³ Nach dieser Hypothese
paaren sich Weibchen mancher Arten mit polygynen Männchen, die z. B. durch
besonders ausgeprägte sekundäre Sexualmerkmale viel in die Partnersuche
investieren, obwohl ein solches Männchen weniger bei der Jungenaufzucht
helfen wird. Ihr Vorteil kann in der vererbten Polygynie und damit in einem
möglichen zukünftig hohen Fortpflanzungserfolg ihrer „sexy Söhne" liegen.
Dadurch kann sich das Merkmal in der Population verbreiten. Investitionen
von Männchen zur Aufzucht der Jungen, z. B. Paarungs(nach)spiele,
Paarbindungs-Rituale oder ein Territorium, sind danach kein Garant für eine
Vaterschaft des Nachwuchses. Diese Hypothese erklärt das Verhalten der
Weibchen mancher Singvogelarten wie z. B. dem Star. Die Weibchen paaren
sich mit polygynen Männchen, auch wenn sie dadurch weniger Nachkommen haben
als mit einem monogamen Partner, der bei der Aufzucht hilft. Bei Vögeln
können Weibchen prinzipiell das Geschlecht ihres Nachwuchses beeinflussen³⁴
und gemäß der Hypothese sollten sie den Anteil ihres männlichen Nachwuchses
erhöhen, um mit diesem einzigen Vorteil ihrer dann ebenfalls polygynen
Söhnen ihre Gene verbreiten zu können.³⁵
Handicap-Hypothese
Das von Amotz Zahavi und Avishag Zahavi entwickelte Handicap-Prinzip
erklärt die Entwicklung von Merkmalen durch Partnerwahl, die einen
Überlebensnachteil für den Träger bringen, aber als Signal die Qualität
seiner Gene belegen.³⁶ ³⁷ Das Handicap ist nach der Hypothese ein
fälschungssicheres Signal von einem besonders lebensfähigen Individuum, das
seine vorteilhaften Eigenschaften an den Nachwuchs vererben kann. Deshalb
wird auch von „guten Genen"- oder „Luxus"-Merkmalen gesprochen.³⁸ Durch die
Exponierung oder Behinderung und damit Gefährdung durch Fressfeinde oder
Nahrungskonkurrenten durch das Handicap signalisiert ein Paarungspartner
seine besondere Fitness. Ein Paarungspartner mit solchen Auffälligkeit wird
danach als besonders kräftig und gesund eingeschätzt und damit als relativ
sicherer Garant für gesunden und lebensfähigen Nachwuchs. Die intersexuelle
und intrasexuelle Selektion sind dabei äquivalent zueinander. Ein
kostspieliges Merkmal, das zum Anlocken eines Partners dient, entspricht
einem kostspieligen Merkmal zum Kampf mit Geschlechtsgenossen wie z. B. dem
Hirschgeweih.³⁹ Eine Erweiterung der Handicap-Hypothese auf den Einfluss
der Immunabwehr stammt von Folstad und Karter.⁴⁰ Ihre Hypothese beruht auf
der Beobachtung, dass ein höherer Spiegel des Sexualhormons Testosteron die
Ausprägung männlicher sexualdimorpher Merkmale verstärkt und gleichzeitig
die Immunabwehr des Körpers mindert. Nur besonders gesunde Männchen können
daher ausgeprägte Merkmale zeigen und die damit verbundene Immunschwächung
als Handicap in Kauf nehmen.⁴¹
Evolutionäre Sackgasse
Die Folgen besonders extremer Handicap-Merkmale werden als „evolutionäre
Sackgasse" interpretiert, wenn ihre Vorteile für die reproduktive Fitness
durch drastische Änderungen z. B. der Umwelt, Krankheiten, neue
Konkurrenten oder veränderte Nahrung verloren gehen und damit ihren Trägern
nur noch die Fitnessnachteile bleiben. Durch diese Nachteile reduziert sich
dann die Population, wenn sich bei den betroffenen Arten die mit
Extrembildungen verbundenen Spezialisierungen nicht an neue Gegebenheiten
anpassen können. Als solche Sackgassen, die zum Aussterben geführt haben,
werden z. B. das Geweih der eiszeitlichen Riesenhirsche, die Stoßzähne der
Mammuts oder die Eckzähne der Säbelzahntiger gedeutet. Der Riesenhirsch
lebte in der offenen Tundra, die sich am Ende der Eiszeit anfangs in
Sumpfland und danach in Wald verwandelte. Nach dieser Hypothese konnte der
Riesenhirsch mit seinem Gewicht und Geweih von über 3,6 m Spannweite weder
auf weichem Untergrund noch im Wald leben, weshalb die Art durch die
ökologischen Veränderungen ausstarb. Diese Hypothese ist allerdings
schwierig zu untersuchen⁴² und im Bezug auf andere Erklärungsmodelle, wie
die Overkill-Hypothese, umstritten.
Evolutionary Suicide
Wenn die Individuen einer Art stark auf Kosten der Population profitieren,
können nach der Hypothese des „evolutionären Selbstmords" evolutionäre
Anpassungen zum Aussterben der Art führen.⁴³ ⁴⁴ Einige Studien konnten eine
Korrelation zwischen Merkmalen, Selektionsdruck und einem erhöhten Risiko
auszusterben nachweisen.⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷
Physische Leistungsmerkmale
Äußere Merkmale wie Körpergröße, Waffengröße oder Größe der primären
Geschlechtsorgane können in direktem Zusammenhang zur Fitness der Männchen
stehen. Bei manchen Arten prüfen die Weibchen die genetische Fitness der
Männchen auch über deren physische Leistungsfähigkeit in Balzspielen, z. B.
bei paarweise vollführtem Balztanz, Balzflug oder Balzkampf, oder durch
deren erbrachte Vorleistungen zur Brutpflege. Ein Weibchen kopuliert nur
mit Männchen, deren Fitness sie als ausreichend beurteilen.
Beispiele:
- Bei einigen Webervogelarten, wie z. B. Textorweber, baut das Männchen das
Nest und das Weibchen prüft die Festigkeit. Bei einigen Arten hat sich
dieses Verhalten ritualisiert, es wird nur noch Nistmaterial präsentiert.
- Bei einigen Vogelarten bringt das Männchen dem Weibchen Nahrung als
„Brautgeschenk" mit und demonstriert damit die Qualität seines Reviers
zur Nahrungsbeschaffung.
Eine andere Form eines physiologischen Leistungsmerkmals gibt es beim
Feuerkäfer (Neopyrochroa flagellata). Das Männchen nimmt über die Nahrung
das Gift Cantharidin auf, das Eier und Larven vor Fressfeinden schützt.
Dieses Gift wird zum größten Teil in einer Drüse im Hinterleib gespeichert
und mit den Spermien übertragen, ein kleiner Teil wird in einer Kopfdrüse
gesammelt. Die Weibchen paaren sich nur mit Männchen, wenn sie das Gift an
der Kopfdrüse des Männchens schmecken⁴⁸
Soziale Signale
Bei manchen Arten hat sich evolutionär ein Signalsystem entwickelt, das mit
der genetischen Fitness der Männchen korreliert, das aber keinen direkten
Zusammenhang zu deren Überlebens-, Fortpflanzungs- oder Aufzuchtsfähigkeit
hat. Weibchen wählen Männchen anhand ihrer möglichst ausgeprägten
Schlüsselreize, wie z. B. auffällige Farben, Rufe oder Verhaltensweisen,
die bei der Balz von Männchen präsentiert werden. Die Auffälligkeit der
Signale verringert die allgemeine Fitness der Männchen durch natürliche
Selektion, die der sexuellen Selektion entgegenwirkt. Dadurch entsteht ein
Gleichgewicht bei der Ausprägung der Merkmale und eine Hypertrophierung
sekundärer Geschlechtsmerkmale wird verhindert. Dieser Zusammenhang wurde
z. B. bei Poecilia reticulata nachgewiesen. Bunt gefärbte Männchen sind
attraktiver für Weibchen, aber auch auffälliger für Prädatoren. In
Lebensräumen ohne Prädatoren sind die Männchen bunter.⁴⁹
Beispiele:
- Pfau: Schmuckfedern mit vielen und großen Augen erhöhen den
Fortpflanzungserfolg.⁵⁰
- Bankivahuhn: Hennen bevorzugen Hähne mit hellen, „leuchtenden" Augen und
großen, roten Kämmen und Kehllappen. Diese Merkmale korrelieren mit einem
guten Gesundheitszustand und einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten.⁵¹
- Rauchschwalbe (Hirundo rustica): Rauchschwalben zeigen keinen auffälligen
Sexualdimorphismus. Die Männchen sind nur an den verlängerten Randfedern
des Gabelschwanzes zu erkennen. Sie sind um mehr als einen Zentimeter
länger als die der Weibchen, die Männchen mit längeren Schwanzfedern
bevorzugen.⁵²
Die Schwanzfedern variieren bei den Männchen zwischen 84 und 132
Millimetern. Ältere Männchen haben längere Schwanzfedern als jüngere, da
bei jeder Mauser im Winterquartier diese etwas verlängert ausgebildet
werden. Ältere Männchen kommen im Brutgebiet früher an als jüngere,
verpaaren sich früher und haben damit die Möglichkeit einer zweiten Brut.
Die Länge der Schwanzfedern spielt keine Rolle im Konkurrenzkampf der
Männchen um Nistplätze, aber bei der Wahl durch die Weibchen, wie in
Experimenten festgestellt wurde. Einer Gruppe von Männchen wurden die
Schwanzfedern um zwei Zentimeter verkürzt und einer anderen Gruppe um
diesen Betrag verlängert. Gegenüber einer unbehandelten Kontrollgruppe
haben 85 % der Männchen mit den verlängerten Schwanzfedern ein zweites
Mal gebrütet, aber nur 10 % der Männchen mit kurzen Schwanzfedern. Die
Männchen mit langen Schwanzfedern kopulierten doppelt so oft mit dem
Weibchen eines Männchens mit verkürzten Schwanzfedern wie die der
Kontrollgruppe. Mit langen Schwanzfedern ist die Flugleistung beim
Nahrungserwerb schlechter. Männchen mit langen Schwanzfedern erbeuten
nicht mehr große, schnell fliegende, sondern nur noch kleine, langsam
fliegende, Insekten. Da ihre Brut genauso viel Nahrung wie die der
Männchen mit kürzeren Schwanzfedern braucht, müssen sie mehr erbeuten.
Durch diese Anstrengung entwickeln Männchen bei der nächsten Mauser
wieder kürzere Schwanzfedern. Dadurch ist die Federlänge begrenzt und die
Weibchen wählen die erfahrensten und beim Nahrungserwerb erfolgreichsten
Männchen aus.
- Bei manchen Vogelarten wie z. B. Schnurrvögel, Leierschwanz oder
Laubenvögel, bereiten die Männchen für ihre Balz Tanzplätze vor. Das
Weibchen wählt das Männchen nach der Qualität des Platzes oder der
Darbietung aus. Besonders attraktive Männchen können zahlreiche Weibchen
begatten, während unattraktivere Männchen sich nicht fortpflanzen können.
Männliche Laubenvögel statten ihre Tanzplätze mit Objekten auffälliger
Farbe aus, deren Anzahl das Weibchen anlockt. Starke Männchen zerstören
die Tanzplätze ihrer Konkurrenten und rauben das Schmuckmaterial für
ihren eigenen Platz. Die Kopulation findet auf dem Tanzplatz statt, aber
das von den Weibchen gebaute einfache Brutnest liegt meist weitab vom
Tanzplatz.⁵³
Heterozygotie-Hypothese
Ein möglicherweise wichtiger Faktor bei der Partnerwahl ist die genetische
Kompatibilität eines Partners. Danach bestimmt sich die Qualität eines
Paarungspartners aufgrund der eigenen genetischen Ausstattung und variiert
daher für verschiedene Partner. Nach dem Effekt der Heterozygotie bestimmt
sich die „Qualität" eines bestimmten Gens (eigentlich: Allels) nicht
absolut, sondern nur situationsabhängig im Zusammenhang mit dem Genom des
jeweiligen Partners.⁵⁴ Damit wurde z. B. die im Tierreich weit verbreitete
Paarung von Weibchen mit mehreren Männchen als Risikominimierung erklärt,
um Partner mit genetisch unpassenden Elementen zu vermeiden.⁵⁵ ⁵⁶ Der
heterozygote Nachwuchs genetisch verschiedener Eltern sollte insbesondere
ein besonders leistungsfähiges Immunsystem besitzen.⁵⁷ Auch Forschungen zur
menschlichen Fortpflanzungsbiologie können so gedeutet werden und eine
Hypothese stellt z. B. einen Zusammenhang zwischen der Güte des
Immunsystems und Pheromonen her. Je besser sich die Immunsysteme ergänzen,
also je unterschiedlicher sie sind, umso attraktiver wird der Geruch des
Partners empfunden.⁵⁸ ⁵⁹ Empirische Tests der Hypothese haben in einigen
Fällen einen Vorteil von Paarungen mit genetisch kompatiblen oder
verschiedenen Partnern erwiesen, in einigen Fällen konnte auch eine
Partnerwahl nach entsprechenden Markern nachgewiesen werden.⁶⁰
Erzwungene Paarung
In Erweiterung zur intra- und intersexuellen Selektion weisen Pradhan und
van Schaik auf die Rolle erzwungener Paarung von Weibchen durch Männchen
hin.⁶¹ Wenn die Weibchen den Männchen nicht ausweichen können, kann deren
Wahlmöglichkeiten durch die Männchen beschränkt werden. Die durch
intrasexuelle Selektion entwickelten Merkmale (z. B. Körpergröße, Geweihe,
Hörner) werden danach nicht nur in der gleichgeschlechtlichen Rivalität der
Männchen eingesetzt, sondern als Alternativstrategie auch um Paarungen mit
Weibchen zu erzwingen. Dadurch sollte ein selektiver Anreiz für die
Weibchen bestehen, solche Paarungspartner zu meiden. Diese Hypothese kann
auch erklären, warum bei den meisten Säugetieren die Männchen „Waffen"
besitzen, während bei Vögeln Ornamente überwiegen.
Ein weiterer bedeutsamer Faktor ist die Belästigung von Weibchen durch
unerwünschte männliche Paarungsversuche, auch wenn es nicht zum Vollzug der
Paarung kommt. In einer Studie an der Waldeidechse konnte gezeigt werden,
dass bei einem experimentell erzeugten Überschuss von Männchen in der
Population die Männchen durch ständige Belästigung und Paarungsversuche zu
einer wesentlichen Mortalitätsursache für die Weibchen werden können.
Dadurch fällt nicht nur, wie zu erwarten, der Populationszuwachs bei
Männchenüberschuss ab, sondern die Populationsgröße sinkt sogar ab. Dadurch
besteht ein erhebliches Aussterberisiko für die Population.⁶² ⁶³ Ähnliches
wurde bei einer Reihe weiterer Arten nachgewiesen. Bei Taufliegen können
Paarungsversuche von Männchen, die sich gezielt auf besonders fruchtbare
Weibchen richten, diese stark benachteiligen, wodurch sich ihr Vorteil (in
der natürlichen Selektion) abschwächt.⁶⁴
Geschlechterverhältnis
Bei normaler geschlechtlicher Fortpflanzung ist die Geschlechterverteilung
im Prinzip 1:1. R. A. Fisher zeigte bereits 1930, dass in Abwesenheit
besonderer Faktoren ein Übergewicht eines Geschlechts einen Selektionsdruck
auf das andere Geschlecht bewirkt.⁶⁵ Das Geschlechterverhältnis unterliegt
der sexuellen Selektion und ein ungleiches Geschlechterverhältnis wirkt
dann stark auf die sexuelle Selektion zurück. Nach der Theorie sollte das
Geschlechterverhältnis tendenziell in die Richtung des Geschlechts mit
einer höheren potenziellen, d. h. unter Einbezug der Investitionen des
jeweiligen Elternteils in den Nachwuchs bestimmte Fortpflanzungsrate
verschoben sein. Maßgebend ist dabei das Geschlechterverhältnis der an der
Fortpflanzung beteiligten Individuen im fortpflanzungsfähigen Alter, das z.
B. durch eine höhere Jugendmortalität eines Geschlechts verschoben sein
kann. Das biologisch tatsächlich wirkende Geschlechterverhältnis wird
„operationelles Geschlechterverhältnis" (engl.: operational sex ratio, OSR)
genannt.⁶⁶ Verborgene Faktoren können dabei einen entscheidenden Einfluss
ausüben. Ist z. B. das Weibchen nur wenige Tage im Jahr empfängnisbereit,
wenn das Männchen mehr oder weniger permanent zeugungsbereit ist, ist die
Anzahl der tatsächlich paarungswilligen Weibchen zu einem gegebenen
Zeitpunkt möglicherweise viel geringer als die der Männchen, auch wenn
beide gleich häufig sind. Damit ist das operationelle
Geschlechterverhältnis zugunsten der Männchen verschoben. In gleicher Weise
wirkt es sich aus, wenn Männchen oder Weibchen früher geschlechtsreif
werden als das andere Geschlecht.
Ohne Elternfürsorge für den Nachwuchs kann sich die durch das
Größenverhältnis der Geschlechtszellen (Gameten) bedingte Überlegenheit des
männlichen Geschlechts bei der Fortpflanzungsrate häufig durchsetzen und
das operationelle Geschlechterverhältnis kann zugunsten der Männchen
verschoben sein. Eine exklusive Fürsorge der Weibchen für den Nachwuchs
verstärkt dann diese Tendenz und der Männchenüberschuss führt zu einer
stärkeren Konkurrenz der Männchen untereinander. Bei z. B. den meisten
Vogelarten versorgen jedoch beide Geschlechter den Nachwuchs. Bei vielen
Arten ist das Männchen Alleinversorger für den Nachwuchs und das Weibchen
beteiligt sich über die Lieferung der Eier hinaus nicht wesentlich. Dazu
gehören neben etlichen Insekten- und Fischarten wie etwa die Seenadeln auch
einige Salamander⁶⁷ und Vogelarten wie z. B. Laufvögel. Das
Geschlechterverhältnis kann dann zugunsten der Weibchen verschoben sein,
wodurch sie dann stärker um Paarungspartner konkurrieren und stärker der
sexuellen Selektion unterliegen.
Das operationelle Geschlechterverhältnis kann bei Arten variabel sein, z.
B. wenn die Mortalität eines Geschlechts stärker von Umweltfaktoren abhängt
als die des anderen (z. B. größere Männchen, Nahrungsmangel). Bei solchen
Arten haben Forscher das Verhältnis experimentell verändert und die
Konsequenzen beobachtet. Bei der Fischart maulbrütenden galiläischen
Petersfisch Sarotherodon galilaeus wurde gezeigt, dass die
Fortpflanzungsstrategie vom Geschlechterverhältnis beeinflusst wird.⁶⁸ Bei
dieser Art versorgen manchmal beide Geschlechter, manchmal eines allein den
Nachwuchs. Bei einem Überschuss des einen Geschlechts verlässt das jeweils
andere häufiger seinen Nachwuchs. Dies kann durch die höheren relativen
Kosten erklärt werden, die ein Individuum hat, wenn ihm mehr potenzielle
Paarungspartner zur Verfügung stehen.
Sexuell antagonistische Selektion
Merkmale, die zum reproduktiven Erfolg durch sexuelle Selektion führen,
sind meist ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt. Der
Selektionsdruck auf das jeweilige Geschlecht kann in unterschiedliche
Richtung wirken, s. d. es kein gemeinsames Optimum für beide Geschlechter
gibt. Dieses Phänomen wird „sexuell antagonistische Selektion" genannt,
führt tendenziell zu einer Erhöhung der genetischen Variabilität und ist
dafür möglicherweise einer der wichtigsten Faktoren.⁶⁹ ⁷⁰
Empirische Belege für das Wirken sexuell antagonistischer Selektion wurden
bei einer Reihe von Arten festgestellt, wie z. B. bei Taufliegen⁷¹ oder
beim Rothirsch.⁷² Beim Rothirsch wurde z. B. gezeigt, dass Töchter von
reproduktiv besonders erfolgreichen Vätern einen geringeren
Fortpflanzungserfolg besaßen als es dem Durchschnitt entspricht. Dieser
Befund ist gleichzeitig ein schwerwiegendes Problem für Hypothesen, wie z.
B. die Handicap-Hypothese, die einen größeren Erfolg für den Nachwuchs
beider Geschlechts vorhersagt. Nach dem Modell sollten sich mutierte Allele
mit Vorteil ausschließlich im männlichen Geschlecht auf dem X-Chromosom
anreichern, weil sie hier beim Männchen Wirkung zeigen können, während ihre
Wirkung beim Weibchen im heterozygoten Fall durch das Allel auf dem zweiten
DNA-Strang gemindert sein kann. Diese Vorhersage konnte bei der Taufliege
bestätigt werden.⁷³
Sexuell antagonistische Selektion kann zu einem „Wettrüsten" zwischen den
Geschlechtern führen. Diese „sexuell antagonistische Koevolution" wurde z.
B. bei den Samenkäfern gezeigt.⁷⁴ Bei den Männchen vieler Arten weist der
Aedeagus Dornen auf, die das Weibchen bei der Kopulation verletzen können.
Die Weibchen reagieren mit einer Verstärkung des Genitaltrakts.
Paarungssysteme und ökologische Zwänge
Die Struktur und Ausbildung von Sozial- und Paarungssystemen unterliegt
nicht der sexuellen Selektion allein. Die Wechselwirkungen zwischen
Paarungssystemen und ökologischen Randbedingungen, d. h. durch die
natürliche Selektion vorgegebenen Zwang, ist Gegenstand eines eigenen
Forschungsprogramms. Die Rahmenbedingungen für die Wirkung der sexuellen
Selektion werden demnach von Umweltfaktoren, insbesondere der Verteilung
von Ressourcen in der Umwelt, vorgegeben (engl: ecological constraints
model, ECM).⁷⁵
Die beinahe unüberschaubare Vielfalt von Paarungssystemen im Tierreich (für
Säugetiere, vgl.⁷⁶ ) lässt sich nach der Lebensweise der jeweiligen Arten
ordnen. Ob ein Individuum einen oder mehrere potenzielle Paarungspartner
für sich monopolisieren kann, d. h. andere Artgenossen von der Paarung
ausschließen, hängt in vorhersagbarer Form vom Ernährungstyp und der
Lebensweise ab. Ist für eine erfolgreiche Jungenaufzucht zwingend der
Beitrag beider Geschlechter erforderlich, ergibt sich (obligate) Monogamie.
Legen die Umweltfaktoren für Weibchen eine territoriale Lebensweise (d. h.
räumliche Beschränkung auf ein „Heimatrevier") nahe, können Männchen
Weibchen für sich monopolisieren, indem sie anderen Männchen den Zugang
dazu verwehren. Bei weit verstreut lebenden Weibchen resultiert
(fakultative) Monogamie – im Unterschied zur obligaten kann das Männchen
hier zur Jungenaufzucht beitragen oder nicht beitragen. Bei in Gruppen oder
Herden zusammenlebenden ergibt sich Polygamie. Leben Weibchen in stabilen
Gruppen ohne Territorium zusammen, können einzelne Männchen (oder eine
Koalition aus solchen) anderen Männchen den Zugang zu diesen Gruppen
beschränken. Ist keine dieser Voraussetzung gegeben, ist es für Männchen
meist vorteilhafter, individuell so viele Paarungspartner wie möglich zu
suchen (Promiskuität). Andere Umweltfaktoren, z. B. Prädatoren, können
vergleichbare Auswirkungen haben. Zum Beispiel leben bei Languren (einer
Gruppe asiatischer Affen) zwei Männchen mit einer Weibchengruppe zusammen,
wenn im Lebensraum affen-jagende Adler vorkommen. Fehlen diese, ist nur ein
Männchen vorhanden.⁷⁷
Die Entstehung von Familienverbänden hängt ebenfalls in vorhersagbarer Form
von der Umwelt ab. Die Formung einer Familie aus Eltern und (halbwüchsigen)
Nachkommen ist für den Nachwuchs mit einem Verzicht auf
Fortpflanzungsmöglichkeiten verbunden. Dies kann vorteilhaft sein, wenn die
Risiken und Kosten der Verteilung (Dispersion) und Reviersuche hoch sind,
z. B. weil gute Reviere knapp sind.⁷⁸
Artbildung
Durch z. B. Selbstläuferprozesse können sich Arten als Folge divergierender
sexueller Präferenzen in Tochterarten aufspalten.⁷⁹ Populationen einer Art
entwickeln sich zu getrennten Arten weiter, wenn Isolationsmechanismen den
Genfluss zwischen Organismen dieser Populationen verhindert. Eine
präzygotische Isolation durch sexuelle Selektion erzeugte morphologische
Besonderheiten oder spezielle Paarungssignale können eine Paarung
verhindern, wenn die Signale nicht gedeutet werden können oder die Partner
unattraktiv sind. Artbildung durch präzygotische Mechanismen scheint
schneller abzulaufen als durch postzygotische Mechanismen (z. B. Sterilität
oder Lebensunfähigkeit des Nachwuchses), wenn die entsprechenden
Populationen miteinander in Kontakt stehen.⁸⁰ Da nach theoretischen
Modellen sexuelle Selektion rascher ablaufen kann als natürliche Selektion,
können sich isolierende Mechanismen schnell entwickeln, ohne dass stärkere
ökologisch wirksame Adaptationen vorhanden sein müssen. Als Ausgangspunkt
genügen kleine Unterschiede in der Präferenz der Weibchen zwischen
verschiedenen Populationen, wie z. B. bei den Farbmustern von Guppys.⁸¹
Nach dem Modell der Runaway-Selektion sind solche Unterschiede unabhängig
von einem adaptiven Wert ausreichend um eine sehr rasch ablaufende
Merkmalsverschiebung anzustoßen. Durch adaptive Radiation können sich dann
Arten rasch in Artengruppen aufspalten. Dieses Modell wird als Erklärung
für die Artenvielfalt der extrem rasch evolvierenden Buntbarsch-Arten in
den ostafrikanischen Seen benutzt.⁸² Bei der Artbildung ist Assortative
Paarung ein wichtiger Mechanismus, durch den Männchen und Weibchen mit
ähnlichen Spezialisierungen oder Anpassungen sich bei der Paarung
gegenseitig bevorzugen.⁸³ ⁸⁴
Bei einer Aufspaltung sollten sich Verhaltensmerkmale vorgängig zu
morphologischen Merkmalen ändern. Als Basis einer evolutionären Veränderung
müssen diese Merkmale zumindest teilweise erblich sein. Zur genetischen
Basis solcher Verhaltensmerkmale ist relativ wenig bekannt. Klassische
Züchtungsexperimente zeigen, dass es gewöhnlich quantitative Merkmale sind,
die von vielen Genen beeinflusst werden.⁸⁵ Die Untersuchungen werden an
Modellorganismen, vor allem an Taufliegen mit Quantitative Trait Locus
(QTL) erforscht.⁸⁶ Viele der wirkenden Gene haben neben ihrer Beteiligung
am Verhaltensmerkmal oft auch grundlegende Bedeutung für andere biologische
Prozesse (Pleiotropie).
Sexuelle Selektion beim Menschen
Einige der Soziobiologie nahestehende Forscher wenden die Theorie der
sexuellen Selektion auf die Art Homo sapiens an und nennen den
Forschungsansatz evolutionäre Psychologie. Ihre zahlreichen Gegner aus den
Sozialwissenschaften, speziell des Sozialkonstruktivismus oder der
feministischen Theorie, sprechen von Biologismus oder Essentialismus. Aus
ethischen Gründen können beim Menschen nur eingeschränkt Experimente
durchgeführt werden und die Erforschung der Ursachen menschlichen
Sozialverhaltens wirkt sich auf unser Selbstverständnis oder die
Legitimierung politischer und gesellschaftlicher Systeme aus. Zudem ist
eine Anwendung psychologischer Erkenntnisse, die z. B. an akademisch
gebildeten Erwachsenen in Industrienationen erhoben wurden, auf andere
Kulturkreise problematisch. Für die Evolution des menschlichen
Sozialverhaltens waren vermutlich die Beziehungen in altsteinzeitlichen
Jäger-Sammler-Gemeinschaften maßgeblich, zu denen es keinen direkten Zugang
gibt. Folgende Methoden werden deshalb angewendet:
- Nutzenkalkül-Betrachtungen, z. B. auf Grundlage der Spieltheorie.
- Interkulturelle Vergleiche des Sozialverhaltens beim Menschen, oft auf
Basis des ethnographischen Atlas⁸⁷
- Vergleiche mit dem Sozialverhalten nahe verwandter Arten, besonders
Vergleiche mit den Systemen der Paarung und Jungenaufzucht bei
Menschenaffen.
- Ableitungen aufgrund der Anatomie. Betrachtet wird insbesondere der
Sexualdimorphismus zwischen den menschlichen Geschlechtern.
- Empirische Studien, die mit statistische Methoden analysiert werden.
Zum Beispiel untersuchte David Buss mögliche evolutionäre Gründe für
menschliche Eifersucht,⁸⁸ das weibliche Sexualverhalten⁸⁹ oder auch die
Ursachen für mörderische Absichten.⁹⁰ Geoffrey Miller beleuchtete die
Frage, wie sich das menschliche Gehirn entwickeln konnte⁹¹ und wie Gad
Saad⁹² welche Rolle Konsum beim Homo Sapiens spielt.⁹³
Paarungsstrategien und Paarungssysteme
Als eine Besonderheit beim Menschen beteiligen sich grundsätzlich beide
Geschlechter an der Versorgung und Aufzucht des Nachwuchses.⁹⁴ Bei keiner
anderen Menschenaffen-Art beteiligt sich das Männchen an der Versorgung des
Nachwuchses, weder bei den in Familienverbänden lebenden
Schimpansenarten,⁹⁵ noch bei den Gorilla-Harems,⁹⁶ den monogam lebenden
Gibbons⁹⁷ oder den solitären Orang-Utans. Für alleinversorgende Mütter hat
die empirische Sozialforschung eine erheblich angestiegene
Kindersterblichkeit in Jäger-Sammler-,⁹⁸ und Ackerbau-Kulturen und in
gewissem Umfang auch in modernen Gesellschaften nachgewiesen, aber nicht in
den höchstentwickelten Industrie- und Sozialstaaten.⁹⁹
Nach den theoretischen Vorhersagen der sexuellen Selektionstheorie haben
beide Geschlechter ein gemeinsames evolutionäres Interesse, in das
Wohlergehen des Nachwuchses zu investieren. Für Väter ist eine „gemischte"
Strategie einfacher als für Mütter, welche die Versorgung zumindest bei
ihren Säuglingen weniger leicht vermindern können. Für Männer ist die
Investition in den Nachwuchs einer Frau evolutionär vorteilhaft, wenn sie
sich ihrer Vaterschaft und damit ihres Fortpflanzungserfolgs sicher sein
können. Für Frauen spielen bei der Partnerwahl hingegen Nutzenabwägungen
eine Rolle, wie sie z. B. für monogame Singvogelarten gelten. Sie können
einen vermutlich zuverlässig helfenden „Versorger" und seine Ressourcen
oder einen genetisch attraktiven, aber vielleicht unzuverlässigen Mann an
sich binden, der ihrem Nachwuchs seine „guten Gene" weitergibt und dessen
„sexy" Söhne dann bessere Paarungschancen besitzen. Durch „Sittlichkeit"
gewonnene Reputation für Monogamie kann sich auch für Männer z. B. durch
einen Ruf als „guter Versorger" auszahlen, besonders wenn fremder Nachwuchs
großgezogen wird.¹⁰⁰
Über das soziale Leben der unmittelbaren Vorfahren des Menschen gibt es nur
wenige Daten und es werden stattdessen „ursprünglich" lebende
Gesellschaften untersucht.¹⁰¹ Ein Zusammenhang zwischen Monogamie und einer
gemeinsamen Aufzucht des Nachwuchses ist empirisch nicht belegt.¹⁰²
Monogamie kommt bei weniger als 5 % der Säugetierarten vor.¹⁰³ Beim
Vergleich menschlicher Kulturen finden sich monogame, polygyne und
polyandrische Beziehungen. Menschen leben in Sozialverbänden zusammen,
deren Größe in Jäger-Sammler-Kulturen vor allem durch natürliche Ressourcen
begrenzt ist, so dass die Paarbildung nicht beispielsweise durch
Territorialität gesichert werden kann. Die Größe dieser zusammenlebenden
Gruppen liegt üblicherweise bei etwa 30 Individuen. Zum Beispiel zur
Vermeidung von Inzucht verlässt bei sozialen Tierarten ein Teil des
Nachwuchses das Territorium, während der andere Teil philopatrisch
zurückbleibt. Bei den meisten Tierarten verlassen die jungen Männchen den
Sozialverband, bei den zum Homo sapiens nächstverwandten Menschenaffen