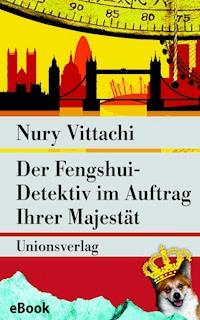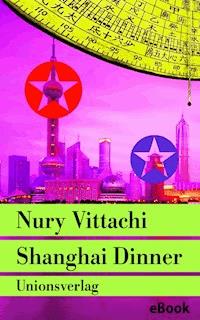
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor einer Woche hat C. F. Wong eine Zweigstelle in Shanghai eröffnet. In der Hauptstadt des Turbokapitalismus will er mit Fengshui-Beratungen leichtes Geld verdienen und die schönen Dinge des Lebens genießen. Mit von der Partie sind seine junge Assistentin Joyce und die chaotische Sekretärin Winnie Lim. Leider hat C. F. Wong aber nicht bedacht, dass die verrückte Riesenmetropole ihr eigenes Karma besitzt … Einer zerstörerischen Abrissbirne können die drei gerade noch entkommen. Doch dann bleiben sie im größten Verkehrsstau stecken, den Shanghai je erlebt hat: Der amerikanische Präsident wird erwartet, vegane Terroristen sind in der Stadt und mitten im Zentrum treibt sich ein weißer Elefant herum. C. F. Wong hat keine Wahl: Er muss die Welt und Shanghai retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
In der Hauptstadt des Turbokapitalismus will C. F. Wong mit Fengshui-Beratungen leichtes Geld verdienen und die schönen Dinge des Lebens genießen. Leider hat er aber nicht bedacht, dass die verrückte Riesenmetropole ihr eigenes Karma besitzt … Der Fengshui-Detektiv hat keine Wahl: Er muss die Welt und Shanghai retten.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nury Vittachi (*1958) gilt - laut BBC – als »Hongkongs witzigster Kommentator«. Er lebt seit 1986 in Hongkong, wo er sich als Kolumnist, Buchautor und Herausgeber einer Literaturzeitschrift Kultstatus verschafft hat. Er arbeitet als Dozent an der Hong Kong Polytechnic University.
Zur Webseite von Nury Vittachi.
Ursula Ballin, geboren 1939 in Hamburg, wuchs in England und Finnland auf. Viele Jahre verbrachte sie in China und Taiwan, zuletzt als Professorin für Geschichte in Taipeh. Sie arbeitet als freie Übersetzerin.
Zur Webseite von Ursula Ballin.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nury Vittachi
Shanghai Dinner
Der Fengshui-Detektiv rettet die Welt
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ursula Ballin
Der Fengshui-Detektiv (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel The Shanghai Union of Industrial Mystics bei Allen & Unwin in Crows Nest, Australien.
Originaltitel: The Shanghai Union of Industrial Mystics (2006)
© by Nury Vittachi 2006
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: John Lawrence/Getty Images
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30603-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.11.2022, 22:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SHANGHAI DINNER
Dank1 – Im alten China, im ersten Jahrhundert, wurde ein …2 – Wer zur Arbeit geht, wenn alle andern nach …3 – Es war im Jahre 61 v. Chr. …4 – Joyce radelte, so rasch sie konnte. Der Wind …5 – Wo ist mein Kind? Geben Sie mir meine …6 – Früh um zwanzig vor acht wurde Angelita Consolación …7 – Im ehemaligen Theater herrschte eine angespannte, fiebrige Atmosphäre …8 – Agent Thomas »Cobb« Dooley begab sich ins Foyer …9 – Der König von Ji wurde vom Säuglingsalter an …10 – Okay, wo ist er?«11 – Dooley rannte treppauf12 – Im Altertum lebte im Westen Chinas ein Fruchtbarkeits-Gottkaiser …13 – Im alten China gab es im Feuervolk am …14 – Im Jahre 56 v. Chr. kam wieder einmal …15 – Dooley saß unbehaglich zuckend auf dem Motorrad …16 – Sosehr es mir widerstrebt, unsern schlechten Karten noch …17 – Wong zog seine feuchte Luopan aus der Jackentasche …18 – Ein Problem, das sich bei den Zusammenkünften der …Anmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Nury Vittachi
Zhuang Lee: Ein asiatischer Autor tritt ins Rampenlicht
Über Ursula Ballin
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nury Vittachi
Zum Thema China
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Asien
Zum Thema Großstadt
Dank
Ich bin vielen Menschen dankbar, die mir beim Schreiben dieses Buches in mancher Hinsicht geholfen haben. Großer Dank gebührt dem Verleger Patrick Gallagher dafür, dass er mich in den illustren Kreis der Autoren von Allen & Unwin aufnahm, und meinen scharfsichtigen Lektorinnen Clare Emery und Jo Jarrah. Dank an meine wunderbare Familie für Gewährung meiner »Entfernung von der Truppe« nach Shanghai. Dieses Buch handelt davon, welche Wunder Menschen aus unterschiedlichen Kulturen im asiatisch-pazifischen Raum vollbringen können, wenn sie zusammenarbeiten. Daher widme ich den Band den beiden Paaren Todd und Allison Wong sowie Scott und Marybeth Lawson, den lieben Freunden und interkulturellen Brückenbaumeistern.
1
Im alten China, im ersten Jahrhundert, wurde ein Übeltäter ertappt, als er eben den Kaiserpalast ausrauben wollte. Man verurteilte ihn zu zwanzig Tagen Kerker. Der Kerker war jedoch, wie sich zeigte, kein gewöhnliches Gefängnis. Er bestand aus weißen Vierecken, die auf den nackten Boden gemalt waren.
Man führte den Räuber in die Mitte eines der gemalten Vierecke. Nur ein einziger anderer Mensch befand sich dort im angrenzenden Viereck: ein alter Mann mit langem Bart.
Der Räuber fragte: »Was ist denn das für ein Kerker?«
Der alte Mann sagte: »Der schlimmste, den es gibt auf der Welt. Sollte ein Gefangener je seine Linien überschreiten, so kommen alle Dämonen der Hölle und verschlingen ihn.«
Der Räuber war entsetzt und verharrte die vollen zwanzig Tage innerhalb der gemalten Striche. Nach Ablauf der Frist trat der alte Mann aus seinem Viereck heraus.
Der Räuber fragte: »Warum wirst du nicht von den höllischen Dämonen aufgefressen?«
Der alte Mann antwortete: »Ich bin kein Gefangener. Ich bin der Wärter.«
Grashalm: Die Leute glauben, dass sie auf ihre Umgebung reagieren. In Wahrheit jedoch reagieren sie darauf, wie andere auf ihre Umgebung reagieren. Die schlimmsten Dämonen hausen im Innern des Men…
Kawumm! In ohrenbetäubendem Tosen ging die Welt zugrunde. Zumindest klang es so. Und wirklich erzitterte das Gebäude derart heftig, dass C.F. Wong der Füller aus der Hand flog und die elegante letzte Zeile mit einem unschönen Krakel abschloss. Jäh fuhr er hoch, plötzlich auf der Hut. Mut yeh si? Was ist los? Ist das Ende der Welt gekommen? Bricht das Büro zusammen? Hat jemand im oberen Stockwerk einen Amboss fallen lassen? Er sah, wie durch die Erschütterung sein Becher mit Chrysanthemen-Tee zum äußersten Tischrand wanderte, und zog ihn zurück.
»Himmel!«, sagte seine Assistentin Joyce McQuinnie, deren Kopfhörer von ihrem Schreibtisch rollten und zu Boden fielen. »Was war das denn? So was wie ʼn Erdbeben?« Sie begann an einem Fingernagel zu knabbern.
»Aijaaaa!«, schrie Wongs Sekretärin Winnie Lim, die aus ihrem vegetativen Zustand erwachte und vom Stuhl aufsprang. »Jeder muss selbst zuerst retten!« Sie wühlte in ihrem Schreibtisch und torkelte dann aus dem Büro. »Wenn ich umkomme, ich verklag Sie!«, warnte sie ihren Arbeitgeber aus dem Korridor und klickte dann auf ihren Pfennigabsätzen die Treppe hinunter. Unversehens verstummte das Geräusch ihrer Schritte. Offenbar hatte sie es sich anders überlegt. Klick, klack, kam es wieder näher, als sie zurückstieg. Wie ein kleines Nachbeben stürmte sie durch die Bürotür und grub in ihrer Schublade nach etwas Wichtigem, das sie retten musste: ihrem silbrigrosa Lippenstift, den man hierzulande nicht bekam.
In diesem Augenblick schickte ein neuer gewaltiger Stoß noch heftigere Vibrationen durchs Gebäude und durchzitterte alles Lebende und Unbeseelte im Raum. Wongs Teebecher fiel vom Tisch, und er musste zusehen, wie er mit melodischem Klirren am Boden zerschellte. Auf dem fadenscheinigen Teppich hinterließ der helle Tee einen Fleck, dunkel wie Blut. Wieso verursachten helle Flüssigkeiten so oft schwarze Flecke? Wong schob die Frage für künftige Überlegungen beiseite. Joyceʼ iPod landete neben ihren Kopfhörern am Boden. Jetzt hatte sie vier Finger im Mund.
Winnie wimmerte und stakste ohne ihren kosmetischen Schatz wieder hinaus. »Sie schulden mir ein Lippenstift Vergütung«, keifte sie.
»Ehe ich zahle, sterbe ich lieber!«, rief Wong ihr nach.
»Ja, ich hoffe«, gab Winnie zurück und klapperte schwankend die Treppe hinab. »Heute!«
Joyce, vor lauter Unentschiedenheit wie gelähmt, biss sich nicht länger auf die Finger, sondern zog sie aus dem Mund und begann stattdessen an ihrer Unterlippe zu nagen. Winnies Vorbild folgend sah sie sich nach wichtigen Besitztümern um, kramte in den Zeitschriften auf ihrem Schreibtisch und fand ihre wertvollste Habe: ihr Handy, oder genauer das digitale Adressenverzeichnis darin.
Joyce neigte bei Panik zu verlangsamter Reaktion: je akuter, desto zögerlicher. Das war freilich kein besonders intelligentes Verhalten, auch entsprach es durchaus nicht der evolutionären Überlebenstheorie. Aber so war Joyce nun mal. Sie hatte wirklich keine Ahnung, wie sie auf die Situation reagieren sollte. »Wir ziehen wohl am besten Leine, sag ich mal?«
Selbstverständlich hatte Joyce Angst, doch zugleich war sie einfach sauer. Sollte sie jetzt vor Furcht oder vor Frust schreien? Ein Erdbeben! War das zu fassen? Im Lonely Planet stand kein Wort über Erdbeben. Schon die ganze Woche war sie irgendwie genervt, weil sie sich nach dem schicken, englischsprachigen Singapur in Shanghai nur schwer zurechtfand. Hier sprach ja fast niemand Englisch. Die meisten Hinweistafeln, Ladenschilder, Speisekarten und überhaupt alles trugen nur chinesische Schriftzeichen. Zudem kam ihr das Leben in dieser Stadt größtenteils unwirklich vor. Die Gebäude schienen direkt vom Set der Jetsons – oder vielleicht von Dune – zu stammen: antik und futuristisch direkt nebeneinander. Einer der oft abgebildeten Shanghaier Wolkenkratzer sah aus wie eine Stahlzange, die einen Ballon hielt. Andere waren kugelförmig, und einer glich einem Ball am Stiel: ein absurdes, gigantisches kantonesisches Fischbällchen, in dem Leute herumwuselten. Das Park Hotel wirkte, als hätte jemand eine Kopie des Empire State Building gebaut und dann darauf herumgetrampelt und die Stockwerke zusammengedrückt. Nicht weit davon stand das Radisson, ein hoher weißer Turm, auf dem anscheinend ein riesiges UFO aus einem Science-Fiction-Streifen der Fünfzigerjahre gelandet war. Zwei dünne Seile hingen von Dachverstrebungen herab, als ob die Außerirdischen gerade angeln würden.
Ebenso abartig wie die Architektur erschien ihr die hiesige Kultur. Täglich entdeckte sie Neues, Seltsames und total Unglaubliches. War die Menschheit wirklich reif für den Fischleder-Anzug aus Heilongjiang-Lachs von Hezhenin? Oder für die englischen Schildchen in manchen Taxis: »Keine Betrunkenen und Psychopathen ohne Wärter«? Sollte es Läden echt erlaubt sein, getrocknete Schweineschnauzen auszustellen? Die wollte doch wohl keiner sehen, geschweige denn verzehren! Und als sie Shanghaier Bekannten erzählte, dass sie kein Fleisch mehr aß, meinten diese argwöhnisch, Vegetarismus sei ein Kult, der traditionell mit Gewalt, Gangstertum und Unterwelt zusammenhinge. China war dermaßen anders als … na ja, die ganze Welt, dass Joyce sich bedroht und ausgesetzt fühlte. Je weniger sie ihr neues Domizil begriff, desto stärker hatte sie den Eindruck, dass unter ihren Füßen Risse und Spalten klafften. Und jetzt schwankte Shanghai tatsächlich! Die Eingeweide der Stadt rumorten. Ebenso ihre eigenen: Sie merkte, dass sie dringend auf die Toilette musste.
Wong gab ihr vom andern Ende des Büroraums her keine Antwort. Ihm war unklar, was Joyce gemeint hatte, als sie von »Leine ziehen« redete. Wenn das jetzt wirklich ein Erdbeben war, hatten sie wohl kaum Zeit, irgendwelche Seile zu spannen …
Er war erschüttert, aber nur körperlich. Panik empfand er keine. Er dachte nach. Schon früher hatte er Erdbeben durchgemacht, und das Gefühl vergaß man nicht so leicht. Es war unmöglich, das Grauen bei einem Beben jemandem zu vermitteln, der noch nie eins erlebt hat. Das geht über bloßes Erschrecken hinaus. Da wandelt sich dies eine, auf das man sich immer, immer, immer verlassen hat, in einen tödlichen Feind! Der Boden, das Firmament, die Felsen und Bäume und Berge, die Erde, die festen Fundamente aller von jeher vertrauten Dinge spielen auf einmal verrückt, tanzen minutenlang Shimmy und Tango. In der materiellen Welt entspricht das dem psychischen Schock, den ein Kind erleidet, wenn seine Mutter ihm mitteilt, sie sei nicht seine richtige Mutter, weil es in Wirklichkeit vom Seegespenst Kanasi in der Provinz Xinjiang abstammte. Erdbeben rühren an die tiefste, dunkelste Seite der Seele. Doch das hier hatte nichts dergleichen getan.
»Ich glaube, kein Erdbeben«, kommentierte Wong eher für sich selbst, während er an seinen spärlichen Kinnhaaren zupfte. »Abbruch, glaube ich.«
Er trat an das alte Schiebefenster, das er nicht ohne erhebliche Mühe aufzog. Die kühle Luft eines Shanghaier Apriltags strömte herein, zugleich mit der Erkennungsmelodie der City: Ein winselnder Schlagbohrer-Sopran übertönte atonal das rhythmische Bariton-Stakkato der Presslufthämmer, und seltsam fremd heulte in der Ferne als Tenor-Fuge die Gegenstimme einer Polizeisirene im New Yorker Ton.
Auf dem sumpfigen Ödland vor ihrem kleinen Häuserblock abseits der Henanzhong-Lu1 in einem weniger angesagten Winkel des Huangpu-Bezirks2 standen denn auch etliche wuchtige Geräte, die vorher nicht da gewesen waren. Wong machte sogleich den Übeltäter aus: Ein rostiger grüner Kran schwenkte lässig eine Abrissbirne gegen die Räume, die an ihr Büro im vierten Stock grenzten. Der Anblick war ihm auf Anhieb vertraut und doch neu. In Shanghai gab es an jedem beliebigen Tag einundzwanzigtausend Baustellen, und ihr Bürohaus war anscheinend soeben zur einundzwanzigtausendersten geworden. Doch ein Abriss durch Schwermaschinen samt seiner kompletten Büroeinrichtung: das war entschieden kein gutes Fengshui! Ganz besonders heute, am inoffiziellen Eröffnungstag der Firma C.F. Wong & Co. (Shanghai), Fengshui-Berater, getragen vom multinationalen Immobilienkonzern East Trade Industries GmbH.
»Wei!«, rief Wong einem Mann mit Schmerbauch und schmutzigem gelbem Helm zu, der eine Klemmtafel hielt und die Arbeiten vom Boden aus zu leiten schien. »Sie können dies Gebäude jetzt nicht abreißen. Es sind noch Leute drin. Leute sind hier!« Er sprach Hochchinesisch mit südlichem Akzent.
Der Bauführer hob träge sein Megafon und richtete es auf ihr Fenster. »Bringen Sie die Leute raus, dalli, dalli«, antwortete er im selben Dialekt und deutete auf seine lehmverschmierte Armbanduhr. »Wir haben Termine!«
Joyce, die zu ihrem Chef ans Fenster getreten war, froh, endlich den Mut gefunden zu haben, sich ein paar Meter vorzuwagen, schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist ja wohl so was von nicht angesagt, also total!«, fand sie.
»Sie sollten uns das im Voraus mitteilen«, schrie der Fengshui-Meister auf Chinesisch den teilnahmslosen Männern zwölf Meter weiter unten zu. »Man muss uns warnen. Sie können nicht einfach das Haus demolieren!«
Der Kranführer zu ihrer Linken schwenkte den Eisenball fort vom Gebäude, blieb aber abwartend vor seinem Armaturenbrett sitzen und überließ seinem Vorgesetzten ein kurzes Zwischenspiel, damit dieser den Insassen des ausrangierten Blocks die schlechte Nachricht in vollem Umfang beibringen konnte. »Das Gebäude wird abgerissen. Heute. Sie müssen es räumen.«
Als er die beiden schockierten Gesichter sah, die trotzig am Fenster verharrten, fügte er hinzu: »Wir haben Ihnen geschrieben, dass wir zu diesem Termin den Block hier abreißen. Der Brief ist wohl verloren gegangen.« Auf seinem Gesicht breitete sich ein hässliches halbes Grinsen aus.
»Oh!« Wong überlegte kurz. Für Joyce dolmetschte er: »Der Mann sagt, sie haben uns geschrieben, aber der Brief ging in der Post verloren.«
Die Augen des Fengshui-Meisters verschwanden zwischen lauter Runzeln, während er seine Alternativen erwog. Hm. Aha! Jetzt wusste er, was ablief: eins der beliebtesten Spielchen in der Volksrepublik China. Es hieß Bürokratie. Jederzeit, Tag und Nacht, konnte man sich mitten in einer Runde finden, auf Gedeih und Verderb. Das machte das Leben in China so, nun, sagen wir: interessant. Erfolgreiches Spiel erforderte äußerstes Geschick, das man allein durch aktiven Einsatz entwickelte, da es weder Handbücher noch Lehrer gab, welche die Regeln erklärten. Zum Glück hatte Wong schon früher mitgespielt, wenn auch nicht sehr lange.
Joyce blinzelte. »Moment mal! Die haben uns ja vielleicht einen Brief geschickt. Aber woher will der Typ wissen, dass der nicht angekommen ist?«
Das war nun zwar logisch gedacht, aber doch wohl etwas zu folgerichtig, um hier weiterzuhelfen. Trotzdem entschloss sich Wong mangels anderer Ideen, das Argument aufzugreifen. »Woher wissen Sie denn, dass die Post verloren ging?«, rief er aus dem Fenster.
»Solche Briefe gehen meistens flöten«, gab der Vorarbeiter zurück, wobei sein unangenehmes Grienen noch um eine Spur boshafter wurde, weil er glaubte, einen K.-o.-Schlag geliefert zu haben.
Wong nickte. Genial pariert, dagegen ließ sich nur schwer etwas einwenden. Aber er musste es probieren. Da der Mann da unten die spitzfindige, typisch festländische Logik gegen ihn ins Feld führte, hieß es mithalten. »Er ist ja gar nicht weg. Wir haben ihn bekommen«, sagte er mit hochgerecktem Kinn und gesenkten Brauen, um deutlich zu machen, dass er durchaus kein schwächlicher Gegner war.
Nun zog der Vorarbeiter die Brauen zusammen. Diese Antwort hatte er nicht erwartet. So hatte bisher noch kein Opfer der Bürokratie zu reagieren gewagt. Darauf war er nicht gefasst. Er senkte seine Flüstertüte, um sich mit dem neben ihm stehenden Mann zu beraten, einem hageren Menschen, der ein Bündel Pläne hielt. Was sagen wir jetzt?
Wong beobachtete das zunehmende Unbehagen der Männer und erkannte, dass er in Führung lag. Daran musste er sich mit all seinen knotigen Fingern festklammern! »Jawohl, wir haben das Schreiben bekommen. Und auch darauf geantwortet mit der Bitte um Aufschub. Und auch Antwort erhalten, worin uns der Aufschub zugesagt wurde!«
Der Bauführer verlor die Partie. Wütend fauchte er: »Ach was! Nein, nein, nein! Der Brief ist auf jeden Fall verloren gegangen.«
»Ist er nicht.«
»Ist er wohl! Muss er ja, denn wir haben ihn doch überhaupt nicht …« Abrupt verstummte er. Um ein Haar hätte er sein Blatt verraten, und er wusste, dass sein Gegner das wusste und dass der auch wusste, dass er das wusste. Während er die Strategie wechselte, nahm seine Miene einen neuen, leise angriffslustigen Ausdruck an. »Der Brief ist wurscht!«, rief er. »Ob angekommen oder nicht. Verschwinden Sie! Wir haben eine Genehmigung für diese Arbeiten.«
Genehmigung. Eine Trumpfkarte in China. Aber Wong hatte in Singapur gelebt. Mit Genehmigungen kannte er sich aus. »Sie müssen mir drei Genehmigungen von den drei zuständigen Ministerien zeigen«, antwortete er seelenruhig.
»Ah, wir haben eine Sondergenehmigung«, sagte der Vorarbeiter. Eindeutig hatten beide Seiten eine Art Gleichstand in ihrem Gefecht erreicht: Hieb, Parade, Hieb.
»Dann müssen Sie mir die Sondergenehmigung zeigen, womit sich die drei behördlichen Genehmigungen erübrigen.«
»Auch die hat man uns erlassen.«
Wong knirschte mit den Zähnen. Sein Feind verstand sich sehr geschickt auf die Kampftechniken der Mann-gegen-Mann-Bürokratie, schwarzer Gürtel, vierter Dan. Was sollte er jetzt vorbringen? Aber natürlich: Stempel, Siegel! In China ging gar nichts ohne mit amtlicher roter Siegelfarbe beschmierte Dokumente. »Das kann man Ihnen nur mit einem abgestempelten Bescheid erlassen. Zeigen Sie mir die Siegel!«
Wieder senkte der Bauführer sein Megafon und dachte nach. Sekunden später hob er es und erklärte etwas weniger selbstsicher: »Klar hab ich gestempelte Papiere. Drüben im Büro.«
»Holen Sie sie.«
»Geht nicht. Zu viel zu tun. Keine Zeit.«
»Dann telefoniere ich mit meinem Freund Zhong, Chef der Sicherheitsabteilung im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas, damit seine Leute kommen und Ihnen erklären, warum Sie die richtigen Stempel brauchen. Ich ruf ihn gleich an, okay?«
Ein schiefes Grinsen war die Antwort. »Wenn Sie mit den Unsterblichen vom Politbüro so dick befreundet sind, wieso hocken Sie dann in diesem lumpigen Kasten in der billigsten Straße der Stadt?«
»Ich bin nur ein einfacher Fengshui-Berater«, sagte Wong und hielt demonstrativ seine Luopan3 aus dem Fenster. »Aber heutzutage achtet jeder auf Fengshui – sogar der Ministerpräsident.« Mit seiner freien Hand griff er in die Tasche, zog etwas hervor, das wie eine Visitenkarte aussah, und hielt auch diese ans Fenster, obwohl er wusste, dass der Bauführer den Text auf die Entfernung nicht entziffern konnte. »Vor einem Monat hatte ich eine Besprechung mit den mächtigsten Persönlichkeiten in diesem Land.« Die Karte war bloß ein Stück Werbemüll, worauf ein gewisser Wu, »der Wunder wirkende Wasserinstallateur Nummer eins«, seine Dienste anpries. Wong sprach dennoch im Brustton der Überzeugung, denn tatsächlich hatte er im vergangenen Monat bei einem Sondierungsbesuch den Sicherheitsbeauftragten des Ministerpräsidenten in Fengshui-Fragen beraten.
»Ich glaub kein Wort«, sagte der Bauführer, dessen nervöse Stimme verriet, dass er Wong sehr wohl einiges glaubte. Er starrte den chinesischen Kompass und das Kärtchen an. Allmählich verflüchtigte sich sein überheblicher Gesichtsausdruck.
»Dann ruf ich ihn jetzt an«, sagte der Geomant, legte die Luopan beiseite, nahm einen Telefonhörer auf und begann die Tasten zu drücken.
Einen spannungsgeladenen Augenblick lang stagnierte die Partie – eine Sekunde, die wie zehn wirkte. »Halt!«, sagte der Bauführer zu seinem Kollegen im Kran, darauf zu Wong: »Ihr habt eine Stunde zum Packen. Dann machen wir den Kasten zu Staub, mit allen, die noch drin sind. Wir arbeiten hier nämlich im Auftrag der Zentralen Militärkommission. Einer wie Sie hält unser Projekt nicht auf! Sie haben eine Stunde.« So, wie er den Namen der Behörde herausposaunte, betonte er die Macht, die er hinter sich wusste.
Wie eine Schildkröte, deren Kopf man angestoßen hat, zog der Fengshui-Meister seinen Oberkörper aus dem Fenster zurück. »Sieg, aber nur ganz klein«, erklärte er seiner Assistentin. »Gerade genug Zeit zum Packen, und weg. Eine Stunde.«
Joyce wählte bereits eine Nummer am Telefon. »Wenn wir raus müssen, dann sollten wir et cetera. Ich ruf Marker an, PDQ.«
»Pie-die-Kuh?«
»Englischer Slang. Heißt pretty damn quick – ganz verflixt schnell. Er kann uns ja wieder beim Räumen mit unserm Kram helfen.«
»Jawohl«, stimmte Wong zu, setzte sich und stützte sein Kinn in die Hände. »Rufen Sie ihn an, pie-die-Kuh!«
Er bedauerte, dass sie ausziehen mussten. Dieses Büro gefiel ihm recht gut. Sein Leben bestand ja aus einer endlosen Suche nach Räumlichkeiten, in denen das Chi4 so perfekt strömte, dass es seine Existenz förderte. Allzu oft plante man heutzutage Büros mit großen Fenstern als offene Großräume, durch die die Energie in mächtigem geradlinigem Strom vorwärtsstürzte: Da wunderten sich die Leute, wenn sie sich ständig müde und ausgebrannt fühlten. Andererseits glichen ältere Büros mit ihren Aktenschränken und Papierstapeln nicht selten irrgartenartigen Kaninchenbauten, wo das Chi sich staute: Dort rätselte man, wieso die Geschäfte nicht florierten. Was er suchte, waren Räume, in denen das Chi strömen, sich sammeln und dahinschlängeln konnte wie ein Bach, der durch Teiche rieselt. Zudem mit billiger Miete, versteht sich. Auf dieses Büro traf beides zu. Doch anscheinend war ihm diesmal kein Glück beschieden. Er würde seine Schicksalssäulen befragen müssen, um herauszufinden, wo der Fehler lag.
Heute früh hatte großes Yin vorgeherrscht – stille, kühle, weiche Wasserenergie umströmte ihn, sodass er imstande gewesen war, produktiv an seinem literarischen Meisterwerk zu arbeiten, einer Zusammenstellung erbaulicher, geistig anregender altchinesischer Anekdoten, die er unter dem Titel Gesammelte Sprüche östlicher Weisheit niederschrieb. Yin war intellektuell, kreativ, es konzentrierte das Denken auf wundervolle Weise. Und doch war dieser Yin-Tag von einer Abrissbirne gestört worden, einem Gegenstand von denkbar stärkstem Yang, allenfalls übertroffen von Kanonenkugeln. Yang-Energie war brutal, unnachgiebig, schwer, und sie hatte in seine Yin-Oase mit der Wucht eines Meteoriten eingeschlagen. Wie konnten derart extreme Gegensätze nebeneinander bestehen? Da fiel ihm ein alter Text ein, der besagte, dass extremes Yin nur einen Schritt von seiner Wandlung in Yang entfernt war, extremes Yang wiederum ganz nah bei Yin. Rasch durchblätterte er sein Notizbuch und fand die Stelle, die er suchte. Sie stammte aus dem elften Jahrhundert und war den Schriften von Zhou Dunyi5 entnommen: »Taiji, das Urprinzip, bringt durch Bewegung Yang-Energie hervor. Was geschieht, wenn Bewegung ihre äußerste Intensität erreicht? Sie wandelt sich in Ruhe. Die Ruhe nimmt zu. Was geschieht, wenn Ruhe ihre äußerste Grenze erreicht? Sie weicht der Tätigkeit. So wird Yang zu Yin und Yin zu Yang. Jedes bildet die Wurzel des anderen.«
Doch so sehr es Wong auch widerstrebte, jetzt war nicht die richtige Zeit für Betrachtungen klassischer chinesischer Philosophie, sondern sie mussten ausziehen. Ihre kurze Zeit in diesem Bürohaus war um. Er sah ein, dass er einen kleinen Teilsieg errungen hatte, auf keinen Fall aber die ganze Schlacht gewinnen konnte. Nicht gegen die Zentrale Militärkommission. Die Woche fing ja gut an! Kaum etwas war eher geeignet, einen Fengshui-Experten zutiefst zu deprimieren, als wenn er, nachdem er einen Raum sorgfältig im Interesse einer Erfolgsmaximierung eingerichtet hatte, am Tag seiner Vollendung dessen Abbruch erleben musste. Es sei denn, natürlich, der Klient hatte im Voraus für die Einschätzung bezahlt und würde später nochmals zahlen müssen. Was aber hier nicht zutraf, da Wong sein eigener Klient war. Ihm blieb nur die Hoffnung, die Extrakosten nach oben weiterzuleiten, an den Konzern, der ihn finanzierte.
Noch etwas anderes kam ihm in den Sinn: Heute Morgen hatte er ein merkwürdiges Omen gesehen, über dessen Bedeutung er sich den Kopf zerbrach. Eine Shanghaier Tageszeitung brachte auf der Titelseite das Bild eines weißen Elefanten, den man zweifellos für irgendeinen Zirkus oder dergleichen importiert hatte. Das Bild hatte sich ihm eingeprägt, denn wenn jemand sein Leben entscheidend veränderte, etwa ein neues Geschäft in einem neuen Land aufmachte, dann achtete er selbstverständlich darauf, welche Vorzeichen auftauchten. In den verschiedenen Esoterikschulen Asiens – chinesischen, thailändischen, indischen, vietnamesischen – symbolisierten weiße Elefanten unterschiedliche, aber stets bedeutsame Faktoren wie Königswürde, langes Leben, Magie, den Himmel und eine Reihe anderer Dinge. Doch wofür standen sie in seinem konkreten Fall, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort?
Sogar Joyce hatte er gefragt, was weiße Elefanten für Westler bedeuteten. (Wie die meisten Chinesen betrachtete Wong alle europäisch aussehenden Ausländer, einschließlich Australiern und Neuseeländern, als Westler.) »Im Englischen ist ein white elephant was total Nutzloses«, hatte sie ihm erläutert. »Irgendwas, das man echt überhaupt nicht brauchen kann.« Nun ja, das war die Kultur des Westens.
Schließlich hatte er den Gedanken an das Omen verscheucht und sich an die Niederschrift einer altchinesischen Anekdote gemacht für sein Buch, das erste seiner Werke, das auf Englisch erscheinen sollte. Und mitten in dieser klassischen Erzählung war er dann so rüde durch jenen donnernden Yang-Metallklotz unterbrochen worden.
Fünfzig Minuten später trugen ein paar Möbelpacker und ihr Chef, Marker Cai, ein kleiner, aber kräftiger junger Mann, die ihnen erst vor acht Tagen beim Einzug in dieses Büro geholfen hatten, dieselben Kisten hinaus, um sie einzulagern, bis sich neue Räumlichkeiten finden würden. Es war leichte Arbeit. Keine der beiden Mitarbeiterinnen Wongs tat sich durch Effizienz oder besonders flinkes Arbeitstempo hervor, sodass manche der Umzugskisten noch immer nicht geöffnet, geschweige denn ausgepackt waren.
Der korrekte chinesische Name des jungen Spediteurs lautete Cai Make, doch für Westler vertauschte er die Reihenfolge von Familiennamen und Rufnamen zu Marker Cai. Er war attraktiv: Für sich nannte Joyce ihn Mister Sigh – seufz! Sie träumte davon, ihn eines Tages so gut zu kennen, dass sie ihn überreden konnte, statt des absurden »Marker« den gebräuchlicheren Namen Mark, vielleicht sogar die sexy Version Marc oder Marco anzunehmen. Womöglich blieben sie ja tatsächlich in Verbindung. Denn Cai war »Knochenwäger«, übte also eine der ältesten chinesischen Wahrsagepraktiken aus und stand daher beruflich C.F. Wong nahe. Allerdings kommt ein ehrgeiziger junger Mensch im modernen Shanghai mit Knochenwägen allein auf keinen grünen Zweig. Also schleppte er tagsüber Umzugskisten.
Joyce McQuinnie verstaute die wenigen Sachen von ihrem Schreibtisch in einen Pappkarton – den letzten. Eigentlich war sie fertig. Sie arbeitete so langsam, wie es ihr die bedrohliche Lage erlaubte. Marker Cai und seine Leute trugen die Kisten nach unten, sobald Joyce sie vollgepackt hatte. Er war fünfundzwanzig, sie fünfeinhalb Jahre jünger. Sie musterten sich mit verstohlenen Blicken. Beide fanden einander unsagbar schön, was für Dritte durchaus nicht so offensichtlich war. Jedes hoffte, dass der/die andere sein/ihr heimliches, aber intensives Interesse nicht bemerkte, und ersehnte zugleich halbwegs das Gegenteil. Das schien sich nicht zu reimen, aber was war schon logisch im Liebesspiel?
Selbst Marker versank in nachdenkliche Stimmung. Auch er wusste, dass die Räumarbeit so gut wie geschafft war. Seine Augen schossen hin und her, eindeutig suchte er nach einem Vorwand, um noch ein wenig länger mit dieser jungen lao wai6 zusammenzubleiben. Aber er war um Worte verlegen. Sie sprach, wie er wusste, nur wenig Chinesisch, weshalb ihm klar war, dass ihre Gespräche auf Englisch geführt werden mussten, und das gehörte nicht zu seinen Stärken. Wenn er sich oben im Büro in ihrer Nähe aufhielt, presste er die Oberarme an den Leib, denn er fühlte sich heiß und verschwitzt und fürchtete, dass Joyce sein Geruch unangenehm wäre, so wie Chinesen ja auch den Körpergeruch westlicher Ausländer abstoßend finden. Er trug die vorletzte Kiste nach unten.
Joyce verwendete aus feministisch-ideologischen Gründen nur wenig Make-up, wünschte sich aber, sie hätte heute etwas mehr aufgelegt. In ihrer Brust stach etwas, ein körperlicher Schmerz, den sie sich nicht erklären konnte. Anscheinend hatte er irgendwas mit Markers gutem Aussehen zu tun und damit, dass es/er ihr Herz bis zum Bersten rasen ließ und dass er demnächst von der Bildfläche verschwinden würde. Sie musste unbedingt einen Anlass erfinden, ihn so bald wie möglich wiederzusehen. Heute waren sie sich zum zweiten Mal begegnet. Und wieder, wie beim ersten Mal, löste seine Gegenwart bei ihr einen Anfall von Atemnot aus. Aber man konnte doch nicht jede Woche umziehen. Oder? Vielleicht doch. Irgendwann mussten die Sachen schließlich vom Lager in ein neues Büro geschafft werden. Nur: Bis dahin konnten gut und gern ein, zwei Wochen vergehen, wenn nicht drei. Zu lange!
Immerhin sah es so aus, als würde Wong den jungen Mann einladen, dem Mystiker-Verein beizutreten. Aber dessen nächste Zusammenkunft stand erst am Donnerstag an, in zwei Tagen. So, wie sie sich momentan fühlte, kam ihr selbst ein einziger Tag Wartezeit ewig vor. Ob er wohl morgen Abend frei war? Sie sollte was sagen, die Initiative ergreifen, sich sogar mit ihm verabreden! Chinesische Typen waren ja angeblich viel zu schüchtern für den ersten Schritt. Was sagte sie bloß zu ihm? Ihr wollte beim besten Willen nichts einfallen. Sie griff nach einer vergoldeten Vase mit dem Symbol für langes Leben, wickelte sie in Zeitungspapier und legte sie in den Karton. Wie viel Zeit blieb ihnen noch? Höchstens ein, zwei Minuten. Sie blickte sich nach weiteren Gegenständen zum Einpacken um, aber alle Schreibtische waren leer gefegt. Ganz langsam klebte sie den letzten Karton zu.
Marker erschien wieder im Büro. »Fast fertig«, sagte er und stemmte die Kiste hoch.
Joyce blickte auf. Sieben Zehntelsekunden lang kreuzten sich ihre Blicke.
In diesem Augenblick geschah etwas in Joyceʼ Kopf und Herz – bei ihr handelte es sich um ein und denselben Ort, zwei Seiten, die mit einem ständig »on« geschalteten organischen Breitbandkabel verbunden waren. Die Last ihrer Jugend bedrückte sie. Der wahre Grund lag – vermutlich überraschenderweise – am Gewicht der Mathematik, oder genauer: der Statistik. Joyce hatte nämlich in diesem Moment die Wahl zwischen fünf Möglichkeiten. (Eigentlich wären es sieben gewesen, wenn sie nicht gestern Abend bei OʼMalley drei Gläser Tsingtao-Bier7 getrunken hätte.) Sie konnte den Blick des jungen Mannes festhalten und ihm aus großen Hundebaby-Augen unmissverständlich signalisieren, dass zwischen ihnen beziehungsmäßig gerade etwas total Wichtiges ablief; sie konnte weiter mit dem Klebeband hantieren, das sie gar nicht mehr brauchte; sie konnte husten (etwas in ihrer Kehle juckte und schickte ein Memo an ihr Hirn: Bitte sofort husten!); sie konnte ihre Augen auf Durchzug stellen und einem Gedanken nachgehen, der ihr durch den Hinterkopf geisterte und unter anderem Takte eines im Radio gehörten Songs enthielt; und letztlich konnte sie einfach überhaupt nichts tun, leer werden, nicht mal denken.
Oder etwa nicht? Noch vor ein paar Jahren hätte sie Nein gesagt. Da jeder Moment einen Zeitabschnitt darstellt, hätte sie es für unmöglich gehalten, gar nichts zu tun – denn ein Zeitabschnitt, egal wie kurz, konnte nicht leer sein, und das Gehirn schaltet niemals völlig ab. Inzwischen aber hatte sie sich in Asien mit buddhistischen und anderen Meditationstechniken vertraut gemacht. Heute war sie geneigt, Ja zu sagen: Wir können uns durchaus vollkommen leer machen von allem Denken, von jeder Bewegung, wir können wirklich einen Moment lang die Zeit anhalten. Leicht ist das nicht. Denn kaum ist ein Moment da, so vergeht er auch schon wieder und macht seinem Nachfolger Platz – dem nächsten Moment, der dem ersten ähnelt, ohne ihm zu gleichen. Jeder neue Augenblick stellt uns vor ein weiteres Bündel zu erwägender Möglichkeiten, zu treffender Entscheidungen.
Nun aber die Jugend: Da wird das ganze Thema Zeit zu einer ernsten Herausforderung. Man bedenke: Joyce war neunzehn Jahre, vier Monate, dreizehn Tage, elf Stunden, neun Minuten, zwei Sekunden und anderthalb Augenblicke alt. Sie hatte also, wie uns Demografen versichern, noch einundsechzig Jahre, zwei Tage, sechs Stunden und zwei Minuten zu leben. Da jeder Moment ungezählte Möglichkeiten umfasste und Joyce einundsechzig Jahre voller Momente vor sich hatte, ließ sich die Menge ihrer möglichen Entscheidungen praktisch kaum berechnen – sie ging sicher gegen unendlich.
Im Vergleich zu ihr hatte C.F. Wong denselben Demografen zufolge nur noch fünfzehn Jahre, fünfundsiebzig Tage, vier Stunden und neun Minuten Leben zu erwarten. Für ihn lag die Anzahl der Permutationen weit niedriger und nahm rapide ab.
Dieses mathematische Grundprinzip wirkt sich besonders intensiv auf die Gefühle von Menschen aus, die am Beginn oder am Ende ihres Lebens stehen. Mag sein, dass heute kaum noch jemand einen Kaffee zu $ 2.90 und ein Sandwich zu $ 3.– ohne Taschenrechner addieren kann. Doch was wir sehr wohl beherrschen, ist Differenzialrechnen, und wir betreiben es auch pausenlos.
Jedes menschliche Gehirn leistet unablässig höhere Mathematik, ob wir es wahrhaben oder nicht. Im Unterbewusstsein wissen wir genau, wie schnell die Zeit vergeht und in welchem Tempo unsere Wahlmöglichkeiten abnehmen. Eben diese unbewusste Erkenntnis verursacht jenen Druck, unter dem das Leben eines Teenagers zur Qual wird. Es sind ja die Jahre, in denen uns dämmert, dass jede Entscheidung in jedem Moment Konsequenzen nach sich zieht, die eventuell, nein: unter Garantie den Rest unseres Daseins nachhaltig bestimmen.
Joyce ahnte: Wenn sie Marker Cai jetzt anschaute und seinen Blick für weitere sieben Zehntelsekunden festhielte, würde sie ihm ein klares Signal senden, dass es zu einer Übereinstimmung etlicher Trillionen (mindestens!) möglicher Permutationen seines und ihres Lebens kommen könnte. Diese Überschneidung mochte eine Minute lang anhalten, eine Stunde, einen Tag, einen Monat, ein Jahr oder, falls sie heirateten, ein Leben lang. Daher war es wirklich kein Wunder, dass Joyce sich schwer entscheiden konnte, was sie tun sollte.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Büros saß Joyceʼ Chef und schmunzelte vor sich hin. C.F. Wong war siebenundfünfzig. Der größere Teil seines Lebens lag hinter ihm. Seine möglichen Permutationen waren von annähernd unendlich auf Quintillionen geschrumpft und von da auf bloße Trillionen, Milliarden und Millionen. Der Entscheidungsdruck hatte nachgelassen. An seine Stelle war allerdings ein ebenso emotionaler Faktor getreten: eine zunehmende, unterbewusste Hoffnungslosigkeit aufgrund der Erkenntnis, dass angesichts der relativ wenigen verbliebenen Möglichkeiten jede Entscheidung besonders gründlich überlegt sein wollte. Nur war man schon so müde! Mit siebenundfünfzig neigen wir dazu, das Unverfänglichste zu wählen, das Nichtstun, das absolut leere Nicht-Handeln, Nicht-Denken, die Ausschaltung der Zeit aus jedem Moment. Hier liegt auch eine der Ursachen, warum das Fernsehen eine so hilfreiche Einrichtung ist: Es schaltet Denken und Handeln aus und verschlingt in aller Stille unser Dasein, während wir so tun, als ob nichts geschähe.
Allzu schlimme Depressionen angesichts der flüchtigen Zeit blieben Wong freilich erspart, da er so ungewöhnlich stur auf ein Ziel hinstrebte: Mit verbissenem Eifer raffte er Geld, obgleich seine Schriften größtenteils von der Überlegenheit des geistigen und natürlichen Reichtums über den materiellen handelten. Dieser Zwang saß dermaßen tief in ihm, dass in seinem Dasein kein Platz blieb für Nichtigkeiten wie Hobbys, Fernsehen, Beziehungen und dergleichen. Ihm fehlte jede Geduld für Tätigkeiten, die kein Geld einbrachten – Cash, das er zählen, sammeln, anfassen, streicheln konnte. Fast sein ganzes Leben war er arm gewesen. Was ihn antrieb, war der zähe Wille, so viel zu verdienen, dass er nie mehr arm sein musste. Eine Weile zumindest, ehe er starb.
Armut bringt freilich auch manche Vorteile mit sich, die den Reichen entgehen. Nicht zuletzt wappnet sie die Seele vorzüglich gegen Rückschläge und schärft den Geist, der sonst in Krisensituationen gern klein beigibt. Zwar war Wong mittels Abrissbirne aus seinem Büro vertrieben worden, doch er hatte sich bereits restlos von dem Schrecken erholt. Er sah auf das Positive. Im Grunde, so wurde ihm klar, war es gar nicht so übel, in ein anderes Quartier umzuziehen. Von vornherein war es ihm nämlich etwas peinlich gewesen, Geschäftsräume im vierten Stock akzeptieren zu müssen.8 Weshalb sollte er sich jetzt also groß ärgern, da er Gelegenheit erhielt, sich zu verändern? (Der volkstümliche Aberglaube besetzt die Vier negativ, doch im klassischen Fengshui gilt sie durchaus als günstig. Immerhin: Zu seinen Kunden zählten weit mehr einfache, abergläubische Leute als belesene Intellektuelle, und er hielt es für klüger, sich den geistig Minderbemittelten anzupassen.)
Letztlich konnte der Umzug sich trotz aller Strapazen sogar als Segen erweisen, denn der Immobilienkonzern, der sein Unternehmen stützte, musste notgedrungen für Ersatz sorgen und neue Räume finanzieren. Er war sich sicher, dass die Rechnungsabteilung mosern würde, weil sie den ganzen Vorgang noch mal von vorn aufrollen musste. Also würde er erneut vorschlagen, dass man ihm das Geld überwies und er sich selbst um alles kümmerte, und diesmal dürften sie zustimmen. Wenn nichts sich ändert, droht Stillstand, Veränderungen dagegen enthalten das Potenzial zu persönlicher Bereicherung. Er würde eine beträchtliche Prämie aushandeln, zusätzlich zum Standardbudget für Büroraum, denn er würde darlegen, dass er jetzt dringend etwas Ordentliches brauchte, um die Verluste durch einen so baldigen und hastigen Umzug wettzumachen. Und er würde darauf hinweisen, dass Räume mit gutem Fengshui grundsätzlich mehr kosteten. Dann würde er sich eine billige Bude mit annehmbarer Chi-Strömung suchen und die Differenz einsacken.
Wong als kaufmännisches Naturtalent verstand sich darauf, Leuten Geld abzuknöpfen. Seine Firma war klein, aber durchaus lebensfähig. Jedes Mal, wenn jemand eine Fengshui-Analyse bestellte, machte er sich zunächst rasch ein Bild von der Persönlichkeit des Klienten, um ihm anschließend eine passende Einschätzung aufzutischen. Seiner Erfahrung nach konnte eine Analyse dem einen Kunden restlos zusagen, während sein Nachbar sie rundweg ablehnte. Zum Glück handelte es sich bei Fengshui um ein amorphes, seine Gestalt wandelndes Konzept, das die unterschiedlichsten Interpretationen zuließ.
Seine Kunden teilte er in vier Grundtypen ein:
Erstens die »Abergläubischen«. Ihre grundlegende Motivation beruht auf Zukunftsängsten, wogegen sie sich mithilfe magischer Totems wappnen. Sie leiden oft ein wenig an Platzangst, und der Begriff Agoraphobie ist in Wongs Augen gleichbedeutend mit amerikanisch. Solche Kunden fürchten sich ständig vor schlechten Menschen und folgen nur zu willig dem Rat, an ihrer Tür Figuren der Vier Könige vom Berge Sumeru aufzustellen, damit kein Unglück eindringen kann. Im Büro verwahren sie mit Vorliebe einen Krummdolch gegen die unsichtbaren Dämonen dieser Welt (wozu heutzutage auch Binnenzollbeamte und Computerviren gehören). Für sie besteht das Leben aus einem Kampf gegen gewaltige Horden der Mächte des Bösen, und zu ihrer Selbstverteidigung verlangen sie nach spirituellen Massenvernichtungswaffen.
Zweitens die »futuristischen Primitiven«. Aus unerfindlichen Gründen gehören in diese Gruppe zahlreiche IT- und Computerfachleute, viele Europäer, auch junge, in Kalifornien ausgebildete Inder. Ohne es zu wissen, sind sie zutiefst religiös. Gewiss: Sie beteuern ihre Verachtung jeder organisierten Religion. Unter erheblichem Zeit- und Geldaufwand stellen sie ihr Heim voll mit scheinbar areligiösen Gegenständen. Dabei streben sie nach transzendentaler Erfahrung und brauchen das Gefühl, mit den Schicksalsmächten in Einklang zu stehen. Gern richten sie in ihrer Wohnung einen Platz ein, der einem Altar ähnelt, ohne einer zu sein. Sie befolgen Rituale, die aber nicht religiös scheinen. Über Menschen mit Rosenkränzen oder Gebetsketten lästern sie, kaufen aber bereitwillig mystische chinesische Knotengeflechte, die sie reiben, ehe sie aus dem Haus gehen und sich der Welt stellen.
Drittens die »Shopper«, seine Lieblingsgruppe. Noch vor zwölf, fünfzehn Jahren waren dies ausschließlich müßige Reiche. Mittlerweile entwickeln allerdings auch nicht wenige Angehörige der Mittelschicht die Kaufmanie, vor allem in Australien, Hongkong und Singapur. Diese Personen sind nur mäßig abergläubisch und kaum bereit, in ihrer Umgebung Plastikamulette aufzuhängen. Sie besitzen alles Lebensnotwendige (eine Wohnung, hübsche Möbel, ein Auto, die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio), sind aber dermaßen aufs Shopping versessen, dass sie verzweifelt nach neuen Kaufobjekten jagen. Hauptsächlich geben sie ihr Geld für Sachen ohne praktischen Nutzen aus. Anscheinend treibt sie der Gedanke: »Manche kaufen so etwas, also kann ich das auch.« Bei diesen Leuten setzt Wong massenhaft die bessere Ware ab: elegante, überteuerte Statuetten aus weißer Jade, Kunsthandwerk aus gehämmertem Metall, Silber-, Gold-, Kupfer- oder Bronzefiguren, symbolische Gegenstände, die in Edelstein eingelegte Glückszeichen tragen. Im Lauf der Jahre hat er gelernt, ihnen nie zu viel auf einmal aufzuschwatzen, so groß die Versuchung auch sein mochte. Es interessiert sie ja überhaupt nicht, was sie einkaufen, sondern sie genießen das Shoppen an sich. Daher empfiehlt es sich, ihnen in regelmäßigen Abständen etwas anzubieten, damit sie ihre Kaufsucht ständig durch neue Kicks befriedigen können. Um wieder Geld hereinzubekommen, genügt ein gelegentlicher Anruf: »Das achte Zeitalter hat begonnen. Man kauft jetzt vergoldete Wohlstands-Vasen und bucht Säuberungs-Analysen, damit die Energie aus Südwesten einströmen kann. Wann darf ich Sie besuchen?« Kein »Shopper« kann einem derartigen Vorschlag widerstehen.
Viertens die »wissenschaftlichen Eklektiker«. Anfangs haben sie ihn frustriert, aber seit er weiß, wie er mit ihnen umgehen muss, leisten auch sie gute Beiträge zu seinen laufenden Einnahmen. Es sind hochintelligente Menschen mit kritischem Verstand, die jeden Aberglauben strikt von sich weisen. Schlüge man ihnen etwa vor, acht Goldmünzen unterm Bett zu verstecken, so könnten sie wohl kaum ein Kichern unterdrücken. Erklärt man ihnen dagegen, dass durch ihr Arbeitszimmer eine energetische »Kraftlinie« verläuft, horchen sie interessiert auf und wollen mehr darüber wissen. In der modernen Physik kennen sie sich so ziemlich aus und meinen nun, dass sie vom Studium der materiellen Welt zur Erkenntnis immaterieller Gegebenheiten fortschreiten. Fengshui gehört für sie auf dieselbe Ebene wie Quantenmechanik, Antimaterie, Reiki, extrasensorische Wahrnehmung, Chaostheorie und dergleichen: alles Dinge, die nicht wirklich sichtbar, jedoch hinreichend bewiesen sind, sodass es nur vernünftig scheint, sie zur Kenntnis zu nehmen und ihnen eine gewisse Glaubwürdigkeit zuzubilligen. Wissenschaftliche Eklektiker kaufen niemals irgendwelche Gegenstände, aber für Dienstleistungen zahlen sie gepfefferte Honorare. Sie akzeptieren Fengshui unter streng psychologischen Gesichtspunkten. Wenn man einen Experten dafür bezahlen kann, dass er die Umgebung in einen Lebens- und Arbeitsbereich umgestaltet, in dem man sich wohler, kreativer fühlt – warum nicht? Fengshui-Meister rangieren auf ihrer Skala der Dienstleistungskräfte neben Ergonomiefachleuten, gleich nach Architekten und Leitungsbauingenieuren, noch vor Innendekorateuren und Kunsthändlern.
Außerdem hatte Wong festgestellt, dass selbst jene, die absolut nichts von Fengshui hielten, zur Einnahmequelle werden konnten, weil sie mit Rücksicht auf ihre Angestellten oder Ehepartner Fengshui-Beratungen buchten. Wir sind hier schließlich in Asien, da müssen wir eben in die Tasche greifen, auch wenn sichs vermutlich um Hokuspokus handelt – ein kleiner Preis für die Zufriedenheit der Leute/der Gattin. Du lieber Himmel, so viel soll das kosten? Teufel auch! Nach Wongs Erfahrung eigneten sich diese Leute hervorragend als Testpersonen für sein Verhandlungsgeschick. Die meisten hatten nämlich keine Ahnung, für wie wichtig oder unwichtig ihr Personal das Fengshui der Umgebung tatsächlich hielt. Nun verschafft aber jede Unsicherheit des Kaufwilligen über den Wert des Objekts dem Verkäufer einen entscheidenden Vorteil, den er zu seinen Gunsten maximiert. »Sie ordern Gold, Sir, glaube ich, zusätzlich zum Standardpaket. Sonst läuft die Belegschaft vermutlich bestimmt weg, vielleicht sicher, ohne Frage. Alle kündigen, vermutlich bestimmt!« Die Klienten zahlen gewöhnlich mit goldener oder Platin-Kreditkarte.
Sich selbst und die übrigen Mitglieder seiner Gesellschaft der Berufsmystiker stufte Wong als wissenschaftliche Eklektiker ein, da sie äußerst sorgfältig überlegten, was sie sich in ihre Büros oder Wohnungen hängten, und gründliche Studien der esoterischen Künste betrieben, um den gemeinsamen Nenner ihrer verschiedenen Fachgebiete zu ermitteln.
Tatsächlich beruhte das Schmunzeln, das in diesem Augenblick auf Wongs Zügen spielte, zum Gutteil darauf, dass er an diese Berufskollegen dachte. Wenn bei ihm überhaupt von einem Freundeskreis geredet werden konnte, dann waren es die paar Personen, aus denen die Gesellschaft der Berufsmystiker bestand. Gegründet worden war sie in Singapur, hatte aber inzwischen auch in anderen asiatischen Ländern und Stadtstaaten Fuß gefasst. Wong war vor einer Woche nach Shanghai übergesiedelt, unter anderem in der Absicht, hier eine arbeitsfähige Filiale seiner Gesellschaft zu etablieren – nicht ehe er ein Startpaket an hoch dotierten Aufträgen beisammenhatte, wie sich denken lässt.
Zu den aktivsten Mitgliedern gehörten außer Wong selbst der indische Astrologe und Vastu-Gelehrte Dilip Kenneth Sinha, der an diesem Abend oder am folgenden Morgen aus Singapur in Shanghai eintreffen sollte, sowie Madam Xu Chongli, eine Singapurer Chinesin, ihres Zeichens Wahrsagerin, die ebenfalls innerhalb der nächsten sechsunddreißig Stunden erwartet wurde. Sie würden später mit Shang Dan zusammentreffen, einem Shanghaier Mingshu-Fachmann, also einem Kenner der chinesischen, auf Mathematik und Zahlensymbolik beruhenden Astrologie. Er sollte, so hoffte Wong, zu ihrem wichtigsten Kontakt in dieser Stadt werden, wenn sie hier ihre neue Zweigstelle eröffneten. Dann war da noch Cai Make, Knochenwäger und Spediteur. (Trotz der grusligen Bezeichnung hat Knochenwägen nichts mit Hantierungen an Skeletten zu tun, sondern ist im Wesentlichen eine numerische Praktik.)
Für Donnerstag hatten die Mystiker ein Abendessen in irgendeinem netten Restaurant geplant – vielleicht im »Emperor Xianfengʼs Kitchen«9 in der Yunnan-Lu. Wong wollte seine Singapurer Freunde mit Delikatessen wie kaltem gesalzenem Huhn, xianji, oder Tigerhaut-Chili, hupi jianjiao, bekannt machen. Und natürlich mit dem Eichhörnchenfisch – der würde Sinha schmecken. Sie standen ja fast alle in dem Alter, da man die einzige Sinneslust, die noch reizt, durch ein gutes Essen befriedigt. Es würde gewiss ein herrliches Wiedersehen und ein köstlicher Schmaus!
Wong war eben doch nicht so einseitig, obwohl er das empört abgestritten hätte. In den seltenen Zeiten, da er nicht wie besessen an Geld dachte, pflegte er seinen Magen.
Im Moment sah es in kulinarischer Hinsicht gut aus für ihn. Abgesehen von dem zu übermorgen angesetzten Arbeitsessen mit den Kollegen steckte in seiner Tasche die Einladung eines soeben gegründeten, ultranoblen Dinnerklubs namens This Is Living10 für heute Abend zum Eröffnungsbankett in einem neuen Luxusrestaurant, das als Klublokal diente und in einem Shanghaier Wolkenkratzer lag. Wong hatte das Fengshui in dem neuen Lukullustempel eingerichtet und war hocherfreut gewesen, als der Manager ihn einlud, am Gründungsbankett des Klubs teilzunehmen, für das die »aufregendste Speisenfolge in ganz China« angekündigt wurde. Im Übrigen hatte er dem Manager eine geradezu unverschämte Rechnung präsentiert, und dieser hatte allen Ernstes versprochen, sie heute Abend während des Festessens in bar zu begleichen.
Das Leben war schön, und hier in Shanghai fühlte er sich momentan wundervoll. Die Architektur dieser Stadt begeisterte ihn. Aus der Ferne sah sie vielleicht wie ein zusammengewürfelter Mischmasch aus, doch Wong erkannte manch verborgenes Fengshui-Element. Im Herzen der Stadt befand sich ein offenes Areal: der Platz des Volkes und der Volkspark.11 Würde man in einem Hubschrauber aufsteigen, könnte man deutlich erkennen, dass die Straße, die um den Platz führte, einen exakten Halbkreis beschrieb, dessen andere Hälfte durch die Zhejiang-Lu und die Nanjingdong-Lu gebildet wurde. Von Norden nach Süden durchschnitt die Xizang-Lu die beiden Halbkreise genau in der Mitte. Die ganze Anlage fügte sich zu einem fast quadratischen Kreis, den eine Gerade durchkreuzte. Jawohl: Sie formte das Schriftzeichen zhong, »Mitte«, das erste der beiden Zeichen für China, Zhongguo. Im Englischen übersetzte man dies in der Regel mit Middle Kingdom, Reich der Mitte, aber das wurde der wahren Bedeutung keineswegs gerecht, denn Zhongguo stand selbstverständlich für »Land im Mittelpunkt der Welt«!
Die wichtigsten Gebäude am Platz des Volkes waren das Große Stadttheater, das Museum für Bildende Kunst und die Stadtverwaltung. Die Portale aller drei Bauwerke öffneten sich nach Süden, was bester Fengshui-Tradition entsprach. Das Große Theater sah aus wie eine himmelwärts geöffnete Schale, das Museum wie ein ding, das dreibeinige bronzene Ritualgefäß des Altertums. In einem weiter westlich gelegenen Stadtteil stand das Shanghai Center, das eindeutig in Form des Schriftzeichens shan, »Berg«, gestaltet worden war.
Oh ja, der Terminkalender des Fengshui-Meisters enthielt in diesen Tagen viel Gutes: zwei üppige Abendessen innerhalb dreier Tage, das Wiedersehen mit den Freunden und die offizielle Einweihung der Shanghaier Gesellschaft der Berufsmystiker. Daher also saß Wong in seinem zum Abriss verurteilten Büro und schmunzelte.
Unter einem weiteren ohrenbetäubenden Stoß erbebte das Gebäude. Die nackte Glühbirne begann zu schaukeln. Glas zersplitterte klirrend, als nebenan Fensterrahmen aus der Wand fielen. Das Abbruchkommando war wieder am Werk. Man ließ die Zentrale Militärkommission nicht warten!
Marker Cai stemmte die letzte Kiste hoch und reichte sie einem seiner Leute, einem fetten, verschwitzten Burschen, der sie nach unten trug.
»Fertig«, sagte Cai.
»Äh – danke, gut gemacht«, stammelte Joyce. »Find ich toll. Em …«
»Okay.«
»Super. Danke. Ihr habt das echt genial geschafft. Kann ich mal fragen. Äh … magst du …«
»Ja?«
»Ach, ich dachte bloß. Verstehst du. Vielleicht …«
»Aha.«
»Also, magst du mal auf ʼn Kaffee gehn oder was, die Tage oder so?«
»Okay. Kaffee oder was, die Tage oder so.«
»Äh … ich ruf dich an, ja? Oder du mich.«
»Ja.«
Joyce grub in ihren Taschen nach etwas zum Schreiben. »Äh, ich hol mal ʼn Stift oder was in der Art und geb dir meine Handynummer.«
Aber sämtliche Stifte waren verpackt. »Ich hab keinen … Hast du was …?«
Marker beklopfte seine Taschen, fand nichts, entdeckte schließlich einen Bleistiftstummel hinter seinem linken Ohr. Kurz und verlegen lachte er auf, weil beide die Knabberspuren am Ende des Stummels gesehen hatten.
Abermals vibrierte das Haus unter einem Stoß, doch die jungen Leute merkten nichts davon. Weit stärkere Explosionen – man könnte von Hundert-Megatonnen-A-Bomben sprechen – detonierten in ihren Drüsen.
»Jetzt brauch ich nur noch ʼn Zettel«, sagte Joyce. Ein Problem! Auch das ganze Papier steckte in den Umzugskisten.
Marker zog eine zerknautschte, etwas feuchte Visitenkarte aus der Tasche und gab sie ihr. »Du rufst mich an. Handynummer steht hier. Wir gehen zu Kaffee. Oder was. Die Tage.«
»Yeah! Super. Haha«, meinte sie. »Cool. Okay! Also tschüss. Bis, äh … dann mal.«
Sie trat zurück und hielt seinen Blick ein Komma neun Sekunden länger fest als unbedingt nötig, wobei ihr Herz diverse Purzelbäume schlug. Zu den zahllosen vorhandenen Möglichkeiten kam eine weitere Trillion hinzu. Wie herrlich war doch das Leben! Da war er auch schon verschwunden.
Im nächsten Augenblick rannten sie und Wong die Treppe hinunter, während ringsumher das Gebäude einstürzte.
2
Wer zur Arbeit geht, wenn alle andern nach Hause eilen, könnte das deprimierend finden. Was jedoch nicht immer gesagt ist. Manchmal spürt man überrascht, dass Gegen-den-Strom-Schwimmen die Lebensgeister seltsam anregt.
In letzter Zeit machte Lu Linyao jeden Nachmittag diese Erfahrung, was ihr leichte Sorgen bereitete. Sie schien ja wirklich gegen einen reißenden Strom anzukämpfen, wenn ein wahrer Menschen-Yangtze aus den Bürohäusern quoll, die auf der bebauten Seite der Zhongshandong-Lu standen, dem ehemaligen Bund. Wie ein achtundfünfzig Kilo schwerer, kraftvoll stromauf strebender Lachs kämpfte sie sich mit den Schultern durch die Menge. Als die energische Person, die sie war, trat Linyao nur halb aus dem Weg und überließ Entgegenkommenden den Rest.
Manche Männer – ob aus Rücksichtslosigkeit, Schlafmangel, Lebensüberdruss oder sonstigen Motiven – rempelten sie an. Das bekam ihnen schlecht, denn Linyao trug absichtlich immer ein gebundenes Buch unterm Arm, dessen scharfe Kanten schmerzhafte Spuren bei jedem hinterließen, der unvorsichtigerweise ihrer Brust zu nahe kam. Lief eine Gruppe von drei oder mehr Personen direkt auf sie zu, dann senkte sie den Kopf und jagte wie aus der Pistole geschossen mitten hindurch, sodass die Leute notgedrungen auseinandertraten, um sich hinter ihr wieder zu formieren. Mancher drehte sich nach ihr um: Was ist denn in die gefahren? Wenn es auf den Gehwegen noch enger wurde bei ihrem Hürdenlauf (denn so empfand sie die meisten Mitmenschen: als Hindernisse), ging sie durchaus nicht langsamer. Im Gegenteil beschleunigte sie ihren Marsch.
Doch als sie die Hauptstraße mit ihrem Gewühl passiert hatte und in eine ruhigere Gasse einbog, ging sie langsamer. Verlief sie sich auch nicht? Und tat sie überhaupt das Richtige? Vielleicht sollte ich die andern machen lassen. Die waren schließlich jung und hatten Zeit. Sie dagegen war eine Frau von einunddreißig mit Vollzeitjob, Hypothek und Kind – also Verantwortungen, die sie ernst zu nehmen hatte.
Noch zögerlicher ging sie vorwärts. Musste sie das da denn unbedingt machen? Sie hatte so schon zu wenig Zeit für sich und das Kind. Und hier hetzte sie zu ihrem Zweitjob als ehrenamtliche Vorsitzende der Shanghaier Vegetarischen Catering-Kooperative. Der Verein betrieb ein kleines Bistro mit Heimservice in der Hankou-Lu unweit einer der Hauptdurchgangsstraßen, die den Verkehr in Richtung Bund pumpten.
Lu Linyao war geschieden und hatte eine achtjährige Tochter, die sie abgöttisch liebte und die ihrerseits ihre Mutter hasste oder sich zumindest so aufführte. In Linyaos Bekanntenkreis wunderte das keinen. Von Geburt an hatte die Kleine maßlose Ansprüche gestellt. (Die zumeist kinderlosen Bekannten ahnten natürlich nicht, dass jedes Kind von Geburt an maßlose Ansprüche stellt.) Im Übrigen taugte Linyao nicht im Mindesten für die Mutterrolle, was ihr und ihren Freunden längst klar war, ehe sie dann doch ihr Baby bekam. Ihr ging jenes Talent für innige Beziehungen zu Kleinkindern ab, das andere Frauen anscheinend schon als Teenies oder Twens entwickelten.
Die Folge war, dass Linyaos Tochter Jialin, von ihrem Vater und Linyaos englischsprachigen Freunden Julie gerufen, fast pausenlos aus dem einen oder andern Anlass auf ihre Mutter böse war. Als ärgste Sünde kreidete sie ihr an, dass sie sich hatte scheiden lassen. In ihrer englisch-chinesischen Privatschule in Shanghais Norden lebte Jialin unter reichen Kindern. Es war nur zu verständlich, dass sie nicht einsah, wieso sie ohne Vater und extravaganten Wohlstand auskommen sollte, wo doch die meisten ihrer Mitschüler beides hatten und offenbar ein märchenhaftes Leben führten mit zusätzlichen Ballettstunden, Chauffeur, elektronischen Spielen und ihrem Alter nicht angemessenen Videos.
Linyao ging noch langsamer. Ihre Beine wollten sich nur noch in Zeitlupe bewegen. Zuletzt blieb sie stehen wie eine im Bahnhof angekommene Dampflok. Wäre es nicht besser, die Sache aufzugeben? Sollte sie nicht zurücktreten? Dann winkte doch die Aussicht, ein paar Pluspunkte bei ihrer verstockten, zornigen Tochter einzuheimsen. Heute hatte sie ihren Posten als beamtete Tierärztin etwas früher verlassen können, und jetzt vergeudete sie ihre so knappe Freizeit an ein Ehrenamt! Zwar hatte sie den Vorsitz der Catering-Kooperative übernommen, konnte die praktischen Aufgaben aber ohne Weiteres ihren freiwilligen Helfern Joyce und Philip übertragen. Das ließ sich mit einem kurzen Handyanruf arrangieren.
Ja, sie würde umkehren. Sollten die beiden doch die für heute anstehenden Bestellungen übernehmen. Die zusätzliche Verantwortung würde ihnen nur guttun. Sie selbst könnte stattdessen zu Jialins Schule fahren, das heißt zum nachmittäglichen Tutorenklub, und sie an der Pforte abholen. Zwar hatte Jialin bei früheren derartigen Anlässen nie ein Wort verloren, aber Linyao wusste genau, dass das Mädchen die unverhoffte Zuwendung sehr wohl registrierte.
Eben wollte sie auf dem Absatz kehrtmachen, als ihr schlagartig der Lieferauftrag für heute Abend einfiel – ein kostspieliges veganes Essen für elf wichtige Personen, die sich vorübergehend in Shanghai aufhielten. Keine alltägliche Bestellung! Die medienbekannten internationalen Aktivisten für Tierrechte nannten sich »Kinder Vegas«, und unter hiesigen Vegetariern war ihr Besuch das meistdiskutierte Ereignis der letzten Jahre. Wie es hieß, achtete der charismatische Führer der Gruppe penibel auf korrekte Ernährung. Weh dem, der ihm eine falsch konzipierte Mahlzeit oder gar Gerichte mit ideologisch unzulässigen Zutaten vorsetzte! Der Gedanke beunruhigte sie. Es war vielleicht doch zu riskant, diesen Auftrag den jungen Leuten zu überlassen.
Grübeleien in einer Zwickmühle gleichen einem Cha-Cha-Cha: zwei Schritte vor, ein Schritt zurück; Pause; umdrehen – zwei Schritte zurück, einer vor; Pause; umdrehen. Im Kopf führte Linyao ähnlich komplexe Bewegungen aus. Fast hätten sogar ihre Füße mitgemacht, während sie hin und her schwankte. Dann entschied sie sich.

![Der Fengshui-Detektiv [Band 1] - Nury Vittachi - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/555d578d5aa2aab93612f2926c252c24/w200_u90.jpg)

![Der Fengshui-Detektiv [Band 2] - Nury Vittachi - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b527da15b92ce0c59cb78271be98d5b8/w200_u90.jpg)