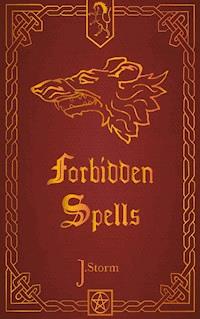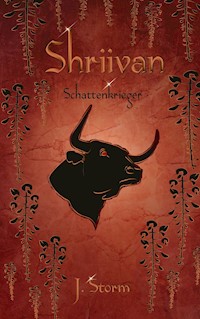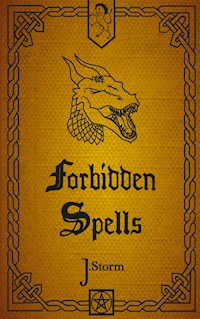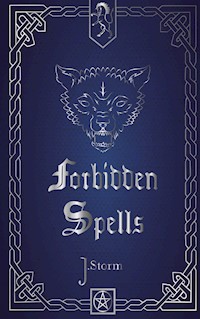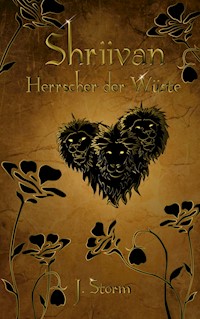
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Shriivan
- Sprache: Deutsch
Sieben Länder, sieben Herrscher und zwei Völker existieren auf dem Kontinent Shriivan. Über alles herrscht der Herr der sieben Insignien, der einst durch die Macht der sieben Drachen auf seinen Thron gebracht wurde. Doch der damals geschlossene Frieden rückt weiter und weiter in die Ferne, als die Menschen erneut beginnen die Rorejk zu jagen, versklaven und abzuschlachten. In diesem ersten Teil einer achtteiligen Reihe, fliehen Tami, Loran und Oraion (die dem Volk der Rorjek angehören) vor einem brutalen Clan-anführer um endlich frei zu sein. Als sie sich den Menschen annähern, fangen sie langsam an zu begreifen, in was für einer gefährlichen Welt sie tatsächlich leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Norikay
Tami
Loran
Oraion
Tami
Oraion
Norikay
Loran
Tami
Loran
Oraion
Loran
Tami
Loran
Oraion
Loran
Norikay
Tami
Norikay
Oraion
Loran
Tami
Oraion
Loran
Rachon
Prolog
So viel Verzweiflung. So viel Wut und Hass. In unserer Welt, die wir erschufen. Ein Paradies, das wir für sie alle erbauten. Und doch konnten sie es nicht schätzen. Sich nicht darin einfinden und in Friede und Einklang miteinander leben.
Was haben wir nur falsch gemacht? Was vergaßen wir, als wir sie erschufen? Liebe? Mitgefühl? Hilfsbereitschaft? All dies gaben wir ihnen doch zu Genüge mit auf den Weg. Vielleicht wäre es klüger gewesen, andere Gefühle nicht zu vergeben. Machthunger, Gier, Hass, Trauer und Wut. Was hatten wir uns nur dabei gedacht? Glaubten wir ernsthaft, die Menschen könnten damit umgehen? Oder übergaben wir ihnen zu viel dieser Begierden und zu wenig von den anderen Gefühlen? Vielleicht entwickelte es sich auch aus der Umgebung, in der sie lebten. Auch wenn diese nicht schlecht sein konnte, denn auch diese erschufen wir.
Noch vage erinnerte ich mich an die Anfänge, als wir die ersten Menschen zu den Tieren auf die Welt setzten. Wie sie sich, wie hilflose Kinder, versuchten, zurechtzufinden. Ebenbilder von uns, lediglich unsere schöpfende Macht pflanzten wir nicht in sie ein. Sie waren so gut. Liebevoll und fürsorglich. Jagten nur, was sie zum Überleben brauchten. Horteten nichts, was sie nicht wieder mit sich tragen konnten. Bis sie lernten, sesshaft zu werden. Tiere nicht zu jagen, sondern zu zähmen und zu halten. Sie wurden bequem, bauten Häuser und zogen aus den Höhlen aus, in denen sie früher lebten.
Dies war der Beginn ihres Missverständnisses gegenüber unserer Welt. Sie begannen mehr zu besitzen, als sie brauchten und mit diesen Besitztümern wurden sie misstrauisch und habgierig. Männer befehligten Männer, die sie und ihre Schätze beschützen sollten. Hierarchien wurden geboren und skrupellos ausgenutzt.
Während sich die Menschen mehr und mehr in dieses besitzergreifende Volk verwandelte, blieben die Tiere jedoch, wie wir sie in die Welt brachten. Einfach und glücklich, selbst wenn sie sich mehr und mehr vor den Menschen fürchten mussten.
Wir glaubten, wenn wir eine Brücke zwischen Mensch und Tier erschaffen würden, könnten die habgierigen Zweibeiner wieder lernen, glücklich zu werden… Leider übersahen wir dabei die bereits weit fortgeschrittene Dunkelheit in ihren Herzen.
Das jüngste Volk, welches wir in die Welt brachten, die von uns Göttern Geküssten, waren den Menschen ein Dorn im Auge. Mit der Macht, sich in ein Tier zu verwandeln, wurden diese stärker als sie. Unberechenbar und einschüchternd. Zumindest in den Augen der Menschen. Von Neid und Furcht getrieben wurden die Rorjek gejagt und zu tausenden getötet. Bis sich Rokkon, das Blut im Abendrot, erhob und mit seinem Feuer die Menschen in ihre Schranken wies. Mit eiserner Hand regierte er sie, mit seinen Ordas und Sehras. Tötete Tausende von ihnen und folterte unzählige.
Wir konnten nur mit Fassungslosigkeit zusehen. Was hatten wir nur getan? Die Welt drohte zu zerfallen unter den beiden sich bekämpfenden Völkern. Doch als wir bereits all unsere Hoffnung aufgaben, besann sich das Blut im Abendrot, getrieben von der süßesten aller Verführungen. Der Liebe.
Ein Mädchen, schwach und scheu, das ausgerechnet dem ihm verhassten Volk entsprang, eroberte sein Herz und bekehrte ihn, seine Wut fallen zu lassen und die Völker zu vereinen.
Rokkon erschuf ihretwegen die sieben Insignien der Macht, und mit ihnen ein mit Drachenblut geschriebener Vertrag, welcher besiegelte, dass fortan kein Krieg mehr unter den Völkern herrschen sollte. Die sieben Reiche sollten bis in alle Ewigkeit an diese geschriebenen Worte gebunden sein … Doch die Arken vergingen. Und mit jedem von ihnen verlor der Vertrag mehr und mehr an Macht.
Die Menschen erhoben sich erneut. Versklavten die Rorjek, machten sie zu ihren Assassinen. Kaiser und Könige predigten von den dunklen Seelen, welche in diesen Mischwesen hausen sollten. Kreuzungen wurden sie verächtlich in den Tempeln genannt. Missgeburten und Dämonen. Das Volk der Menschen fürchtete sie. Die Könige und Kaiser jagten sie und vertrieben sie in die hintersten Ecken und Enden ihrer Reiche. Abermals mussten wir zusehen, wie sich unsere Kinder bekämpften und dabei so viel mehr zerstörten, als ihnen bewusst war.
Deshalb mussten wir handeln. Versuchen, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Rokkon schaffte es vor beinahe dreitausend Arken, die Völker zu vereinen. Das Blut im Abendrot. Die Drachen. Geboren um zu herrschen. Sie sollten erneut schaffen, was einer ihrer Vorgänger erreichte.
Wir glaubten, wenn wir sie in der Nähe der Menschen aufwachsen ließen, würden sie diese besser verstehen. Ihr Denken und Handeln akzeptieren und eine friedlichere Lösung finden, als es Rokkon vor all den Arken tat.
Dass diese Entscheidung in einem solchen Chaos enden würde, konnten selbst wir Götter nicht erahnen.
Norikay
5. Epoche, Ark 229
Der schwarz-orangefarben Seidenschmetterling flatterte aufgeregt zwischen ihren kleinen Händen, im hoffnungslosen Versuch zu entfliehen. Angenehm kitzelten seine feinen Flügel auf ihrer Haut und entlockten ihr ein helles Lachen. Mit ihren kurzen Beinen rannte sie durch den Garten der Kaiserin. Sie wollte ihren Jagderfolg ihrem Alba präsentieren, dem zukünftigen Herrscher über das Wüstenreich Torshan.
Sicherlich würde ihn dieser Fang stolz machen, denn auch er war ein erfolgreicher Jäger. Regelmäßig ritt er mit seiner Gefolgschaft in die Wüste hinaus auf die Jagd. Und meistens kehrte er erfolgreich mit einer erlegten Gazelle oder hin und wieder mit Zebras oder einem Wasserbüffel zurück, woraufhin meist ein Fest gefeiert und das Tier als Mahl serviert wurde.
Der Schmetterling würde nicht als Mahlzeit reichen, trotzdem erfüllte es das kleine Mädchen mit Stolz, dass sie ihn ganz ohne Hilfe einfangen konnte. Sie hastete den Kiesweg entlang, schlüpfte durch den offenen Eingang hinein in den kühlen Schatten des Palastes. Der Wind zog durch den Gang und erfasste ihr langes goldbraunes Haar und das helle Sommerkleid, das um ihre Beine spielte. Die schnellen Schritte hallten an den verputzten Wänden wider und begleiteten sie durch den Sitz der Herrscherfamilie. In diesem Bereich, ihre Maa nannte ihn den inneren Kern, gab es kaum Menschen. Lediglich die Bediensteten und Wachen kreuzten hier und dort ihren Weg. Aber Edelleuten war es nicht erlaubt, in diese Bereiche zu kommen. Sie waren allein für den Kaiser und seine Familie gedacht. Für sie. Kurz hielt das Kind inne, nach wie vor die Hände zu einer hohlen Kugel geformt, in welcher der Schmetterling verzweifelt flatterte. Aus einer hohen Bogenarkade hinaus konnte sie auf die höchsten Türme des Palastes sehen. Dort oben lebte ihr Ur‘alba. Ein strenger, strikter Mann, der das Zepter über das Reich in seinem eisernen Griff hielt. Sie kannte ihn kaum; war, wenn sie ihn sah, höflich und still, wie sie es gelehrt bekam. Denn im Angesicht von Herrschern war es Kindern nicht erlaubt zu sprechen.
Eines Tages würde es ihren Kindern und Enkelkindern auch nicht erlaubt sein, in ihrer Anwesenheit Unfug anzustellen. Nicht in offiziellen Räumen. Nur in den privaten Gemächern der Familie wurden die Regeln gelockert. Ein zartes Lächeln umspielte ihre Lippen. Wenn sie erst einmal Kaiserin sein würde …
Ihre Gedanken schweiften ab. Sie stellte sich dies alles so aufregend vor. Alle mussten einem Kaiser Respekt zollen. Jeder sprach ihn mit Mi Raniar an. Man war den Göttern so nahe wie kein anderer Mensch. Außer einem einzigen. Dem Herren der sieben Insignien. Doch was dies genau für ein Mann war, vergaß sie schon wieder. Ihr Professor würde sie dafür ausschimpfen, doch wie sollte sie sich nur all die Namen und Ränge merken? Sie waren viel zu unwichtig. Schmetterlinge waren spannend. Flatterten wie Herbstblätter durch den Garten der Kaiserin, landeten wie Federn auf Blumen und nippten deren Saft.
Sie hob ihre Hände an ihr Auge und blickte zwischen ihren Fingern hindurch. Der Schmetterling in seinem Gefängnis saß auf ihrer Handinnenfläche, die Flügel ruhig. Offensichtlich war er erschöpft. Erneut hüpfte das Kind los, bog durch die Gänge ab und fand sich schließlich vor den privaten Gemächern ihrer Eltern wieder, vor deren Tür mehrere Wachen standen.
»Prinzessin«, grüßte ein besonders großer Mann und machte sich die Mühe, vor ihr niederzuknien. Seine Rüstung schepperte dabei. »Falls ihr zu Eurem Alba gehen möchtet, er ist im Moment beschäftigt. Geht doch hinüber zu den Gemächern eurer Maa. Sie wird sich sicher über Euren Besuch freuen.« Das Mädchen seufzte und sah in die wässrigen Augen des Mannes. Das Lachen von zuvor verschwand aus ihrem Gesicht und sie senkte den Blick.
»Bei meiner Maa war ich schon«, protestierte sie und spürte, wie der Schmetterling erneut zu Flattern begann. »Sie liegt im Bett und kann nicht mit mir nach draußen kommen. Ihr Bauch ist ihr im Weg. Zu schwer, sagt sie. Wegen meines kleinen Ordas, der darin liegt.« Ihre Maa war schwanger mit dem vierten Kind. Bald würde es auf die Welt kommen. Ihr kleiner Orda. Woher ihre Maa wusste, dass es ein Junge sein würde, konnte sich das Mädchen nicht vorstellen. Vielleicht spürte man dies, wenn das Baby in einem wuchs.
Gemischte Gefühle durchfuhren sie, wenn sie an die Möglichkeit dachte, dass es tatsächlich ein Junge sein würde. Wenn dem so wäre, würde sie niemals Kaiserin sein. Sie würde niemals als Mi Rani angesprochen werden. Dieser Titel gehörte nur den Thronerben. Und im Moment war sie die Erbin. Das Älteste von drei Mädchen. Dass ein Junge ihr diesen Titel nehmen konnte, wusste sie. Als der Professor ihr dies lehrte, passte sie auf.
Der Wachmann vor ihr lächelte sanft und deutete dann auf ihre Hand.
»Was habt Ihr dabei?« Sorgfältig streckte sie ihm die Hände entgegen und öffnete sie leicht, damit er sehen konnte, was sie gefangen hatte. Diesen kurzen Augenblick nutzte der Schmetterling und entfloh seinem Käfig, flatterte hoch an die Decke des Ganges, wo er für sie außer Reichweite war.
»Komm zurück! Ich wollte dich doch meinem Alba zeigen. Er soll wissen, dass ich eine gute Jägerin bin.« Der Wachmann lachte amüsiert auf.
»Meine Prinzessin. Wir wissen doch alle, was für eine erfolgreiche Jägerin Ihr seid. Ihr brachtet schon Katzen, Heuschrecken und Sommerflügler«, beteuerte der Mann. Die Prinzessin sah auf ihre Hände und nickte dann leicht.
»Aber mein Alba meint, ich müsse besser werden«, erwiderte sie. Die freundlich funkelnden Augen des Wachmanns wurden ernst, und kleine Fältchen bildeten sich an seinen Mundwinkeln, als er diese nachdenklich verzog. Es wirkte, als wolle er etwas erwidern, doch sie wurden von der sich öffnenden Tür hinter ihnen unterbrochen. Eine Frau trat aus dem Raum. Zerzauste, feuerrote Haare umgaben ihr karamellfarbenes Gesicht. Bernsteinbraune Augen sahen sich um und hafteten einen Augenblick auf dem knienden Wachmann und dem Mädchen, bevor sie eilig an ihnen vorbei ging und den Gang hinunter verschwand. Sie war nur leicht bekleidet, mit einem hellen Seidenstoff, unter dem man die dunkle Haut hindurch schimmern sah.
Kurz sah die kleine Prinzessin den Wachmann an und ging dann an ihm vorbei, hinein in das Gemach.
»Jetzt ist mein Alba nicht mehr beschäftigt«, erwiderte sie ihm im Vorbeigehen. Mit halb geöffnetem Mund, bereits eine Antwort auf den Lippen, sah er ihr entgeistert hinterher. Das Gemach ihrer Eltern war hoch, mit hellen Wänden und einer offenen Fensterfront, die mit purpurroten Vorhängen geschlossen werden konnte. Der Boden war mit hellbraunen Läufern ausgelegt, um nicht auf dem kalten Stein gehen zu müssen. Bequeme Liegen füllten einen Teil des Raumes, ein großes Bett den Rest. Und als die kleine Prinzessin nun eintrat, saß ihr Alba auf diesem und schnürte sich die dunklen Lederhosen zu. Die Laken waren aufgewühlt, die restlichen Kleider des Mannes auf dem Boden verteilt.
»Igesa, du hast deine Pflicht erfüllt. Geh jetzt endlich«, fauchte der schwarzhaarige Mann auf dem Bett, sah auf und entdeckte seine Tochter im Raum stehen. »Ach du bist es«, stellte er trocken fest, erhob sich vom Bett und ging auf sein Hemd zu, das zwei Schritte entfernt lag. Neugierig verfolgte Norikay ihren Alba mit ihrem Blick. Dass er so unordentlich war, überraschte sie. Es zeigte ihr allerdings auch, dass es offensichtlich ihre Maa sein musste, welche hier normalerweise für Ordnung sorgte. Denn ihre Eltern schrieben ihr stets vor, ihr Zimmer sauber zu halten. Diese Regel kam dann wohl nicht von ihm.
»Was willst du? Ich habe keine Zeit für dich«, entgegnete er barsch, nachdem er auch seine Stiefel zusammengesucht hatte. Die schwarzen Augen durchbohrten sie.
»Ich wollte Euch einen Schmetterling zeigen. Er war wunderschön. Ich hab ihn gefangen, aber er ist mir vor der Tür entwischt«, erklärte sie sich und sah ihren Alba erwartungsvoll an. Dieser zog sein dunkles Wams über den Oberkörper und zuckte mit den Schultern, während er auch dieses zu verschnüren begann.
»Was soll ich mit einem Schmetterling?« Seine trockene Antwort traf das kleine Mädchen. Unschlüssig sah es vor die Füße ihres Albas auf den Boden.
»Schmetterlinge sind schön. Und schwierig zu fangen«, entgegnete sie ihm und schluckte. Und als er darauf nichts antwortete, machte sie einen Schritt auf ihn zu und fuhr fort: »Ich wollte Euch zeigen, was für eine gute Jägerin ich bin. Ich will, dass Ihr stolz auf mich sein könnt.« Ihr Alba hielt in seiner Bewegung inne und sah zu ihr hinüber. Studierte sie einen Moment mit diesen dunklen durchdringenden Augen.
»Du kannst mich nicht stolz machen. Du bist ein Mädchen. Und wenn deine nichtsnutzige Maa mir nicht endlich einen Erben schenkt, bin ich vielleicht sogar versucht, euch alle auf die Straße zu stellen. Die Huren, die mein Bett teilen, gebären mir einen Bastard nach dem andern. Nur deine Maa glaubt, mit Töchtern könnte ich glücklich werden«, schleuderte er ihr an den Kopf, drehte sich von ihr ab und ergriff den leichten, goldgelben Umhang mit dem dreiköpfigen Schawar aufgenäht. Die drei goldenen Augenpaare blickten sie höhnisch an. Als wollten sie ihr bestätigen, dass sie niemals gut genug sein würde, um sie jemals tragen zu dürfen. Das Mädchen zitterte, trotz der stickigen Sommerhitze, welche das Land in ihren Klauen hielt.
»Aber ich kann so gut sein wie ein Junge. Medred schaffte es noch nie, einen Sommerflügler zu fangen. Oder eine Maus …« »Medred ist auch der fette Sohn einer Küchengehilfin und kein Prinz!«, donnerte ihr Alba laut entgegen, woraufhin sie zusammenzuckte. Tränen füllten ihre Augen.
»Ich will doch nur, dass Ihr mit mir zufrieden seid«, jammerte das Mädchen und Tränen perlten über ihre Wangen.
»Dann hör auf zu flennen. Ein Prinz würde niemals seine Tränen zeigen. Aber auch das zeigt nur, wie schwach und weiblich du bist. Lass dir einen Schwanz wachsen, dann würdest du mich tatsächlich überraschen und zufriedenstellen.« Mit diesen Worten rauschte er an ihr vorbei auf die Tür zu. Das Tor wurde aufgerissen und er verschwand. Norikay stand inmitten des Saals und sah mit verweinten Augen auf das Bett vor sich. Sie war allein. Ihre Maa konnte sich nicht um sie kümmern. Die Kinderfrau betreute ihre beiden Sehras, die noch kaum gehen konnten. Und ihr Alba war wütend auf sie, weil sie ein Mädchen war. Vielleicht würde seine Wut abflauen, wenn ihre Maa tatsächlich einen Orda gebar. Und wenn nicht? Sie musste sich etwas einfallen lassen, wie sie ihren Alba glücklich machen konnte.
Tami
5. Epoche, Ark 231
Schweigend saß das kleine Mädchen am großen Feuer und lauschte den Geschichten der Krieger, die am frühen Nachmittag von der Jagd zurückkehrten. Voller Begeisterung hing das Kind an den Lippen der starken Männer, die mit Brüllen, Lachen und ausladenden Gesten erzählten, wie sie die wilde Zebraherde einkesselten und drei Tiere einfingen.
Harish prahlte mit seiner Geschwindigkeit, schneller als alle Zebras sei er gerannt, war zwischen die Herde gesprungen und habe die Tiere panisch auseinandergetrieben. Parson lachte den blonden schlanken Mann jedoch nur aus und meinte, nachdem er sich erholte: »Ohne mein rechtzeitiges Eingreifen wären dir alle Zebras davon gerannt, weil du dich nicht entscheiden konntest, auf welches du dich stürzen solltest.« Die Männer lachten auf und auch das kleine Mädchen Tami kringelte sich vor Lachen, obwohl sie nicht genau verstand, weshalb. Diese Abende liebte sie. Die Luft war schwer vom Rauch des Feuers und des darauf bratenden Fleisches. Die Wärme des Feuers brannte auf ihrem Gesicht, während sie auf ihrem Rücken die frische Nacht fühlte. Ein sanftes Kribbeln, das sie erfasste, sobald die Dunkelheit die Welt überzog. Gefahren mochten da draußen lauern, doch das Feuer spendete Sicherheit. Irgendwann, so hoffte das kleine Ding, würde auch sie diesen Gefahren draußen trotzen. Abenteuer erleben und Zebras jagen, so wie die Männer um das Feuer, zu denen auch ihr Alba zählte.
Dieser saß schweigend am Feuer, unbeeindruckt vom Lachen seiner Jagdgesellen. Überhaupt wirkte er finster und furchteinflößend, kaum amüsiert. Sein gefährlicher goldener Blick traf die beiden vorlauten Männer, welche sofort verstummten und ein wenig in sich zusammensackten.
»Wir sind aufeinander angewiesen. Parson allein hätte keines der Zebras eingefangen, sowenig wie Harish es allein geschafft hätte, oder all die anderen«, raunte Kaar mit leiser, drohender Stimme, die so manchem einen Schauer über den Rücken jagte.
Mit Kaar legte sich niemand an. Er wurde respektiert und geachtet und wenn er sprach, verstummten die Leute. Tami sah zu ihrem Alba hinüber. Ein furchteinflößender Mann, der weder zu seinen Kindern, Tami und ihrem Orda Rachon, freundlich war, noch zu seiner Frau oder sonst jemandem. Gefürchtet und zugleich geachtet wurde der Mann, denn er war der beste Krieger des Stammes. Seine Position hatte er hart erkämpft. Er war einer der Wildesten, wie seine Narben erzählten, die seinen Körper zierten und die er mit Stolz trug.
»Nicht alle brauchen einander. Du hast auch schon eines dieser wilden Zebras allein gefangen. Wir versuchen doch nur, so gut zu werden, wie du es bist«, heuchelte Harish und senkte demütig den Kopf. Jung und unerfahren war er und sah umso mehr zu Tamis Alba auf, als ein Idol, dem er nachstreben konnte. Kaar schnaubte leise und sah gelangweilt zu dem Blondschopf hinüber, bevor er einen Bissen der Fleischkeule in seiner Hand abriss. Diese Bewegung wirkte wild und roh. Züge, die sein Seelentier auf sein menschliches Ich projizierte.
»Du wirst es niemals schaffen, meine Stärke zu erlangen, kleiner Kater. Schon vergessen, dass der Löwe Gott der rohen Gewalt ist«, entgegnete Kaar abfällig und nahm einen weiteren Bissen der Fleischkeule, die er sich ergatterte. Gebraten auf dem Feuer, vor dem sie nun alle saßen. Die Krieger, die auf der Jagd gewesen waren, erhielten beim Mahl stets Vorrang. Sie durften sich sattessen und danach waren die Frauen, Kinder und Alten dran.
Tami bewunderte die Krieger genauso wie jedes andere Kind. Und sie wünschte sich nichts mehr, als eines Tages ebenfalls zu den Jägern zu gehören. Ein Wunsch, der wohl kaum jemals in Erfüllung gehen würde, waren die Frauen doch zur Jagd nicht zugelassen. Weshalb, verstand das kleine Mädchen nicht.
Als die Zeit fortgeschritten war, und sie sich alle satt aßen, nahm Tamis Maa sie bei der Hand und führte sie zu den Höhlen, in denen der Kriegerstamm lebte.
»Maa! Ich will noch nicht. Ich will weiter zuhören!«, flehte das kleine Mädchen, doch die stämmige Frau war unerbittlich.
»Kind, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Morgen wird die weise Göttin wieder den Himmel besteigen und mit ihr werden neue Geschichten erzählt, denen du lauschen kannst.« Tami rollte beleidigt mit den Augen.
»Rachon muss auch nicht schlafen gehen«, versuchte sie es auf anderem Weg, jedoch prallte sie bei ihrer Maa ab.
»Rachon ist älter als du und ein Junge. Für uns Frauen wird es Zeit, sich zurückzuziehen. Die Nacht gehört den Kriegern. Sie können sich wehren, die Schatten der Nacht bezwingen. Wir sind nicht stark genug dazu.« Tami stampfte erbittert auf den Boden. »Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Das ist ungerecht. Ungerecht. Ungerecht.« Die feine Mädchenstimme hallte durch die Höhle und verzerrte sich seltsam, umso tiefer sie eindrang, bis sie irgendwann verstummte. Ihre Maa seufzte und zerrte sie grob weiter.
»Das Leben ist nicht gerecht. Es ist von den Göttern vorherbestimmt. Wir befolgen ihren Weg, wie sie ihn uns darlegten. Finde dich damit ab. Niemand behauptete jemals, dass ihre Wege gerecht sind.« Verzweifelt sah das kleine Mädchen zurück ans Feuer und wünschte sich nichts mehr, als noch ein wenig länger dort sitzen zu bleiben, jedoch schrieben die Regeln des Stammes vor, dass die Schwachen nichts in der Nacht draußen zu suchen hatten.
»Irgendwann bin ich auch eine Kriegerin. Und dann muss ich nicht mehr in die Tunnel fliehen«, protestierte Tami kleinlaut, was ihre Maa nur verärgert mit einem Schnauben quittierte.
»Du bist ein Mädchen. Niemals wirst du eine Kriegerin. Wir Frauen gebären Kinder, passen auf diese auf, halten die Höhlen sauber und geben sich ganz ihrem Mann und seinen Bedürfnissen hin. Finde dich mit diesem Schicksal ab und du wirst glücklich sein. Oder wehre dich dagegen, aber ich will nie hören, wie schlecht es dir dann geht.« Tami sah ihre Maa von der Seite her an. Wie oft hatte sie diese Worte nun schon gehört? Sie klangen auswendig gelernt und ließen Tami einen Schauer über den Rücken fahren, auch wenn sie nicht alles verstand. Noch nicht.
»Ich werde nicht unglücklich. Ich werde frei sein und jagen gehen«, entgegnete sie stur.
»Nur eine Frau, in der eine magische Kreatur innewohnt, könnte es vielleicht in die Kriegerschaft schaffen. Doch ich fühle bei dir keine solchen Kräfte, also schlag dir diese Träume aus deinem kleinen, sturen Kopf.«
Loran
Einsam rollte der Wagen durch den sandigen Wind der Andraswüste. Verloren gierten die Räder unter der Last, die auf dem Wagen Platz fand. Gezogen von einem treuen Grautier, das brav Tritt für Tritt vorwärtsschritt, hinein in die trostlose Hitze und Gefahr der Wüste. Auf dem Kutschbock vorn saß ein in einfache Tücher gewickelter Mann. Düster sah er in die Welt hinaus, wohlwissend, welch ein Wagnis er mit seiner Reise einging. Doch es nützte nichts. Die Handelsroute von Wolrat an die südliche Küste zu den Sklavenmärkten verlief quer durch diese verdammte Wüste.
Nur ein Schlitz zwischen den Tüchern zeigte seine dunklen, bösen Augen, die misstrauisch den Sandsturm um sich herum beobachtete.
Es war in den letzten Katlanen öfters vorgekommen, dass Handelskarawanen von den Wüstenkriegern angegriffen worden waren. Jedoch, was wollten die Krieger von einem einzelnen, ärmlich wirkenden Mann schon wollen, der die Wüste zu durchqueren versuchte? Dies wollte sich der Mann zumindest immer wieder einzureden.
Als zu dem kontinuierlichen Gieren und dem Rattern der Räder über die staubige Straße noch das leise Klirren von Ketten hinzukam, wurde der Mann aus seinen Gedanken gerissen. Er sah sich auf der Brücke seines Wagens um. Dort, zwischen den Kisten und Fässern, welche Nahrung und Wasser für die Reise beinhalteten, lag der kleine Junge mit dem silbernen Haar, welchen er dessen Eltern abgekauft hatte. Er würde ihm ein Vermögen einbringen, dessen war er sich sicher. Mit breitem Grinsen, das verborgen unter den Tüchern blieb, beobachtete er den Jungen, während dieser wimmernd erwachte.
Die Kettenglieder, die um seine zarten Handgelenke gelegt waren, klirrten erneut leise, als er sich müde die Augen rieb. Rote verquollene Augen, die zeigten, dass er sich in den Schlaf geweint hatte. Wie sein verdammtes silbernes Haar leuchteten auch die Augen hell und silbern, als wäre er ein Geist. Etwas Übernatürliches, Gefährliches. Die Ausgeburt eines Dämons. Ein Gestaltenwandler. Mit finsterem Blick musterte der Mann ihn, woraufhin der Junge sofort weg von ihm wich, näher an eine der Kisten. Eines der berühmten goldenen Kinder. Rorjeks, die aus dem Schoss einer Menschenfrau geboren worden waren. Die Hälfte des Adels aus Wolrat kam zu seinem Reichtum, weil sie genau solche Kinder bekamen und anschließend verkauften. An Männer wie er einer war. Skrupellos und ohne Gewissen. Schon oft in seinem Leben war er mit seinem treuen Maultier nach Sirjen gereist, den Wagen voller Gefangener. Aber er war sich sicher. Noch nie besaß er eine solch wertvolle Fracht wie diese. Der Junge war etwas Besonderes. Er spürte es.
Zufrieden mit sich selbst, drehte sich der Händler wieder nach vorn auf die teils befestigte Straße. Der Wüstensand breitete sich mancherorts über den Pflastersteinen aus und schon vor einigen Arken entschied der Kaiser, die Straße nicht mehr öfter, als alle zwei bis drei Arken reinigen zu lassen, da der Aufwand teuer und ziemlich aussichtslos war.
Das Kind, welches er durchaus teuer erstand, war nicht nur ein Gestaltenwandler, sondern auch noch ein Magischer. Selbst er, der nicht solche Mächte in sich trug, spürte dies. Er würde das Zehnfache für ihn auf den Märkten erhalten, wenn er denn endlich dort war.
Schweigend saß seine Fracht hinten zwischen den Kisten, kaum älter als sieben Arken und studierte seinerseits die Umgebung; sah den Sturm, die Sandkörner um sie herum, fühlte den Wind. Mit seiner Fähigkeit, seiner Seele, die er in sich trug, konnte er jedoch weit mehr wahrnehmen, als der Fremde auf dem Kutschbock. Ein wildes Tier, das brüllend seine Artgenossen rief, war für den Jungen leicht zu hören. Auch ferne Rufe konnte er hören, einordnen konnte er sie jedoch nicht. Dazu mischten sich Hufschläge, die über heißen Wüstensand hinweg donnerten. Sie waren weit weg; außerhalb des Sandsturms, in den der furchteinflößende Mann hinein gefahren war. Das Kind rieb sich die schmerzenden Handgelenke, die unter den Kettengliedern wund geschürft waren.
Verstehen, was passiert war, konnte es nicht. Noch vor wenigen Tagen lebte es mit seinen drei Geschwistern und den Eltern zusammen in einem gemütlichen Sandsteinhaus in Wolrat. Doch dann kamen die Eltern auf ihn zu und erzählten ihm von einem Onkel, erklärten ihm, dass dieser sich viel besser um ihn kümmern konnte als sie, weil er etwas Besonderes war. Verwirrt und verängstig wie er war, übergaben sie ihn dem Fremden, der ihn ans Meer zu besagtem Onkel begleiten sollte.
Nie war er das Lieblingskind der Eltern gewesen. Sie hatten ihn akzeptiert und bei sich leben lassen. Waren nie schlecht mit ihm umgegangen, aber auch nie zuvorkommend. Doch als sie sich abdrehten, ehe der Mann, der nun auf ihn aufpassen sollte, ihn auf den Wagen gehievt hatte, keine Worte des Abschieds über ihre Lippen kamen, hatte der kleine Junge gespürt, dass er immer nur ein Dorn in ihrem Leben gewesen war. Nur weil er anders war als seine Geschwister. Und anders als die Menschen in der Stadt.
Hilflos saß der Junge nun da, zwischen den Kisten und Fässern; verwirrt seinen Gefühlen ausgesetzt, die ihn einmal mehr übermannten. Leise schniefte er, versuchte den Verrat, die Einsamkeit und die Enttäuschung, alles, was in diesem Moment auf ihn einschoss, irgendwie zu verarbeiten.
»Sei still, törichtes Balg!«, schnauzte der Mann, der ihn auf dem Wagen festkettete, kaum waren sie aus den Toren der Stadt hinausgefahren. »Oder willst du, dass die Wilden kommen und dir die Kehle aufschlitzen und deine Eingeweide auf der staubigen Straße verteilen?« Erschrocken sog der Junge die Luft ein und verstummte. Er zog die Beine an und verbarg sein Gesicht zwischen seinen Knien.
Stunden vergingen. Das Holpern des Wagens über die steinige Straße hatte den Jungen bereits wieder schläfrig gemacht, als die Nacht hereinbrach und sich mit ihr der Sturm langsam legte.
Endlich setzte der Händler zu einer Rast an, löste das Maultier von den Riemen und erlaubte ihm, von den kargen Grasbüscheln auf dem Boden zu fressen. Ein Feuer traute er sich nicht zu machen. Zu sehr fürchtete er die Wilden dieser Wüste. Somit gab es für ihn und den Jungen nur eine klägliche Mahlzeit aus Pökelfleisch und saurem Wein. Das Kind verzog das Gesicht, als es einen Schluck des Gesöffs nahm, weswegen der Händler kalt auflachte. Seine gelben, verfaulten Zähne kamen zum Vorschein und führten das Bild des ungepflegten Mannes fort.
»Du würdest gut daran tun, viel von dem Wein zu trinken. Dieser benebelt die Sinne. Wer weiß, vielleicht wird dir das durch all die Strapazen helfen, die noch auf dich zukommen.« Ein anzügliches Grinsen folgte seinem Kommentar, dann riss er mit seinen faulen Zähnen, wie ein wildes Tier, das Fleisch in seinen Händen auseinander. Unsicher folgte der Junge dem Rat des Fremden und trank weitere Schlucke des Weins, auch wenn er wegen des Geschmacks beinahe erbrechen musste. Schnell merkte der Junge die Wirkung, spürte, wie er müde wurde und seine Gedanken lahm und sanft durch seinen Kopf schwebten. Sein feines Gehör, dass er dem Wolf in sich verdankte, schaltete aus und er befand sich plötzlich in einem warmen, angenehm stillen Moment wieder. Über ihm die schwarze Nacht mit den hellen Sternen und neben ihm saß plötzlich der Händler. Er war nahe an ihn herangerückt, zerrte nun an der Kette, die den Jungen nach wie vor fesselte und zog ihn zu sich.
»Komm her du, kleiner Bastard. Wenn ich hier schon den Aufpasser spiele, dann will ich auch Spaß mit dir haben.« Halb gelähmt vom Wein folgte der Junge dem Mann, der ihn neben sich auf den Boden zerrte, mit einer Hand die Kette festhielt und mit der anderen an seiner eigenen Hose herumfummelte.
»Du wirst gleich eine weitere Lektion deines erbarmungslosen, dreckigen Lebens erhalten, Rorjek«, höhnte der Mann. Der Junge schüttelte den Kopf, beduselt und lahm. Versuchte, sich zurückzuziehen, doch der Mann war viel zu stark.
»Willst du wohl stillhalten!«, fauchte er den Jungen an. Der Junge schrie ängstlich auf, als der Händler ihn am Hals packte und mit Leichtigkeit auf den Boden drückte. Schwer wie ein Berg türmte er sich über ihm auf, als die Luft jäh von kriegerischem Geschrei erfüllt wurde. Sofort ließ der Mann von dem silberhaarigen Jungen ab, ging mit halb heruntergelassener Hose zum Wagen und zog dort einen Säbel von der Kutschbrücke herunter.
Fluchend zerrte er die Hose wieder hoch, sein halbharter Schwanz verschwand unter der grob gewobenen Wolle. Mit Angst, die er nicht aus seinen Zügen verbannen konnte, drehte sich der schäbige Mann mit erhobenem Säbel der Dunkelheit zu.
Der Junge stellte sich zitternd auf die Beine und wich ebenfalls zum Wagen zurück, kroch hinauf auf die Brücke, zwischen die Kisten, wo er sich versteckte. Keinen Moment zu früh, als auch schon ein schwarzer Schatten aus der Dunkelheit auf den Mann am Wagen zu jagte.
Groß war das schwarze Tier. Mit einem Gebiss voller scharfer Zähne und gelb glühenden Augen. Ein athletischer, schlanker Körper, mit mächtigen Pranken, die mit ausgefahrenen Krallen nach dem Mann schlugen. Der Mann hob den Säbel und versuchte, mit lautem Gebrüll den Panther zurückzuschlagen, der ihn umkreiste und immer wieder versuchte, anzugreifen. Lauernd zog die große Wildkatze ihre Runde, als ein weiteres Tier den Wagen erreichte. Ein großer sandbrauner Bär trottete gemächlich auf den Panther und den bewaffneten Mann zu. Brüllend kündete er sich an. Wimmernd kauerte der Junge noch etwas tiefer hinter die Kisten und auch der Sklavenhändler konnte seine Angst nicht verbergen.
»Verschwindet, ihr Bestien!«, brüllte der Sklavenhändler mit hoher Stimme die beiden Kreaturen an, als könnten sie ihn verstehen. Ein hämisches Lachen, das die Nacht durchdrang, veranlasste den Mann, erneut in die Dunkelheit zu sehen, bis er dort zwei Männer entdeckte, die mit langen Speeren bewaffnet auf ihn zukamen und zwischen dem Panther und dem Bären zum Stehen kamen. Eindrucksvolle Männer waren sie. Einzig mit einer hellen Wollhose gekleidet, offenbarten sie ihre muskulösen Oberkörper, die dunkelgebrannt von der Wüstensonne waren.
»Du hast unser Reich betreten. Mensch!«, antwortete ihm der eine in gereiztem Ton und richtete seinen Speer auf ihn. Eine harte, zackige Aussprache verriet, zusätzlich zu seinem Aussehen, seine Herkunft aus der Wüste. »Was willst du hier draußen in der erbarmungslosen Wüste? Bist du nach Sirjen unterwegs, um Sklaven zu kaufen? Oder hast du am Ende eigene Sklaven dabei?«, blaffte der andere. Der Händler schwitzte unter seinen Gewändern, sein Säbel zitterte in den Händen. Hatte er doch gehofft, dass die Wilden ihn nicht aufhalten würden.
»Ich habe nichts. Nur meinen Reiseproviant, um an die Küste zu gelangen. Ich wollte dort auf einem Schiff anheuern, um in die freien Staaten über zu segeln.« Die Krieger sahen sich an, doch der Panther knurrte nur wütend und machte einen Schritt auf den Mann zu.
»Jago sagt mir, das du lügst«, entgegnete der eine Krieger neben dem Panther und sah dann über den Wagen hinweg. »Du hast einen Sklaven bei dir. Einen von uns. Er kann ihn riechen«, stellte der eine Krieger fest. Seine dunklen Augen wanderten über die Ladung, konnten den kleinen Jungen jedoch nicht ausfindig machen, der sich zitternd unter einigen Zeltplanen versteckt hielt.
»Ihr irrt euch. Ich bin ein einfacher Reisender«, versuchte sich der Händler, aus der Schlinge zu ziehen, doch mit dieser Aussage machte er die Krieger nur wütender. Der eine kam auf ihn zu und schlug ihm mit einer schnellen, fließenden Bewegung den Säbel aus der Hand.
»Nenn uns nicht Lügner, wenn du es doch bist, der uns anlügt.« Der Bär trottete nun um den Wagen herum, begann schnüffelnd die Brücke zu inspizieren und zerrte zielsicher die Zeltplane beiseite. Überrascht japste der Junge auf und wich von Furcht gepackt vor dem Monster zurück, das ihn entdeckte. Doch der Bär legte nur den Kopf schräg und ein seltsam fürsorglicher Ausdruck breitete sich auf dessen Zügen aus.
»Kalin, was hast du gefunden?« Beim Klang ihres Namens hob die Bärin den Kopf und ehe sich der Junge versah, verwandelte sich die Bärengestalt vor seinen Augen in eine dunkelgebrannte Frau, die ihn aus sanften braunen Augen musterte. Ein strenges, jedoch schönes Gesicht, das von der Unbarmherzigkeit der Wüste erzählte.
»Ein Junge. Er ist total verängstigt. Das arme kleine Ding«, informierte sie die beiden Krieger und den Panther, die vorn bei dem Händler geblieben waren.
»Ein einfacher Reisender?«, schimpfte einer der Krieger. Der Händler schrumpfte unter dessen zornigen Blick mehr und mehr in sich zusammen.
»Jago. Abendessen.«
Dies brauchte er dem Panther kein zweites Mal zu sagen, mit einem mächtigen Satz sprang er vor, packte den Händler mit seinem starken Kiefer und bohrte seine Zähne in dessen Fleisch. Panisch schrie der Mann auf, schlug mit letzter Willenskraft gegen die Pranken, die ihn zu Boden drückten, ehe der Panther mit gezieltem Biss die Kehle herausriss und der Mann verstummte.
»Sieh nicht hin, Kind«, beschwichtigte die Frau namens Kalin den Jungen, der seinen silbernen Blick wieder nach vorn richten wollte. »Sieh mich an. Zeig mir deine Hände, ich werde dich von diesen schrecklichen Ketten befreien.« Ihre Stimme war liebevoll und von einem fremden Akzent, den der Junge noch nie zuvor in Wolrat hörte. Noch immer bedröppelt von der Wirkung des Weins sah er die Frau an, die nun eine Hand nach ihm ausstreckte.
»Komm her. Dir wird nichts geschehen. Vertraue mir.«
Langsam und mit zitterndem Körper kroch er aus seiner Nische hervor auf die Frau zu, die ihn ermunternd anlächelte.
»So ist es gut. Komm her. Wie ist dein Name, Junge?«, fragte sie weiter, als er vor ihr anhielt und sie sanft die Kette in Augenschein nahm, die seine Hände fesselte. Nun traten auch die beiden Krieger nach hinten zu der Frau. Beide wirkten streng, jedoch leuchteten ihre Augen freundlich. Eingeschüchtert zuckte der Junge mit den Schultern auf ihre Frage hin. Als die Frau die Ketten gelöst hatte, streckte sie die Arme aus und hob den Jungen vom Wagen an ihre Schulter. »Keine Sorge, mein kleiner Schatz. Wir werden dich an einen sicheren Ort bringen und dann kannst du uns erzählen, was passiert ist.«
Oraion
5. Epoche, Ark 232
Die Nacht brach herein und überzog die hell leuchtende Wüste mit ihrer beruhigenden Dunkelheit. In den Höhlen des Xero–Stamms war Ruhe eingekehrt. Hier und dort konnte man das Schnarchen der Krieger hören, aber ansonsten war es still.
Beinahe.
Zwischen den regelmäßigen Geräuschen der Nacht glaubte Oraion, etwas anderes zu vernehmen. Es hörte sich an wie leise Schritte, die sich über den sandig, felsigen Boden der Höhle bewegten. Überrascht hob der braunhaarige Junge seinen Kopf und horchte angestrengter in die Nacht hinaus. Wer das wohl war?
Kurz sah er sich um, zu seinen beiden Eltern, die im hinteren Teil der Nische eng umschlungen auf dem steinernen Bett lagen. Sie würden nicht bemerken, wenn er sich davonstahl. Und da er in dieser Nacht der vollen Monde nicht wirklich schlafen konnte, erhob er sich und schlüpfte aus der Nebenhöhle hinaus in die Haupthöhle. Neugierig reckte er seinen Kopf um die Felswand herum und sah auf den Ausgang der Höhle. Konnte dort einen Ausschnitt des Himmels erkennen und die glitzernden Sterne, die sich in voller Pracht zeigten. Es waren leuchtende Herzen, die aus dem Schattenreich in diese Welt hinein schienen, um ihnen allen den Weg in der Dunkelheit zu zeigen. Dies erzählte ihm zumindest seine Maa immer, wenn er nicht schlafen konnte.
Leise huschte er durch die Höhle, auf die andere Seite und schlich dann entlang der Wand weiter auf den Ausgang zu. Er liebte solche Spiele. Etwas Verbotenes zu tun reizte ihn. Erfreut, dass ihn niemand hörte, huschte er zum Eingang und sah um die Wand herum auf die Plattform vor der Höhle und den Abstieg, der hinunter an den Fluss führte. Dort sah er gerade noch einen dunklen Haarschopf verschwinden. Überrascht hob er kurz seine Augenbrauen und schritt langsam über die Plattform an den Rand.
Der Weg hinunter hielt sich eng an der steilen Sandsteinwand des namenlosen Berges, in dem ihre Höhle lag. Er schlängelte sich am Felsen entlang und verschwand so immer wieder aus dem Blickfeld von der Plattform aus. Doch Oraion brauchte nur geduldig zu sein. Und schon bald tauchte weiter unten um eine Biegung die Nachtwandlerin wieder auf.
Sofort erkannte Oraion das Mädchen. Die Tochter des großen Kaar. Wie sehr er dieses Mädchen bewunderte. Sie gehörte zu der angesehensten Familie. Wurde geachtet, geliebt und verehrt und dies, weil ihr Alba der beste Krieger des Stammes war. Sicherlich würde sie irgendwann einen liebevollen Ehemann bekommen, denn jeder würde um ihre Hand anhalten, selbst wenn sie in Oraions Augen kein außergewöhnliches Ding war. Nun, sie war auch gute vier Arken jünger als er und somit noch ein kleines Kind.
Nachdenklich schüttelte Oraion seinen Kopf. Wo waren seine Gedanken nur? In sich spürte er die leise Eifersucht, die er auf das Mädchen hatte.
Er wurde nicht beachtet. Schließlich war er der Sohn eines Krüppels. Eines Mannes, dessen Kampfspuren ihn unbrauchbar für die Jagd machten.
Sein Alba war vor knapp drei Arken auf der Jagd unvorsichtig gewesen und unter die Hufe der panischen Wasserbüffel geraten. Viele Frakturen hatte er erlitten. Einige waren gut verheilt. Doch andere waren geblieben. So waren die Knochen in seinem rechten Fuß nie mehr richtig zusammengewachsen, weswegen er nicht einmal mehr in der Lage war, sich in sein Seelentier zu verwandeln. Wenn er es trotzdem tat, stand der untere Teil des Beines der Hyäne so unnatürlich ab, dass Oraion damals, als sein Alba es versuchte, kaum seinen Brechreiz hatte in Zaum halten können.