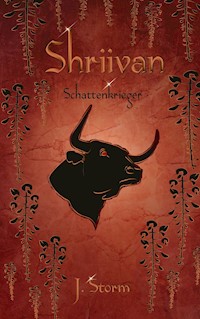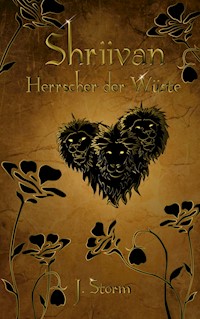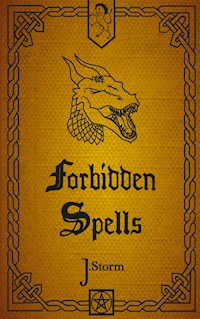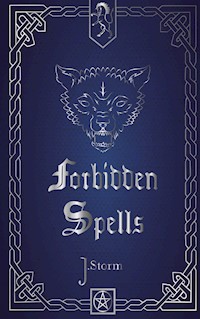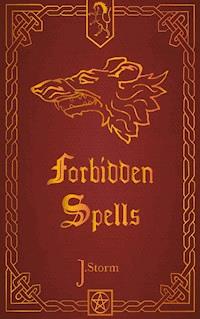
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Forbidden Spells
- Sprache: Deutsch
Verbannt in die Seiten eines Buches. Vergessen über die vielen Jahrhunderte, aber nie weniger gefährlich geworden. Die verbotenen Flüche. Niemand scheint mehr von der Existenz dieses unheilvollen Buches zu wissen. Bis der abenteuerlustige Jägersohn Asulon sich auf ein magisches Wesen einlässt und somit ahnungslos sein Schicksal und das des Volkes Thigara in ungeahnte Bahnen lenkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Einsamer Jäger
Tägliche Dorfgespräche
Schwarzer Schatten
Zestor, der dunkle König
Die Nacht des Abschieds
Der Weg ins Jenseits
Der Schritt ins Ungewisse
Simpler Zauber
Fremde Begleiter
Das Angebot der Dame
Meister Niron
Die Träume eines einfachen Mannes
Die Tochter des Königs
Das verbotene Treffen
Meister Nirons Lektion
Neues Mitglied
Bekanntes Zeichen
Lawins Befürchtung
Das Rattenloch
Ungerechter Kampf
Fir Nirons Entschluss
Andere Verpflichtungen
Die Türme von Garwyr
Die erste Prüfung
Primärmagier
Die Hallen der Weisen
Verschiedene Wege
Die Macht der Karadis
Eis und Wasser
Die Prophezeiung
Das Geschenk des Lebens
Asulons Geständnis
Haschantra
Der Weg um das Schicksal
Der goldene Rattenkopf
Geliebter Bruder
Der Schattenjäger
Der misslungene Zauber
Bis zum letzten Atemzug
Der Weg der Sonne
Die Nacht der tausend Tränen
Prolog
In einem steten Rhythmus wechseln sich Tag und Nacht ab.
Die Schönheit, das Licht, der unbekümmerte Gedanke des Tages wird nach Einbruch der Nacht von der Faszination, der Dunkelheit und der Gefahr abgelöst.
Alles um uns herum wechselt sich in einem konsequenten Gleichmaß ab. Auf die heißen und gedeihenden Tage des Sommers folgen die kalten und kahlen Tage des Winters. Die Tage im Sommer sind länger als die im Winter. Der Rhythmus in allem ist eines der Naturgesetze, die wir nicht beeinflussen können. Die Menschen leben und sterben. Tiere leben und sterben. Und auch wir Anoraen leben und sterben.
Was die Menschen jedoch von allen anderen Geschöpfen unterscheidet, ist ihr Drang, sich aus diesem Gleichgewicht zu befreien. Sich gegen diesen Rhythmus zu wehren. Es fällt ihnen schwer, sich ihrem Schicksal zu fügen und ihre Rolle im ewigen Kreis des Lebens zu finden.
Sie versuchen, die Nacht zum Tage zu machen. Das Licht über die Dunkelheit siegen lassen. Doch wenn wir nur noch Licht haben, wann sollen sich unser Geist erholen, die Natur schlafen und die Schatten der Nacht sich fortbewegen?
Es ist das Verschulden der Menschen, wenn sich das Gleichgewicht unter ihrem Volk verändert hat.
Gut und Böse. Ein Spiel wie Tag und Nacht. Durch das Streben der Menschen auf die Spitze getrieben.
Die Zeiten, die wir nun schreiben, sind vom Guten erfüllt. Das Böse wurde aus den Herzen der Menschen verdrängt, eingesperrt und vergessen für viele Jahrhunderte. Doch können wir die Dunkelheit verbannen, ohne die Konsequenzen daraus zu tragen?
Noch war es den Menschen nicht klar. Und auch wir Anoraen konnten die dunklen, unheilvollen Wolken, die sich langsam über das ungeduldige Volk schoben, nicht erkennen.
In den Schatten der Nacht gelang es der Dunkelheit, sich erneut in die Gedanken der Menschen zu pflanzen. Diese zu vergiften und sie anzuspornen, sich zu erheben, um das Licht zu verbannen.
Noch war es nur ein schwaches Flüstern, das jedoch schon bald weiter an Macht gewinnen würde. Während die Finsternis klammheimlich an Stärke gewann, verlor das Licht mehr und mehr seinen Glanz. Reine Heldenherzen waren nicht mehr oft gesehen und die Symbolträger des Friedens verschwanden langsam aber sicher aus den Gedanken der Menschen.
Viele der Männer und Frauen, die in ihren einfachen Häusern weit draußen in den offenen Ländern lebten, hatten ihre eigenen kleinen Probleme. Sie lebten im Einklang mit der Natur. Passten sich ihren Launen an. Sie trotzten den kalten Wintern, verschanzten sich dann in ihren vom warmen Feuer erhitzten Häusern und zehrten von den Vorräten, die sie sich angelegt hatten. Sobald die Sonne sich entfaltete und ihre Hitze den Schnee verbannte, wurden die einfachen Leute aktiv, bestellten ihre Felder, brachten ihre Tiere hinaus auf das Feld und reparierten die Schäden an den Gebäuden, die durch den Winter entstanden waren. Sie füllten ihre Vorratskammern auf, wehrten sich verbissen gegen die Räuber der Natur und dachten gar nicht daran, die Nacht zu verbannen. Diese Menschen fürchteten noch immer die Dunkelheit der Nacht. In ihren Häusern verweilten sie, beteten zu ihren Schutzgöttern, dass diese sie heil durch die Nacht bringen sollten, und legten sich dann hin, um ihren Körper und Geist zu erholen. Aber diese Männer und Frauen waren es auch nicht gewesen, welche das Gleichgewicht verändert hatten.
Es waren die Menschen in den großen Städten aus Stein. Mauern, die sie schützten. Licht, das diese Orte zu hellen Inseln erweckte. Licht, beschworen aus den Energieströmen, die überall um uns pulsieren.
Vielleicht konnte es aber auch das Einmischen von uns Anoraen sein, welches das Gleichgewicht vor langer Zeit gestört hatte. Denn wir waren es gewesen, die den Menschen Wissen vermittelt hatten. Bücher, Worte der Macht. Vielleicht hatten wir ihnen zu viel zugetraut, und deshalb konnte sich das Böse über die Menschen erheben und wurde kräftiger als das Gute in ihnen. Ein Fehler, denn wir hatten die geistige Stärke der Menschen überschätzt.
Es war unser Zutun, dass sich ein einzelner Mann so viel Stärke aneignen konnte.
Zestor.
Anstifter zum Krieg. Mörder und Folterknecht. Eine dunkle Zeit, die sich vor vielen hundert Jahren über die Menschheit gelegt hatte. Und deshalb hatten wir erneut eingegriffen und dem Licht die nötige Unterstützung geliefert.
Restorian, ein Mann mit reinem Herzen, der Zestor in die Knie zwang und die Dunkelheit mit unserer Hilfe verbannte. So viel Macht in einen Gegenstand gesperrt. Wir Anoraen hätten es besser wissen müssen.
Doch das taten wir nicht.
Unser Hochmut ließ uns blind werden. Wir konnten die Keime dieses gefährlichen Spieles nicht sehen, die zum Ende jenes Krieges gesät worden waren und uns zu dieser neuen Geschichte führen.
Einsamer Jäger
1076 nach Romar
Das Leben im Dorf begann schon früh am Morgen, sich zu entfalten. Die Sonne lag noch in tiefem Schlaf. Der Himmel dominiert von den dunklen kalten Farben der Nacht. Doch hin und wieder hörte man bereits eine Kuh muhen, die schweren Glocken um deren Hälse schlugen vereinzelt. Ein Hahn krähte auf dem warmen dampfenden Misthaufen und suchte seine Hühner zusammen.
Die Hufe eines einzelnen Pferdes klapperten über die holprige Steinstraße. Sein Meister lenkte es an den Zügeln und schlug den Weg ein, der aus dem kleinen Dorf hinaus in den Wald führte. Er konnte den süßlichen Duft der Nacht riechen. Tief sog er die kalte Luft ein. Über seine Schulter war ein Köcher mit Pfeilen gebunden. Der Bogen hing am Sattel des Pferdes. Mit den braunen Lederstiefeln schritt er schnell voran. Solange es noch dunkel war, schritt er vor seinem Pferd her. Er wollte nicht auf diesem unsicheren Boden reiten, denn er konnte es sich nicht leisten, dass sein Pferd eine Verletzung erlitt.
Still bewegten sich die beiden Figuren fort. Hinein in den Wald. Die Äste mit den Blättern schirmten das sanfte Licht des Mondes ab und ließen den Wald dunkel und gefährlich wirken. Nur vereinzelte weiße Strahlen brachen durch das dichte Blätterdach und zeichneten helle, unförmige Flecken auf den Weg, der vor dem Mann lag. Das braune Pferd schnaubte kurz, als eine aufgeplusterte Eule in einiger Entfernung heulte. Raschelnd breitete sie ihre Flügel aus und flog tiefer in den Wald hinein.
Der junge Mann schaute der Eule hinterher. Auch sein Ziel lag tief im Wald. Dort, wo selten ein Mensch vorbeikam.
Unberührte Natur umgab ihn. Hohe Tannen mit dicken Stämmen standen links und rechts vom Weg. Aber auch alte eingeknickte Bäume lagen auf dem feuchten Waldboden. Das Holz faul und morsch, von Moos und Pilzen überwachsen.
Die braunen aufmerksamen Augen des jungen Mannes wanderten wachsam über die Umgebung. Denn selbst wenn er nicht daran glaubte, was die Leute aus dem Dorf erzählten, wollte er sicher sein, dass er nicht überfallen wurde. Es wurde erzählt, dass seit einiger Zeit einige Banditen hier in den Wäldern ihr Unwesen trieben. Woher dieses Gerücht stammte, wusste allerdings niemand. Und ob wirklich schon einmal jemand überfallen worden war, konnte auch niemand so genau beantworten.
Der junge Mann wanderte wacker weiter in den Wald hinein, sein Pferd im Schlepptau. Die Stunden vergingen, und schon lange hatte er den schmalen Weg verlassen. Mit seinem Pferd stolperte er durch das Unterholz. Langsam wurde es heller. Milchiges Dämmerlicht lag zwischen den Bäumen, und langsam konnte der junge Mann auch mehr erkennen. Sein Blick reichte weiter in den Wald hinein. Bald würde es hell genug sein, um zu jagen. Denn das war das Ziel seines Ausfluges. Er war früher aufgestanden, damit er weiter in den Wald vordringen konnte, denn in dem unmittelbar am Dorf liegenden Waldstück gab es nur selten richtig schöne Hirsche, die er jagen konnte. Die Tiere des Waldes wussten, wo sie in Sicherheit waren. Und somit musste der Mann ihnen folgen. Er und sein Vater lebten von ihren Jagderfolgen. Wenn sie keine Erfolge erzielten, mussten sie hungern. So einfach war es. Das harte Gesetz der Natur.
Doch heute erhoffte sich der Mann einen guten Fang. Er war weit in die dunklen Wälder vorgedrungen und suchte nun nach einem geeigneten Standort, wo er jagen konnte. Dafür suchte er sich am liebsten ein Wasserloch oder einen Bach, wo die Tiere Wasser tranken. Die Hirsche ließen sich immer viel Zeit zum Trinken und waren weniger aufmerksam.
Vorsichtig schlich er über den Waldboden und suchte nach frischen Spuren. Bald entdeckte er eine. Die sanften Abdrücke der gespaltenen Hufe waren im Dreck nur schwer zu erkennen, aber er hatte sie entdeckt. Vorsichtig folgte er der Spur. Heute führte sie nicht wie erhofft zu einem Wasserloch, aber auf eine saftig grüne Lichtung. Das Gras war fett und hoch. Grün stach es durch den dunklen, düsteren Wald.
Der junge Mann zog kurz einen Mundwinkel hoch. Er war etwas enttäuscht. Aber er musste sich mit dieser Lichtung abfinden. Er trat auf die Wiese und beobachtete die Halme, wie sie sanft im Wind wippten. Seiner Beobachtung zufolge kam der Wind aus dem Osten. Er schritt außen an der Lichtung herum, und als er auf der westlichen Seite angelangt war, suchte er sich ein geeignetes Versteck.
Sein Pferd befreite er vom Sattel und Zaumzeug und ließ es von dem schmackhaften Gras fressen. Sein Pferd war gut abgerichtet und sobald es die Präsenz eines sich nähernden Hirsches wahrnehmen würde, würde es sich zurückziehen.
Der Jäger setzte sich zwischen einigen Büschen nieder und verharrte dort still. Hoffnungsvoll sah er auf die Lichtung.
Das Gras war frisch und saftig und die Tiere brauchten sich nicht zu fürchten, deshalb erhoffte sich der junge Bursche, noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder ins Dorf zurückzukehren. Nun hieß es jedoch erst einmal warten.
Dies war immer die Zeit, die er zum Nachdenken hatte.
Seine Gedanken schweiften ab. Zu seinem alten Vater, der ihn all das gelehrt hatte.
Geduld, Ruhe und das Bogenschießen.
Er schaute auf den Bogen, der in seinem Schoß lag. Wie viele Stunden hatten sie gemeinsam geübt, bis er den Bogen so beherrschte, dass sein Vater zufrieden war. Ein kurzes Lächeln huschte über den schönen geschwungenen Mund des Mannes. Er redete nie viel. Auch das schien wohl etwas, dass er von seinem Vater gelernt hatte. Still zu sein und nur etwas sagen, wenn es wichtig und angebracht war. Viel zu viel wurde über belangloses Zeug diskutiert.
Mittlerweile stand die Sonne hoch oben am Himmel und breitete ihre Strahlen über der Lichtung aus. Das Fell des Pferdes, welches immer noch genüsslich fraß, glänzte im Licht des grellen Himmelskörpers. Die schwarze Mähne zuckte lustig, während das Tier immer wieder die Fliegen und Mücken abwehrte. Die langen Schweifhaare flogen durch die Luft und machten ein peitschendes Geräusch. Die braunen, unschuldig wirkenden Augen des Mannes ruhten auf seinem Tier. Er liebte es, dem Tier zuzusehen, wie es zufrieden auf der Wiese stand und fraß. Diese Gelassenheit, Unbekümmertheit, die nur ein Tier haben konnte. Er überblickte die Lichtung. Kurz gähnte er und zog dann seine Knie an.
Seine Gedanken drehten sich um sein Leben. Seit er denken konnte, war er immer mit seinem Vater mitgegangen, um zu jagen. Sein Leben bestand aus diesen immer gleichen Abläufen, die ihn sein Vater gelehrt hatte. Aber wollte er das auch wirklich? Wenn er so alleine im Wald war und nachdachte, fielen ihm die wildesten Abenteuer ein.
Er wollte durch das Land reisen. Neue Orte entdecken. Was wollte er da in diesem kleinen Dorf? Ihn hielt nichts hier.
Sein Vater war alles, was ihm etwas bedeutete. Und wenn er einmal nicht mehr war?
Er würde sicher nicht hierbleiben. Seine Abenteuerlust zog ihn hinaus in die Welt.
Einmal wollte er ins Zentrum des Reiches reisen und den sagenumwobenen goldenen Palast sehen. Man erzählte sich, dass das Gebäude so hell glänzte, dass man es schon von den Bergen her sehen konnte. Wie ein funkelnder Diamant in der Landschaft soll er strahlen.
Der Mann seufzte. Was es wohl noch für Wunder in dieser Welt gab? Langsam, aber sicher senkte sich die Sonne in ihrer Bahn. Der Mann pfiff kurz durch seine Finger. Sein Pferd hob den Kopf und trabte dann zu ihm. Hinter ihm legte es sich brav hin und gab keinen Laut mehr von sich. Still beobachtete es die Umgebung. Sanft spielte es mit seinen Ohren. Der junge Mann strich ihm über den Hals, während sie warteten.
Schnell wurde es im Wald wieder dunkler, sobald die Sonne verschwand. Mürrisch seufzte der Bursche, denn er hatte gehofft, dass sich die Hirsche eher zeigen würden. Aber sie ließen sich Zeit.
Als er gerade gelangweilt mit einem kleinen Holzzweig in seinen Fingern spielte, tapste endlich ein braunes Tier zaghaft auf die Lichtung. Der Wind hatte während des Tages nicht gedreht und somit konnte der Hirsch die Witterung des jungen Mannes nicht aufnehmen. Lange hatte er seine Nase weit in die Luft gestreckt und horchte gespannt mit seinen großen Ohren. Der Jäger saß erstarrt in seinem Versteck und hatte den Bogen in der Hand.
Einige Momente vergingen, bis der Hirsch sich sicher war, dass keine Gefahr drohte. Langsam schritt er aus dem sicheren Schatten der Bäume heraus auf die Lichtung. Seinen Kopf hatte er immer noch erhoben. Noch zwei Schritte machte er, und dann senkte er vorsichtig seinen Kopf mit dem schweren Geweih. Zufrieden begann er am Gras zu zerren. Schnell schluckte er die Büschel herunter. Der Mann zog vorsichtig einen Pfeil aus dem Köcher und legte ihn auf die Sehne.
Wenn er mit diesem Schuss verfehlte, wäre er vergebens hierhergekommen. Denn bestimmt würde sich kein weiteres Tier mehr auf die Wiese trauen. Langsam spannte er den Bogen und in diesem Moment betrat ein weiteres Tier die Lichtung. Dieser Hirsch schien noch älter als der Erste. Sein Geweih war beeindruckend und auch seine Körpergröße. Der erste Hirsch machte zwei, drei Schritte zur Seite und ließ das ranghöhere Tier vorbei. Der Hirsch drehte kurz den Kopf und begann dann ebenfalls zu fressen. Vorsichtig drehte sich der junge Mann, um den Schuss auf den älteren Hirschen abzufeuern. Er hatte den Bogen gespannt, hielt die Luft an und zielte auf die breite Brust des Tieres.
Eine Sekunde zögerte er und dann schoss er den Pfeil ab.
Mit einem wütenden Surren schoss er durch die Luft und erreichte sein Ziel. Der Hirsch röhrte angsterfüllt auf und machte einen Satz zur Seite. Er krachte zusammen und blieb röhrend liegen. Sein jüngerer Artgenosse hob schnell den Kopf und sprang mit eleganten, zügigen Sprüngen über die Lichtung davon in die Sicherheit, die ihm der Wald bot. Der Mann sprang aus dem Schatten auf und rannte auf die Lichtung. Erneut spannte er einen Pfeil auf, und als er das Tier erreichte, erlöste er es mit einem zweiten Pfeil von seinen Schmerzen.
Für einen kurzen Moment schloss Asulon die Augen und berührte mit Mittel- und Zeigefinger seine Stirn. Darauf bedacht, dass seine Handinnenfläche zum Himmel zeigte.
Dies war der göttliche Gruß, um ihnen zu danken und ihnen den nötigen Respekt zu zollen.
Danach ließ er seine Augen über den Hirsch gleiten. Es war ein muskulöses Tier, das mit Sicherheit viel Fleisch für ihn und seinen Vater gab. Sofort machte er sich daran, die wertvollen Stücke zu entfernen und sorgsam in einem Beutel zu verstauen. Nachdem er alles Brauchbare herausgeschnitten und sauber verpackt hatte, band er es an den Sattel des Pferdes.
Das braune Pferd stand still neben ihm und wartete geduldig, bis sämtliche Lasten verstaut waren. Dann machten sich der Mann und das Pferd wieder auf den Weg. Sie würden erst spät in der Nacht wieder ins Dorf zurückkehren.
Aber der Mann wollte nicht hier draußen rasten mit dem Fleisch, das mit Sicherheit wilde Tiere wie Wölfe oder Bären angelockt hätte. Es war schon riskant, in der Dunkelheit alleine durch den Wald zu schreiten, denn der Geruch von frischem Fleisch breitete sich schnell aus.
Still ging er vor seinem Pferd her und führte es zügig durch den Wald. Es war bereits wieder dunkel und die Sterne funkelten unschuldig am Himmel. Immer wieder musste sich der Mann umsehen und die Himmelsrichtungen bestimmen.
Das Moos, welches an den dicken Baumstämmen gewachsen war, oder auch eine kleine Pflanze mit stacheligen Blättern, die nach Norden zeigten, halfen ihm dabei, den Weg nach Hause zu finden.
Die Zeit verstrich und endlich erreichte er den schmalen holprigen Weg, der hinaus aus dem Wald führte. Sein Pferd trottete vorsichtig hinter ihm her. Es machte einen müden Eindruck. Seinen Kopf hatte es nicht mehr ganz so hoch erhoben, die Ohren waren nicht mehr ganz so gespitzt und lauschen nicht mehr so aufmerksam den Geräuschen des Waldes. Aber auch der junge Mann spürte den langen Tag.
Seine Beine schmerzten vom weiten Weg, er war nicht mehr so konzentriert und seine Augenlider wurden immer schwerer. Er gähnte und blinzelte müde.
Plötzlich hörten die beiden müden Gestalten ein gefährliches Heulen, das ihre Knochen wieder wach werden ließen.
Wölfe!
Angespannt lauschte der Jäger in die Nacht hinein und strich dann kurz beruhigend über den Hals seiner Stute. „Los, komm, mein Mädchen“, murmelte er seiner Mähre zu und beschleunigte seine Schritte. Die wilden Geschöpfe gehörten zu den gefürchteten Tieren. Denn sie jagten in großen Rudeln, waren blutrünstig und kannten keine Gnade. Selbst für einen Jäger war ein Rudel dieser Bestien schwer abzuwehren.
Sie waren noch in einiger Entfernung, so viel vernahm der Bursche nun aus dem einsamen Heulen. Das Pferd schnaubte nervös. Und auch der junge Mann spürte, wie sein Herz schneller schlug. Das würde jetzt noch fehlen, wenn diese Bestien ihn angreifen würden. Aufmerksam horchte er in die Nacht hinein, ob er außer ihren Schritten noch andere Geräusche hören konnte.
Doch es blieb ruhig. Zu ruhig. Düster und unheilvoll breitete sich der Wald um ihn herum aus. Raschelnde Zweige, vom Wind und von kleinen Waldbewohnern in Bewegung versetzt, ließen den Puls des Burschen schneller schlagen. Zurecht. Unter den normalen, feinen Geräuschen des Waldes hörte der erschöpfte Jäger das Pfotenpaar nicht heranschleichen.
Plötzlich sprang aus unmittelbarer Nähe ein dunkler Schatten aus dem Unterholz. Mit gewaltigen Sprüngen legte das Tier die Entfernung zwischen ihm und dem Jäger zurück.
Erschrocken wieherte die Stute auf, versuchte, sich loszureißen, doch der junge Mann hielt sie fest an den Zügeln, während er mit der anderen Hand seinen Dolch aus dem Gurt um seine Hüfte zog. Mit gefletschten Zähnen sprang der dunkle Wolf auf den Jäger los; die Vorderläufe voran, rammte er den Mann zu Boden und schnappte blitzschnell nach dessen Gesicht.
Dieser wiederum riss seinen Arm nach vorne und zog den Dolch durch das dichte, struppige Fell des Tieres, was es aufheulen ließ. „Trab nach Hause. Gemächlich!“, schrie er der wild tänzelnden Stute zu. Wie ihr befohlen wurde, gehorchte die Mähre. Nur zu gerne trabte das Pferd los und verschwand im Wald.
Der Wolf, welcher für einen Moment zurückgewichen war, setzte erneut zum Angriff an. Diesmal war der Jägerssohn gewappnet, sprang aus der Angriffslinie des Tieres, drehte sich blitzschnell um und versuchte, den Wolf abermals mit dem Dolch zu erwischen.
Angst saß in seinen Knochen. Furcht vor dem grauen, knurrenden Monster, das ihn mit glühenden Augen fixierte.
Es war ein einzelnes Tier. Vermutlich verstoßen, schoss es dem Mann durch den Kopf, als er das verschlissene linke Ohr des Wolfes sah. Verstoßene Tiere waren wohl alleine, hatten allerdings nichts mehr zu verlieren. Meistens waren sie hungrig, da sie alleine weit weniger Jagderfolge erzielten als im Rudel.
Das Herz schlug dem Burschen bis zum Hals, als er seinen ganzen Mut aufbrachte und auf den Wolf zustürmte, den Dolch erhoben. Knurrend sprang der Wolf zur Seite, hieb mit seiner Pranke auf den jungen Mann ein und erwischte dessen Schlagarm.
Der Dolch entwich seinen Fingern, als der Schmerz seinen Arm durchfuhr. Panik erfüllte ihn, als er den Dolch einige Fuß von sich entfernt auf dem dunklen Waldboden unschuldig schimmern sah. Keine schöne Waffe, aber praktisch. Die Klinge scharf genug, um mit genügend Kraft Knochen zu durchtrennen. Doch dafür hätte er sie in den Händen halten müssen. Erneut heulte es auf in einer gewissen Entfernung. Der Mann und auch der Wolf horchten auf und sahen in die Richtung, aus der das Rudel rief. Den Jäger durchfuhr ein eisiger Schauer.
Er musste so schnell wie möglich weg. Er musste seine Stute beschützen, die noch immer das Fleisch in den Lederbeuteln am Sattel trug und somit den für die Wölfe köstlich riechenden Duft mit sich führte. Das verstoßene Tier klemmte die Rute zwischen die Beine und überlegte wohl kurz, was es tun sollte, ehe es erneut auf den jungen Jäger losschoss.
Ohne Dolch blieb ihm nur noch eine Möglichkeit. Mit seinem Bogen schneller zielen und schießen, als er es jemals getan hatte. Er zog den Bogen hervor, spannte den Pfeil auf die Sehne und schoss. Keinen Moment zu spät. Der Wolf setzte zum Sprung an und wurde vom Pfeil an der linken Schulter getroffen. Winselnd und heulend ging das Tier zu Boden, rappelte sich wieder auf, die linke Vorderpfote entlastend. Sein glühender Blick traf den Jäger, der einen weiteren Pfeil aufgespannt hatte. Doch der Wolf verschwand im Unterholz, bevor er ihm den Gnadenschuss geben konnte.
Lange konnte der Jäger jedoch nicht mehr überlegen. Er musste hier weg. Und so nahm er seine Beine in die Hand und hetzte den Pfad zwischen den hohen dunklen Bäumen hindurch. Der düstere Wald drückte auf sein Gemüt und hinterließ ein mulmiges Gefühl in seiner Magengrube. Erneut hörte er einen klaren, hohen Heuler, der eindeutig aus der Schnauze eines Wolfes stammte. Diesmal war er bereits näher. Kurz überlegte er sich, ob es wohl schlau war, seinem Pferd zu rufen, doch es wäre sowieso überflüssig gewesen, ruhig zu bleiben. Die Wölfe hatten die Fährte längst aufgenommen.
Und so pfiff er einmal kurz durch seine Finger. Inständig hoffte er, dass seine Braune nicht den Kopf verloren hatte und blindlings durch den Wald davongejagt war. Schwer atmend schoss er durch den Wald, als er das Pferd in einiger Entfernung vor sich entdeckte. Gemächlich trabend, darauf bedacht, nicht zu schnell zu gehen, um seinem Herren die Möglichkeit zu geben, es wieder einzuholen. Denn schließlich hatte er ihm ein Signal gegeben. Erleichtert, das schlaue Tier wieder gefunden zu haben, verlangsamte er sein Tempo und ergriff die Zügel.
„Los, lass uns schnell von hier verschwinden“, forderte er das Pferd auf und führte es zügig weiter. Nicht zu schnell, denn der Untergrund war tückisch. Das braune Pferd legte nervös die Ohren an und wollte erneut einen Gang zulegen, als mehrere Wölfe in ein unheimliches Lied einstimmten.
Doch der Mann hielt es zurück. Sie durften jetzt nicht in Panik geraten und keine Fehltritte riskieren. Das war es, was diese flinken Jäger der Nacht wollten. Für sie würde es um einiges einfacher werden, wenn sie verletzt wären.
Das braune Pferd schnaubte erbost, gehorchte aber seinem Meister. Sie stolperten schnell über die losen Steine des Weges und erreichten nach einer gehetzten Stunde endlich den Waldrand. Der Mond, der hinter einer Wolke hervorschien, offenbarte ihnen das einsame kleine Dorf in einem silbernen, verschlafenen Licht.
Froh, den düsteren Wald hinter sich zu lassen, schritten sie den Weg zwischen den saftigen Weiden hinunter zum Dorf.
Ein weiteres Mal heulte in weiter Ferne ein Wolf auf, doch nun waren sie keine Gefahr mehr, denn der junge Mann wusste, dass sich die Tiere nicht aus der Dunkelheit des Waldes trauten. Erleichtert atmete er aus. „Das war knapp gewesen, meine Liebe.“ Gelöst tätschelte er den muskulösen Hals der Stute, die zustimmend schnaubte.
Und somit konnte er beruhigt das letzte Stück des Weges zurücklegen. Bald schritt er durch das Tor, welches wilde Bestien von den Dorfbewohnern fernhielt. Einsam klapperten die Hufe seines Pferdes über die Pflastersteine. Nur der Hauptweg, welcher vom Tor bis zur Vorratskammer der Regierung führte, war mit diesen Pflastersteinen verlegt worden.
Bald schon verließ er den sauberen Weg und betrat einen weiteren, der dreckig und staubig vor ihm lag. Im Sommer, wenn die Sonne heiß vom Himmel schien, waren diese Wege trocken und gut begehbar. Aber sobald es im Herbst längere Zeiten richtig starken Regenfall gab, waren diese Straßen matschig und rutschig. Doch das Dorf war nicht sonderlich reich und es waren hohe Kosten, die eine Pflastersteinstraße verursachte.
Der junge Jäger verschwand hinter einer Hausecke und schritt auf den großen Dorfplatz, auf dessen Mitte ein runder Ziehbrunnen stand. Der Eimer stand auf dem Rand des Brunnens. Das Seil, an welchem er befestigt war, schwang sanft hin und her in der leichten Brise, die wehte. Das braune Pferd hob erleichtert den Kopf, als es am anderen Ende des Platzes seinen Stall erblickte. Froh beschleunigte es seine Schritte. Der junge Jäger führte es hinein in den Stall, der für zwei Pferde gebaut worden war. Er nahm dem Tier die Last ab, verstaute den Sattel und das Zaumzeug und stellte es dann in die leere Box. Noch schnell holte er etwas Heu und legte es in die hölzerne Futterraufe. In der zweiten Box bewegte sich etwas und kurz darauf starrte ihn von dort ein weiteres hungriges Augenpaar an. Der junge Reiter lächelte das zweite Pferd an und holte dann auch für dieses Tier noch ein wenig Heu. Dankbar knabberten die Tiere an ihrem Futter.
Und nun konnte er endlich auch schlafen gehen. Er packte seine Beute und legte sie dann in der kleinen Küche auf den Tisch. Er musste zweimal laufen, bis er alles geholt hatte, doch dann war alles an seinem Platz und er schlich sich leise durch den dunklen Gang des kleinen Hauses. Hinüber zu seinem Zimmer. Die Tür ging knarrend auf, als er vorsichtig die Klinke nach unten drückte. Flink huschte er hinein und schloss die Tür hinter sich. Er wollte nicht, dass sein Vater geweckt wurde.
In seinem eigenen kleinen Reich gähnte er erst einmal ausgiebig. Die hölzernen Wände waren in sanftes Licht getaucht, das durch ein kleines Fenster in den Raum fiel. Ein einziger Schrank stand in der hinteren Ecke und ein schmales Bett. Der Mann schritt zum Bett und zog seinen Lederwams aus und das Hemd. Er legte die beiden Kleidungsstücke auf den Stuhl, der neben dem Bett stand und als Ablagefläche diente. Schnell hatte er sich auch von den restlichen Kleidungsstücken befreit und kroch dann dankbar unter die Decke. Schnell fielen seine braunen mandelförmigen Augen zu und er sank in einen angenehm tiefen Schlaf.
Tägliche Dorfgespräche
Hämmernde Geräusche weckten den jungen Mann aus seinem erholsamen Schlaf. Blinzelnd richtete er sich auf. Die Sonne warf goldenes Licht in das niedrige Zimmer und zeichnete lange, helle Flecken auf die Holzwand und die Haut des ausgeruhten Jägers. Die Decke lag verknittert neben ihm; er musste sie wohl in der Nacht zur Seite gestrampelt haben. Ein, zwei Mal war er aufgewacht, geträumt hatte er von den Wölfen und den glühenden, gefährlichen Augen des ausgestoßenen Tieres. Er gähnte und streckte sich ausgiebig, die Gespinste der letzten Nacht noch in seinen Gedanken.
Dann bewegte er sich aus dem Bett und zog sich schnell an.
Langsam wich die Müdigkeit von ihm. Er hatte normal keine Mühe, früh aufzustehen und kam mit wenig Schlaf aus.
Doch an diesem Morgen spürte er den vergangenen Tag noch nachwirken.
Mit drei Schritten hatte er den Raum durchquert und stand am Fenster. Er öffnete die beiden Flügel, um ein wenig frische Luft reinzulassen, um seinen Geist zu erfrischen. Der warme Sommermorgen kroch angenehm in sein Zimmer und wärmte die steifen Knochen. Ein schneller Blick zur Sonne schaffte Klarheit, wie spät es war. Der junge Mann fuhr sich durch das zerzauste dunkelblonde Haar. Eine Strähne fiel ihm ins Gesicht.
Auf dem Dorfplatz vor seinem Fenster war bereits einiges los. Die Männer schritten mit Kühen, Ziegen und Pferden hin und her und die Frauen standen mit ihren geflochtenen Körben am Arm zusammen und erzählten sich die neuesten Geschichten. Der junge Mann schüttelte den Kopf, während er das andere Geschlecht beobachtete.
Er konnte nicht verstehen, wieso die Weiber immer so viel unnötigen Tratsch zu besprechen hatten. Für ihn gab es wichtigere Dinge im Leben. Seine Augen suchten den Dorfplatz ab. Er genoss es, am Morgen noch einige Minuten die Leute zu beobachten, bevor die Arbeit rief. Und so beobachtete er das rege Treiben vor dem Fenster. Als eine Schar junger Frauen sich näherte, zog er schnell den Kopf zurück und schloss das Fenster wieder. Er wollte nicht mit ihnen reden. Sonst würde er nie zu seiner Arbeit kommen.
Er ging hinaus aus seinem Zimmer den dunklen Gang entlang in die Küche. Wie vermutet fand er dort seinen Vater vor.
Dieser war damit beschäftigt, das Fleisch lagerfähig zu machen. Er schnitt es zu angemessenen Stücken und rieb sie dann sorgfältig mit Salz ein. Als er die Schritte seines Sohnes vernahm, schaute er von seiner Arbeit auf. Ein Kurzes Nicken hieß so viel wie Guten Morgen.
Dann widmete er sich wieder seiner Arbeit.
Asulon ging zu einem großen Schrank hinüber und holte dort einen Krug mit Wasser, den sie immer dort stehen hatten. Sorgfältig leerte er Wasser in ein Glas und trank gierig. Wohltuend rann das kühle Nass seine Kehle herunter.
Nach dem zweiten Glas stellte er den Krug wieder zurück und durchquerte dann die Küche.
Er wollte gerade hinausgehen, um nach den Pferden zu sehen, als sein Vater brummte: „Du hast hier ein schönes Tier erlegt. Dein weiter Weg hat sich wohl gelohnt.“ Der Mann mit dem langen grauen Haar und den hellen blauen Augen schaute von seiner Arbeit auf.
Der junge Jäger nickte.
„Ich musste lange warten, bis mir dieses Tier vor den Pfeil gelaufen ist“, erklärte er, „aber es hat sich wirklich gelohnt, da habt ihr recht, Vater.“
Der alte Mann lächelte seinen Sohn warm an. „Wann bist du zurückgekehrt? Ich habe noch lange auf dich gewartet.“
Er legte ein Stück Fleisch zur Seite und widmete sich dem nächsten.
„Nun, es war einiges nach Mitternacht“, entgegnete der junge Mann.
„Hattest du keine Probleme mit Wölfen oder Banditen?“
Stumm schüttelte er den Kopf. Sein Vater brauchte nicht zu wissen, dass er von einem abtrünnigen Wolf angegriffen worden war. Asulon dachte an das graue Tier. Hoffentlich würde der Wolf nicht noch lange an den Schmerzen des Pfeiles in seiner Schulter leiden müssen. Das schlechte Gewissen erfüllte ihn, als er daran denken musste. Die Götter würden dies sicherlich nicht begrüßen.
„Das ist erfreulich. Diese Beute reicht sehr lange, wenn auch nicht den gesamten Winter.“
Der Junge nickte seinem Vater zu. „Keine Sorge, Vater. Ich werde so bald wie möglich noch einmal so weit in die Wälder hinausreiten, dann bring ich dir noch so ein Tier mit.“
Der junge Mann zeigte auf die Tür. „Ich geh rüber und bringe die Pferde auf die Koppeln.“
Der Alte brummte ihm seine Bestätigung zu und sah dann seinem Sohn hinterher, wie der durch die Tür nach draußen huschte. Er hob einen Mundwinkel und lächelte zufrieden in sich hinein. Dann widmete er sich wieder dem Fleisch, das er noch zu bearbeiten hatte.
Der junge Mann schlenderte um das Haus herum zu dem kleinen Stall, der noch im Schatten lag. Er schob die alte Holztür auf und klemmte ein kleines Holzstück darunter, damit sie nicht wieder zufallen konnte. Die beiden Pferde schauten bereits gespannt aus ihren Boxen. Die Braune und der Falbe schüttelten ungeduldig ihre Köpfe. Als Erstes packte der junge Mann allerdings zwei Holzeimer und schritt mit diesen wieder nach draußen. Er überquerte den Dorfplatz, ging zum Brunnen, um etwas Wasser zu holen.
Wie immer um diese Zeit gab es bereits einige, die in der Schlange standen und auf das Wasser warteten. Der junge Jäger stellte sich in der Reihe hinten an und wartete geduldig.
Er beobachtete die Leute, die fröhlich miteinander redeten.
Als eine helle Stimme seinen Namen rief, wurde er aus seinen Gedanken gerissen.
„Asulon!“
Er wendete seinen Kopf und erblickte eine junge Frau, die zu ihm herüberkam. Sie lächelte ihn freundlich an. Ihr rotes Haar hatte sie zusammengebunden. Allerdings fassten einige widerspenstige Locken ihr helles zartes Gesicht ein. Sie erreichte ihn und stellte sich hinter ihm in die Reihe. Auch sie hatte einen Eimer bei sich und wollte offensichtlich etwas Wasser holen.
„Wie geht es dir?“ Sie schaute ihn an. Ihre unschuldigen braunen Augen musterten ihn erfreut. Ihr Blick blieb auf seiner feinen Stupsnase hängen. Asulon grinste sie an.
„Guten Tag, Jenna. Mir geht es gut, danke der Nachfrage.
Und dir?“
Sie blinzelte einige Male schnell mit ihren Wimpern und antwortete dann sofort. „Mir geht es herrlich. Ein solch schöner Tag. Wir sollten das Wetter noch genießen, vielleicht ist es bald der letzte schöne Sommertag. Schließlich steht der Herbst bereits vor der Tür.“ Sie atmete schnell; sie schien leicht erregt zu sein, fiel Asulon auf. Bevor er etwas erwidern konnte, durften sie in der Reihe vorrücken. Der nächste Dorfbewohner machte sich am Ziehbrunnen zu schaffen.
„Der Herbst wird bestimmt bald beginnen Wie ich gestern beobachten konnte, machen sich die ersten Vögel auf den Weg in den warmen Süden. Und auch die ersten Bäume lassen ihre Blätter fallen“, erzählte er höflich der jungen Dame. Sie nickte eifrig. Dann schaute sie sich kurz um und kam noch etwas näher.
„Warst du gestern im Wald gewesen?“
Sie begutachtete ihn aus großen Augen. Er nickte nur.
Erneut schaute sie sich um.
„Sei bitte vorsichtig, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst. Einige der Dorfbewohner haben erzählt, dass sie vor kurzem ein schwarzes Biest gesehen hatten.“
Asulon runzelte die Stirn. Schon wieder solch ein Tratsch.
Er glaubte nicht daran, solange er es nicht selbst sah oder stichfeste Beweise hatte.
Abwehrend meinte er: „Was denn für eine Bestie? Das war bestimmt ein Wolf.“ Schließlich hatte er die Bestie hautnah erlebt.
Doch Jenna schüttelte den Kopf. „Nein nein. Es sei viel größer als ein Wolf. Es hat in etwa die Größe eines Pferdes.
Sagten sie.“ Gespannt musterte sie Asulon. Sie beobachtete ihn gerne. Seine verhaltenen Bewegungen. Das zaghafte Lächeln, welches um den geschwungenen Mund spielte. Und diese wunderschönen braunen Augen, die Entschlossenheit ausstrahlten und doch so scheu und brav in die Gesichter seiner Mitmenschen sehen konnten.
„Vielleicht war es ein Bär. Bären können schon einmal so groß werden wie ein Pferd.“ Er wendete seinen Blick von Jenna ab und überflog den Dorfplatz. Am Himmel sah er einige dunkle Vögel kreisen. Ihr lachendes Krächzen machte weitere Dorfbewohner auf sie aufmerksam.
„Seht“, konnte Asulon eine ältere Frau hinter ihnen in der Schlange hören. „Das sind Karseen. Es ist lange her, dass diese Unglücksvögel das Dorf heimgesucht haben“, sinnierte sie, während die Vögel tiefer aus dem Himmel fielen über die Häuser hinweg flogen und dann auf dem Schindeldach von Asulons Zuhause landeten.
Alarmiert sah die Frau zu Asulon, der die Vögel noch immer beobachtete.
Es ging etwas Merkwürdiges von diesen Tieren aus. Größer als Raben, aber weit eleganter und graziler wirkten sie. Und nun, da sie auf seinem Dach saßen und ihr schimmernd schwarzes Gefieder putzten, wurde Asulon etwas mulmig.
Jenna bekam davon gar nichts mit und sprach unbeirrt weiter. „Ach, Asulon. Bären sind doch nicht schwarz. Die haben ein braunes Fell,“ meinte sie belehrend.
Asulon atmete einmal tief aus, wollte etwas erwidern, hörte jedoch die alte Frau wieder zu ihrem Enkel sprechen, während sie Asulon aus wissenden Augen taxierte. Ihr Blick ließ Asulons Eingeweide in sich zusammenziehen und sein ungutes Gefühl weiter verstärken.
„Karseen bringen keine guten Nachrichten. Sie bringen ein leidvolles Schicksal mit sich. Und sie haben es auf die beiden Jäger abgesehen.“ Die Frau sprach leise, brabbelnd, doch Asulon konnte ihre Worte verstehen. Abermals sah er hinüber zu den Vögeln, die nun hinunter auf den Dorfplatz starrten.
Ihre schwarzen Knopfaugen schienen ihn beinahe zu durchbohren.
Schnell wendete er seinen Blick ab und versuchte, sich wieder auf Jenna zu konzentrieren. Wo waren sie stehengeblieben? Schließlich fand er den Anschluss wieder.
Die Bären oder Wölfe, die von den Dorfbewohnern als Monster angesehen wurden. Asulon wusste aus eigener Erfahrung, dass in der Dämmerung aus braun schnell einmal schwarz werden konnte.
Erneut konnten sie eine Position nachrücken. Erleichtert stellte Asulon fest, dass er als Nächster am Zug war. Er betrachtete die junge rothaarige Frau mit einem vielsagenden Blick.
„Ich wollte nur, dass du auf dich aufpasst“, fuhr sie fort, als er nicht antwortete. Sie lächelte verhalten und wendete dann ihren Kopf etwas ab, damit Asulon nicht sehen konnte, wie ihre Wangen ein wenig röter wurden.
Der alte Mann vor Asulon hatte seinen Eimer gefüllt. Er stellte den Eimer des Ziehbrunnens auf die Kante und hievte dann mit lautem Schnaufen den eigenen Eimer vom Boden ab und humpelte über den Platz davon. Asulon trat vor und ließ schnell den Eimer am Seil in den dunklen Schlund des Brunnens hinab. Dann holte er ihn mit eigener Muskelkraft wieder nach oben. Jenna beobachtete ihn, während er den Eimer nach oben trieb. Sie grinste verlegen, als sie seine Muskeln bestaunte, und er sie dabei ertappte. Schnell senkte sie ihren Blick und meinte dann etwas zaghaft: „Wie läuft es eigentlich bei euch zu Hause? Geht es deinem Vater gut?“
Asulon nahm den Eimer, schüttete das Wasser in seinen eigenen und warf den Eimer wieder nach unten. „Es läuft immer was. Es wird uns bestimmt nie langweilig“, erklärte er und warf einen Blick auf das kleine Holzhaus, in dem er lebte. „Weißt du, Jenna, mein Vater wird nicht jünger. Ich habe das Gefühl, langsam macht sich sein Alter bemerkbar.“
Er seufzte und zog dann erneut den Eimer nach oben.
Jenna legte ihre Stirn in Falten.
„Das tut mir leid. Wenn ihr etwas benötigt. Sei es nur eine helfende Hand. Du kannst mich immer fragen.“ Sie lächelte ihn herzlich an.
Asulon nickte ihr dankend zu und leerte dann das Wasser um.
Er warf den Eimer ein drittes Mal nach unten und nickte in Richtung von Jennas Eimer. „Stell ihn her, ich füll ihn dir auf.“
Sie hob verwirrt den Eimer vom Boden und brachte ihn.
„Ich danke dir Asulon. Aber das wär doch nicht von Nöten gewesen.“
Er verzog seinen Mund zu einem schiefen Lächeln. „Das ist nicht der Rede wert. Ich helfe dir gerne, edle Maid.“
Außerdem mochte er die Art, wie sie ihn verstohlen beobachtete.
Schließlich hatte er auch ihren Eimer mit Wasser gefüllt und so trennten sich ihre Wege. Er schleppte die beiden Eimer zurück zum Pferdestall, wo die ungeduldigen Tiere bereits durstig warteten. Als er durch die Tür schritt, saßen die fünf schwarzen Unglücksboten noch immer auf dem Giebel des Hauses und machten keine Anstalten zu verschwinden. Unsicher, was er von der Warnung der Alten und den kuriosen Vögeln halten sollte, verschwand Asulon im Stall. Vorsichtig stellte er die vollen Eimer den Tieren hin und ließ sie saufen. Derweil holte er zwei Stricke und befestigte sie um die Hälse der beiden Kaltblüter. Schnell hatten die Pferde das Wasser weggesoffen, und so machte sich Asulon mit ihnen auf den Weg durch das Dorf.
Er schritt hinaus aus dem Dorf, hinüber zur Weide, wo er die Reittiere freiließ. Die Pferde wieherten kurz auf und trabten über das Stück Land, das eingezäunt war, und senkten dann schnell ihre Köpfe, um zu fressen. Asulon blieb noch einen Moment und beobachtete die Tiere, als ein Schatten über ihn hinwegzog. Als er seinen Blick hob, sah er die fünf Karseen über ihm am Himmel kreisen. Erneut stießen sie ihren lachenden Schrei aus, drehten ab und wurden fortan nicht mehr gesehen.
Asulon atmete tief ein und schüttelte dann ungläubig den Kopf. Was war mit ihm los, dass er den Märchen einer alten Frau Glauben schenkte? Dies waren nichts anderes als Vögel gewesen, die auf seinem Dach Rast gemacht hatten. Und so machte sich der junge Jäger auf den Rückweg und vergaß die Warnung der Frau, die er nicht hätte auf die leichte Schulter nehmen sollen.
Einige der Dorfbewohner grüßten ihn, andere nickten nur zur Begrüßung. Und wieder andere huschten mit gesenkten Köpfen an ihm vorbei. So waren die Leute aus dem Dorf und wahrscheinlich in der ganzen Welt. Einige freundlich, andere unfreundlich und manchmal fast schon etwas hinterhältig.
Am allerwenigsten mochte er diese Leute, die freundlich zu ihm kamen und ihn nach den neusten Neuigkeiten fragten, nur um danach mit jemand anderem darüber ein Urteil zu fällen. Dies war auch der Grund, warum er sehr wenig von sich selbst preisgab. Für manche Dorfbewohner, obwohl sie ihn vom Aussehen her kannten, war er ein völlig fremder Mann. Er beobachtete die Leute, die ihren Arbeiten nachgingen. Jenna winkte ihm, als er am Haus ihrer Familie vorbeikam. Sie hatte den Eimer mit Wasser in einen Bottich geleert, um dort die Kleider all ihrer Familienmitglieder zu waschen. Asulon lächelte kurz in ihre Richtung und schritt dann weiter.
Ja, Jenna war ein hübsches Mädchen, und sie stammte aus einer großen Familie. Ihre Eltern waren Landbesitzer, und somit gehörten sie zu der reicheren Gesellschaft aus dem Dorf. Sie hatten nebst drei Söhnen, die das Land bewirtschafteten noch zwei Tagelöhner, die ihnen halfen.
Aber auch der Bruder von Jennas Vater, ihr Onkel, half mit.
Er war vor allem für die Veredelung von Früchten und deren Verkauf auf dem Markt zuständig. Und natürlich waren da noch viele angeheiratete Familien. Zwei Zimmermänner, die je eine Schwester des Vaters geheiratet hatten. Ein Händler und zu guter Letzt ein Mechaniker, der es verstand, sämtliche Kutschen und Arbeitsgeräte, die von den Pferden gezogen wurden, zu reparieren und zu verbessern. Nun waren die vier Töchter alt genug, um selbst Männer zu heiraten. Asulon ging es in Gedanken durch. Einen Jäger hatten sie noch nicht in der Familie. Vielleicht war Jenna ja deshalb so nett zu ihm.
Er hob eine Augenbraue. Dann sollte sie doch. Er hatte keine Zeit für eine Frau und vielleicht einmal Kinder. Er musste sich um seinen Vater kümmern. Obwohl dies wohl dann ein anderes Familienmitglied übernehmen würde. Vielleicht sogar Jenna selbst. Asulon schüttelte den Kopf, um seine Gedankengänge zu verwerfen.
Er erreichte den kleinen Stall und machte sich daran, die Boxen zu säubern. Beinahe den gesamten Morgen verbrachte er damit, Stroh und Heu hineinzutragen, womit die beiden Tiere am Abend glücklich waren, wenn sie in die Ställe zurückkehrten. Natürlich durfte ein weiterer Eimer Wasser nicht fehlen. Und somit schleppte er erneut zwei leere Eimer zum Brunnen und kehrte mit den vollen zurück. Die Sonne brannte heiß auf die Erde unter ihr und zeigte kein Erbarmen mit den Menschen, die sich tapfer mit ihren täglichen Arbeiten abmühten. Nachdem sämtliche Arbeiten um den Stall gemacht waren, kehrte Asulon ins Haus zurück. Sein Vater war immer noch mit dem Fleisch beschäftigt.
„Ich werde noch kurz in den Wald gehen, um einige Hasenfallen aufzustellen“, teilte er seinem Vater mit, als er mit Pfeil, Bogen und einigen anderen Utensilien vor ihn trat.
Der alte Mann nickte.
„Ist gut, mein Sohn. Aber kehre nicht zu spät zurück, ich habe etwas von einem schwarzen Ungetüm vernommen, das sein Unwesen in den Wäldern treiben soll“, warnte der alte Mann.
Asulon nickte. „Davon habe ich auch schon gehört. Sorge dich nicht um mich, Vater. Dieses Ungetüm ist bestimmt nichts weiter als ein Wolf. Ein ausgestoßenes Tier, das wild geworden ist. Du kennst die Dorfgespräche“, beschwichtigte Asulon seinen Vater. „Ich kehre bald zurück. Kümmerst du dich noch um die Pferde?“ Der Vater nickte. Die hellen, scharfsichtigen Augen ruhten kurz auf seinem Sohn und widmeten sich dann wieder der Arbeit. Asulon drehte um und trat erneut ins Freie.
Schnell schritt er über die staubige Straße, hinaus in die Felder. Die Bauern und deren Tagelöhner arbeiteten auf den Feldern. Trotzten der Sonne und der Hitze. Viele hatten ihre Hemden abgelegt und schufteten mit freiem Oberkörper. Ihre Haut war dunkel gebrannt und glänzte vom Schweiß, der sich bildete. Der Weg des flinken Jägers führte bald in den naheliegenden Wald. Es wurde sofort kühler, sobald Asulon unter den ersten Bäumen hindurchging. Die Schatten spendeten etwas Schutz vor den Strahlen und ein leichter Wind brachte zusätzliche Abkühlung.
Dies war auch einer der vielen Gründe, warum Asulon den Wald so liebte. Im Sommer war es angenehm frisch in den Tiefen der Wälder. Im Winterfand man Schutz vor dem beißenden Wind, der über die Ebenen jagte. Vielleicht liebte er den Wald auch einfach, weil sein Vater ihn schon als kleines Kind immer mitgenommen hatte. Das Versteckspiel in den Büschen, den Höhlen und dem Unterholz, das Anpirschen an junge Rehe, Hasen und Füchse war immer ein Riesenspaß gewesen. Und noch mehr Spaß machte es, wenn man die Beute erlegte.
Der Erfolg tat gut, und Asulon hatte dies am Anfang im kindlichen Spiel erlernt und über die Jahre hinweg angefangen zu verstehen, wie das Gleichgewicht des Waldes war. Jäger und Gejagte. Er hatte gelernt, dass zu viele Hirsche dem Wald schaden konnten. Und auch, dass Hasen sich sehr schnell vermehrten und eine sichere Nahrungsquelle boten.
Er kannte die Gefahren, die von einem Wildschwein ausgingen. Und vieles mehr. Dieses Wissen, das er sich angeeignet hatte, basierte auf der Liebe zum Wald, die er als Kind entdeckt hatte und bis jetzt tief in sich trug. Er schlich beinahe geräuschlos durch das Unterholz. Seine Augen erkannten die vielen Vögel, die in den Ästen sangen. Er hörte, dass nicht unweit von ihm entfernt eine Füchsin ihre Jungen zusammenrief. Das sanfte grünliche Licht, das durch die Blätter schien und ein wenig Helligkeit spendete, ließ den Wald warm und freundlich erscheinen.
Asulon suchte den Boden nach Spuren ab, und als er einen Ort fand, an dem er einen kleinen Hasenpfad ausfindig machen konnte, errichtete er die Fallen. Das sorgfältige Fallenstellen brauchte viel Zeit, und langsam verstrich der Nachmittag. Das helle Licht wurde orange und warf lange Schatten. Endlich hatte er auch die letzte Falle gestellt und gekennzeichnet. Als bereits die Nacht über ihn hereinbrach, gelangte er an den Waldrand. Die Felder waren nun verlassen. Die Arbeiter waren ins Dorf zurückgekehrt.
Asulon schaute hoch zum Himmel, um die genaue Zeit zu bestimmen.
Die Sonne war verschwunden und der Mond tauchte langsam aus dem rot-violetten Himmel auf. Einige Sterne hatten sich auch schon ihren Platz am Nachthimmel erkämpft. Ein lauer Wind wehte durch die Äste der Bäume.
Gierig streckten die Bäume die Zweige hinaus in die frischer werdende Nachtluft. Für einen Moment hielt der Jägerssohn inne und setzte sich auf den von der Sonne aufgewärmten Boden. Lichter gingen in den kleinen einfachen Häuser an.
Ansonsten wirkte das Dorf aus der Ferne einsam und verlassen. Einen Moment noch genoss der Bursche die Idylle der hereinbrechenden Nacht, ehe er ins Dorf heimkehrte. Er hoffte, dass die Fallen ihren Zweck erfüllten. Denn Hasenfleisch konnten sie gut verkaufen. Die Braten waren bei den Dorfbewohnern sehr beliebt.
Im Dorf herrschte noch reges Treiben. Die Männer verließen ihre Arbeit und suchten die große Dorfschenke auf.
Die Frauen waren mit den Kindern unterwegs, erledigten letzte Aufgaben, ehe sie sich in die Häuser zurückzogen.
Asulon zwängte sich durch das Gewirr von Leuten. Zu Hause angekommen, legte er seine Jagdausrüstung weg und kehrte dann zurück ins Getümmel. Denn auch, wenn er nicht sonderlich an dem Dorftratsch interessiert war, genoss er gerne ein Bier nach getaner Arbeit. Und so ging er wie viele andere zur Schänke und setzte sich dort zu einigen Männern seines Alters auf die Bank. Es ging nicht lange, da stand auch schon das erste Maß vor ihm. Die Gastwirtin, eine große stämmige Frau, die ihr dunkles Haar streng zurückgebunden hatte, bewegte sich äußerst flink zwischen den Tischen hindurch und stellte hier und dort Bierkrüge ab.
Bald war das Haus voll, der monotone Lärm der Stimmen wurde lauter. Die Stimmung stieg mit jedem Maß. Der schwere Geruch von Bier, Alkohol und schwitzenden Männern half zudem mit, die Sinne der Männer zu benebeln.
Einige sattelten früh um auf Whiskey, Holunderschnaps und Met. Doch Asulon blieb beim Bier.
Die Nacht wurde dunkler und die Zungen der Dorfbewohner lockerer. Asulon schnappte ein Gespräch auf zwischen zwei Tagelöhnern, die sich über den lumpigen Lohn ihres Arbeitgebers unterhielten. Etwas entfernt saßen zwei junge Burschen. Der eine schwärmte offensichtlich von einem jungen Mädchen, welches er begehrte. Der andere horchte ihm wenig interessiert zu und schlürfte von Zeit zu Zeit an seinem Bier. Bald war sein Krug leer und er hob die Hand, um der Wirtin zu zeigen, dass er ein weiteres benötigte. Hingegen war der Krug vor dem zweiten noch immer voll, denn der Mann erzählte ununterbrochen von der schönen Maid, sodass er sein Bier völlig vergaß. Asulon gönnte sich einen erneuten Schluck und drehte dann den Kopf wieder zu den Tischgenossen.
Sie hatten sich gerade in ein tiefes Gespräch verwickelt, über eines der wenigen Themen, die Asulon wirklich interessierten.
Magie.
Der eine mit den roten Locken schaute sich um und warf dann ein: „Ich glaube, diese schwarze Bestie, die da draußen ihr Unwesen treibt, ist bestimmt aus der Hand eines Zauberers entstanden. Sie zerstört Dörfer, greift Leute grundlos an. Eine normale wilde Bestie würde das niemals tun. Wölfe und Bären töten doch nur, um zu überleben, nicht aus Spaß?“ Die Männer nickten nachdenklich.
„Aber hast du jemals einen Magier gesichtet? Weißt du, ob es sie wirklich gibt?“ Asulon fixierte den Rothaarigen. Der Junge betrachtete ihn verdutzt und musste dann mit dem Kopf schütteln.
„Natürlich hast du noch nie einen Magier gesehen. Magie existiert nur in den Geschichten und Legenden, die im Land erzählt werden“, stellte Asulon fest.
Die Männer grummelten.
„Glaubst du etwa nicht daran? Unser Königreich ist entstanden mit der Hilfe magischer Meister. Der tapfere Ritter Restorian hätte ohne Magie das Land nie aus den Klauen von Zestor befreien können, denn der dunkle König selbst war ein begnadeter Hexenmeister“, warf einer der bejahrteren Männer ins Gespräch ein.
Asulon runzelte die Stirn. Magie. Wie oft hatte er darüber nachgedacht, wenn er alleine im Wald unterwegs war. „Das sind doch nur alte Geschichten. Ausgeschmückt in den Geschichten der Altbackenen“, konterte Asulon, „Oder habt ihr irgendwelche Beweise, dass Magie tatsächlich existiert?“
Die Männer grummelten in ihre Bärte und bedienten sich an ihren Krügen.
Es waren bereits etliche hundert Sommer ins Land gegangen, seit der Ritter Restorian die Menschen vom brutalen Großkönig Zestor befreien konnte. Es lagen einige Jahrhunderte zwischen dem damaligen Krieg und der jetzigen Zeit sodass die Legende um diesen mächtigen König bereits seit vielen Generationen ausgeschmückt und interessanter gestaltet wurde. Da kam es wohl schon vor, dass aus einfachen Kriegern große Magier, welche die Elemente beherrschten, entstehen konnten. Das war zumindest die Ansicht von Asulon. Und viele der jungen Leute aus dem Dorf teilten diese Anschauung. Die älteren Generationen mochten die Fantasie, dass Magier das Land beschützten.
Und einige wenige glaubten offenbar auch noch daran.
„Habt ihr irgendwelche Beweise, dass Magie nicht existiert, junger Mann?“, fragte eine tiefe starke Stimme.
Asulon blickte sich zu der Gestalt um, die abseits der Gäste saß und ihr Bier genoss. Ein heller Reiseumhang hüllte die Gestalt ein. Eine große Kapuze verbarg die Augen im Schatten, doch es war nicht abzustreiten, dass diese den jungen, vorwitzigen Burschen fixierten. Nebst dem hellen Umhang trug er schlichte Lederkleidung und dunkle Reitstiefel. Nicht sonderlich auffällig, und doch strahlte er eine gefährliche Autorität aus.
„Wer seid ihr? Reisender?“
Asulon spürte die verunsicherten Blicke der Gäste um sich.
Niemand hätte sich getraut, den gefährlich wirkenden Mann so direkt anzusprechen. Asulon jedoch hielt nicht viel von Regeln, welche die Gesellschaft ihnen auferlegte. Regeln, die besagten, dass ein einfacher Jäger, wie er es war, einem reich wirkenden Fremden hohen Respekt zollen sollte. Er war noch naiv und unerfahren und kannte die Welt außerhalb seines Dorfes nicht. Er konnte also auch nicht wissen, wen er vor sich hatte.
Der Mann unter der Kapuze ließ ein breites Grinsen zwischen seinem grauen Bart sehen. „Mein Name ist Merokk. Ich bin hier, weil ich Gerüchte über ein gefährliches, unbekanntes Tier vernommen habe. Und weil ich an Magie glaube.“
Asulon hob eine Augenbraue. „Vielleicht könnt ihr uns beweisen, dass Magie existiert, wenn ihr schon daran glaubt.“ Der Mann schob die Kapuze zurück.
Beinahe etwas enttäuscht stellte Asulon fest, dass er mehr erwartet hätte. Keinen grauen Haarschopf, der sittsam geschnitten und gepflegt war. Keine hellen, freundlichen grünen Augen.
„Ich brauche euch nichts zu beweisen. Ihr müsst für euch selbst erkennen, dass die Magie existiert. Überall. Ihr braucht gar nicht so weit zu suchen.“ Er nahm belustigt einen Schluck seines Bieres und sah dann die Männer an, die ihn neugierig musterten.
„Wer seid ihr? Woher kommt ihr?“, wollte nun ein anderer wissen. Seine Augen sahen den Fremden misstrauisch an.
„Ich sagte bereits: Mein Name ist Merokk. Ich komme aus Bellida, im Auftrag des Königs. Meine Aufgabe ist es, das Volk zu beschützen. Und, wie gesagt, hörte ich von einem Ungeheuer, das hier in der Nähe sein Unwesen treibt.“
Begeistert sahen die einfachen Männer des Dorfes den Mann an.
„Dann kennt ihr bestimmt viele Geschichten über die Königsfamilie. Über Restorian und seinen Orden?“, kamen die neugierigen Fragen aus dem Mund des roten Lockenkopfs neben Asulon. Asulon verdrehte die Augen, wartete jedoch darauf, was dieser Merokk dazu sagen würde.
Der Abgesandte des Königs sah in die Runde, während er überlegte, wie er beginnen sollte.
„Der Orden Restorians wurde vor beinahe fünfhundert Jahren gegründet, nachdem Restorian und seine Freunde im Kampf gegen Zestor siegreich hervorgegangen waren.
Restorian wurde der erste König der neuen Regelungen.
Iliemeram war vor Restorian ein großes Reich, das nach dem Krieg in drei Länder aufgeteilt wurde. Drei Länder, drei Könige. Paronas, der den Norden regierte, Eldron, der den Südosten regierte und Restorian. Restorian sammelte seine Freunde um sich als höchster königlicher Orden, die dem Volk beim Wiederaufbau des Reiches halfen. Der Orden existiert bis heute, auch wenn er weit weniger Mitglieder zählt als damals, denn das Aufnahmeverfahren bestehen die wenigsten. Der prüfende Blick auf die Seele. Wenn diese rein ist, frei von dunklen Gedanken, dann ist man im Kreis der Ritter aufgenommen.“ Merokk bedankte sich mit einem Kopfnicken bei der Wirtin, die ihm ein weiteres Bier hinstellte.
„Seht ihr? Ein prüfender Blick in die Seele. Das ist Magie!“, verkündete der Rotschopf mit Genugtuung. „Wenn man dem Wort eines Fremden Glauben schenken will“, mischte sich ein anderer Bursche ein, der Asulons Ansichten teilte.
„Ich kann genauso in deine Seele sehen und sie prüfen.
Und dieser Blick sagt mir, dass du ein leichtgläubiger Narr bist!“, fügte ein weiterer Mann hinzu und löste lautes Gelächter in der Schenke aus. Der Fremde indes sah den jungen Asulon lange nachdenklich an.
„Seid ihr ein Ritter dieses Ordens?“, wollte nun ein anderer wissen. Merokks Gesichtszüge verzogen sich kurz zu einem stolzen Lächeln, ehe er wieder eine ernste Miene aufsetzte.
„Ich habe die Prüfung bestanden. Das habt ihr richtig erkannt. Ich reite unter dem Banner Restorians.“ Asulon sah den Mann erneut an. Und nun entdeckte er ein goldenes Emblem auf dem schlichten Lederwams, das zuvor vom Umhang verdeckt worden war. Ein goldenes Tier, einem Pferd ähnlich.
„Ihr werdet diese Ausgeburt der Dunkelheit doch sicherlich erlegen“, mischte sich jemand in das Gespräch.
„Diese aus schwarzer Magie entstandene Kreatur!“,
spuckte der Rothaarige förmlich aus.
Merokk schüttelte den Kopf. „Schwarze Magie existiert nicht mehr. Nach Zestors Fall war sämtliche schwarze Magie mit einem mächtigen Zauber verbannt worden. In die Seiten eines Buches. Und dieses Buch ist seit jeher verschollen.
Niemand weiß, wo es ist.“ Asulon stieß einen leisen ungläubigen Laut aus.
Er war sich sicher, dass ein solch wertvoller, mächtiger Gegenstand bestimmt nie aus den Händen gegeben worden wäre. Außer die Geschichte war erstunken und erlogen.
Dieser Merokk war infolgedessen nichts mehr als ein Gaukler, der die Menge unterhalten konnte. Sicher kein Ritter. Er hatte noch nicht einmal ein Schwert bei sich.
Asulon nahm einen großen Schluck und leerte seinen Bierkrug. Wie gerne hätte er an die Magie geglaubt. Daran, dass man seine Umwelt verändern konnte, ohne große Anstrengungen. Es klang ziemlich abenteuerlich. Vielleicht war es eben diese Vorstellung, die ihn zweifeln ließ. Magie war ein zu großes Abenteuer, als dass sie wirklich hätte existieren können.
Er legte zwei Münzen auf den Tisch und verabschiedete sich von den Männern. Er hatte genug gehört, er brauchte nicht noch mehr von diesen Geschichten, die seine Abenteuerlust weiter anfachten. Eintöniges Brummen verfolgte ihn auf dem Weg, weg von dem Wirtshaus. So lange, bis er um die nächste Hausecke bog. Der Mond hing schräg, mitten im Himmel. Umgeben von den vielen tausend Sternen. Einige strahlender als die anderen. Es schien wohl bald wieder Vollmond zu sein, denn das Licht, welches von der beinahe runden Kugel auf die Erde geworfen wurde, war heller als sonst. Asulon hörte den steinigen Untergrund unter seinen Füßen knirschen. Vielleicht sollte er am nächsten Abend erneut in die Wälder aufbrechen, um nach einem schönen, jungen Hirsch Ausschau zu halten. Denn bei Vollmond kam es häufiger vor, dass die Hirsche des Nachts aufbrachen um zu fressen. Denn das Licht des Vollmondes war für sie genug, um ihre Umgebung zu beobachten und sich sicher zu fühlen. Seine braunen Augen wanderten noch einmal zum Mond hinauf und dann zurück auf das kleine Haus, in dem er lebte. Die Lichter waren bereits alle gelöscht worden. Sein Vater hatte sich offensichtlich schon hingelegt.
Asulon schlich um das Haus herum, in den Stall hinein.
Beinahe an jedem Abend ging er noch einmal in den Stall, um bei den beiden Pferden nach dem Rechten zu sehen.
Der Falbe kam an die Boxentür und streckte seine schwarzen Nüstern in Asulons Richtung. Asulon kraulte ihn sanft am Unterkiefer. Dann ging er zur braunen Stute hinüber. Diese stand reglos in ihrer Box; sie hatte den Kopf gesenkt, und mit einem trägen Blick betrachtete sie Asulon, als er sie störte. Sie schüttelte den Kopf, gähnte einmal ausgiebig, so dass jeder einzelne Zahn zu sehen war. Dann trottete sie zwei Schritte an die Tür und ließ sich noch ein wenig von Asulon verwöhnen. Er musste grinsen. Das war ihr tägliches Ritual. Immer, wenn er spät abends noch einmal zu ihnen kam, vollführte die braune Stute dieses Ritual.
Asulon hob kurz die Augenbrauen und verabschiedete sich dann von den beiden Tieren. Morgen würde erneut ein anstrengender Tag auf ihn zukommen.
In dieser Nacht machte der gestandene Fir Merokk kein Auge zu. Erschöpft saß er an dem kleinen Schreibtisch im Zimmer, das er in der Gastschenke gemietet hatte. Eine einzelne Kerze flackerte sanft neben ihm und spendete Licht. Immer wieder seufzte der Mann, während er nach Worten suchte, um seinem König die Lage im Süden zu erklären. Ursprünglich war er ausgesandt worden, um nach dieser dunklen Kreatur zu suchen, entdeckt hatte er allerdings weit mehr.
Männer und Frauen, die vergessen hatten, wer er war. Was er repräsentierte. Volk, das nicht mehr an die Magie glaubte und völlig abgeschottet für sich lebte. Nicht nur in diesem Dorf war ihm dieses Bild vor Augen geführt worden.
Mehrere Dörfer in den südlichen Bergen waren unwissend.
Die Fir, die Ritter des Königs, waren für sie nicht mehr als Geschichten, welche die Alten den Kindern erzählten. Sie wussten noch nicht einmal mehr, welchen Respekt sie einem Fir zollen mussten. Abermals schüttelte Fir Merokk seinen Kopf.
Der junge Bursche heute Abend ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Die hellen Augen, die ihn der Lüge bezichtigten, ihm kein Wort geglaubt hatten. Dabei war er der Neffe eines ehrenwerten Mannes. Der Neffe eines Ritters, wie er es war.
Fir Ruwien erzählte oft von einem Jungen, der nach seinem Großvater benannt worden war. Des Jungen Mutter, Fir Ruwiens Schwester, im Wochenbettgestorben war. Fir Ruwien hatte oft bedauert, den jungen Burschen namens Asulon nicht aufwachsen zu sehen. Er hatte ihn nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Damals, als seine Schwester ins Reich der Götter geleitet worden war. Da hatte er den Jungen gesehen. Den Säugling, der ohne Mutter aufwachsen würde.
Fir Merokk sah auf das Pergament vor sich. Noch hatte er nur wenige Worte geschrieben. Worte, welche die Situation im Süden knapp beschrieben. Er tauchte die Feder in das schwarze Tintenfass und setzte abermals an.
Wie sollte er den König warnen? Welche Worte wählen?