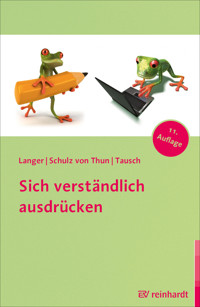
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Viele Bücher, Artikel, Vorträge etc. sind oft unverständlich und schwer lesbar. Mit nur vier Merkmalen der Verständlichkeit könnte man den Lesern und Zuhörern viel Mühe ersparen. Dieses Buch ist für alle geschrieben, deren Aufgabe es ist, andere zu informieren und Wissen zu vermitteln: Sie lernen mit vielen Textbeispielen und einem einfachen Trainingsprogramm, sich künftig verständlicher auszudrücken. Dabei zählen nicht nur die Sachinhalte, sondern auch die persönliche Haltung gegenüber Lesern und Hörern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Prof. Dr. Inghard Langer (1943–2013) lehrte bis 2008 Psychologie an der Universität Hamburg mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsförderung, Sprach- und Kommunikationspsychologie.
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedemann Schulz von Thun (Jahrgang 1944) lehrte Kommunikationspsychologie als Professor an der Universität Hamburg von 1975–2009. Seither Leiter des Schulz von Thun Institut für Kommunikation, Rothenbaumchaussee 20, 20148 Hamburg, www.schulz-von-thun.de
Prof. Dr. Reinhard Tausch (1921–2013) war Professor für Psychologie an der Universität Hamburg. Er galt als Wegbereiter der Gesprächspsychotherapie in Deutschland und hat die klientenzentrierte Psychotherapie hierzulande bekannt gemacht.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02532-9 (Print)
ISBN 978-3-497-61133-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61134-8 (EPUB)
11. Auflage
© 2019 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EUCovermotiv: © julien tromeur – Fotolia.comSatz: ew print & medien service gmbh, Würzburg
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 MünchenNet: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Teil I:Grundlagen und Übungen
Einleitung: „Das habe ich nicht verstanden“
Warum sind so viele Texte so schwer zu verstehen?
Warum drücken sich viele so schwer verständlich aus?
Wollen Sie lernen, sich verständlich auszudrücken?
Können Sie es lernen, sich verständlich auszudrücken?
Möchten Sie vorausschauen?
Was ist Verständlichkeit?
Merkmale der Verständlichkeit
Die Beziehungen zwischen den vier Merkmalen
Was gehört zu welchem Merkmal?
Die Beurteilung der Verständlichkeit
Eintragung in ein Beurteilungsfenster
Optimal verständliche Texte
Beurteilungsbeispiele
Beurteilungsfenster auswerten
Verständlich für wen?
Eine Vorausschau: Übungen in verständlichem Schreiben
Texte beurteilen – Übung I
Texte beurteilen – Übung II
Wie zutreffend ist Ihr Urteil? – Ihre Fähigkeit als Verständlichkeitsbeurteiler
Texte verbessern in einzelnen Merkmalen
Verbesserung in Einfachheit
Verbesserung in Gliederung/Ordnung
Verbesserung in Kürze/Prägnanz
Verbesserung in Anregenden Zusätzen
Texte verbessern in allen Merkmalen
Texte selbst verfassen
Teil II:Beispielsammlung: Leicht und schwer verständliche Texte
Einleitung: Was erwartet Sie in diesem Teil
Texte zu finanziellen Regelungen im Alltag
Vertragstexte
Gesetzestexte
Texte von Versicherungen
Texte zum Thema Rente
ISDN – ein Beispiel aus den neuen Informationstechnologien
Texte aus dem Schulunterricht
Von Lehrern verfasste Unterrichtstexte
Wissenschaftliche Texte
Teil III:Verständliche Texte im Unterricht
Einleitung: Verständlichkeit – notwendig, aber nicht ausreichend
Vorbereitung auf neue Informationen
Neue Informationen in verständlicher Form
Kleingruppenarbeit
Begegnung mit Fachleuten
Verständlicher schreiben heißt klarer denken
Teil IV:Personzentriert schreiben und reden
Einleitung: Was bedeutet personzentriert?
Der Autor oder Sprecher achtet seine Leser/Hörer, nimmt Rücksicht auf sie
Einfühlung in die seelische Situation des Lesers/Hörers
Aufrichtigkeit – Klärung eigener Gefühle und Gedanken – Selbstöffnung
Zusammenstellung wesentlicher Merkmale der personzentrierten Haltungen eines Autors/Redners gegenüber dem Leser/Hörer
Beispiele für personzentrierte und nicht-personzentrierte Texte
Texte gestalten mit personzentrierten Haltungen unter Beachtung der vier Verständlichkeitsmerkmale
Teil V:Wissenschaftliche Belege
Einleitung: Was erwartet Sie in diesem Teil
Alte und neue Wege der Verständlichkeitsforschung
Entdeckung der vier Verständlichkeitsmerkmale
Anwendung der vier „Verständlichmacher“
Ein Experiment, das der Wirklichkeit nahe kommt
Aktuell wie eh und je
Programmierte Lehrtexte – keine Alternative
Die Tauglichkeit unseres Übungsprogramms
Der Nutzen der Kleingruppenarbeit
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Wünsche zum Abschluss
Literatur
Vorwort
Wir hoffen sehr, dass der Tag nicht fern ist, an dem eine einfache, geordnete, kurz-prägnante und anregende Gestaltung von Texten und Reden Einzug in unseren tagtäglichen Umgang mit Informationen findet, beruflich wie privat, und insbesondere in den Schulunterricht, in Fachhochschulen und Universitäten. Nicht zu vergessen dabei die persönlichen inneren Haltungen, die für jegliche nachhaltig wirksame sprachliche Mitteilung unerlässlich sind: den Lesern, Hörern und sich selbst gegenüber achtungsvoll, einfühlsam und aufrichtig sein.
Eines Tages werden Textautoren, Lehrer, Professoren, Techniker und Politiker es kaum noch wagen, sich kompliziert auszudrücken. Denn Leser bzw. Hörer werden es sich nicht mehr bieten lassen, unnötig kompliziert informiert zu werden, weil sie wissen, dass Textund Reden-Gestalter sie nachlässig behandeln, sie gar missachten oder sich nicht die Mühe machen zu lernen, sich verständlich auszudrücken.
Dass dieses Buch entstand, verdanken wir der guten persönlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Nicht nur von uns drei Autoren, sondern auch von Diplomanden und Doktoranden der Psychologie; und schließlich auch von vielen an den Untersuchungen beteiligten Personen, die die Texte lasen und sich bereit fanden, ihre Behaltensleistungen anschließend prüfen zu lassen.
Vor 30 Jahren haben wir die ersten Forschungsergebnisse als Grundlage dieses Buches zur Verständlichkeit veröffentlicht. Jetzt liegt die 8. Auflage vor Ihnen, auf dem Weg dahin mehrfach verbessert und ergänzt.
Allen Darlegungen zur Verständlichkeit in diesem Buch, haben wir in zahlreichen Forschungsarbeiten wissenschaftlich überprüft.
Die Bedeutung von verständlichen Texten und Reden ist sehr groß. Millionen von Schülern, Studierenden, Millionen von Menschen in der Arbeit und im Privatleben müssen unnötig viel Zeit aufwenden und werden häufig verdrossen, weil die Schreiber vieler Texte, Lehrbücher, Gebrauchsanweisungen, von Gesetzen oder von Reden der Politiker sich nicht verständlich ausdrücken. Viele Millionen Menschen erleiden Nachteile, weil sie die kompliziert gehaltenen Texte/Reden nicht oder nur teilweise verstehen. So hatten wir Autoren selbst Schwierigkeiten, die Bekanntmachungen zur neuen Teilzeitarbeit oder zum Mietrecht zu verstehen (siehe S. 108ff).
Persönliche, innere Haltungen spielen beim Schreiben von Texten und Reden eine wichtige Rolle. Entscheidend sind Achtung und Wertschätzung des Lesers/Hörers, die Einfühlung in seine Situation und seine möglichen Schwierigkeiten mit den zu vermittelnden Sachverhalten sowie die Aufrichtigkeit im Umgang mit den Anliegen und Zielen in den Texten/Reden.
Viele Menschen halten sich für dumm und unintelligent, angesichts einer Fülle an Texten, die sie nicht verstehen können. Sie wissen nicht, dass vielfach Nachlässigkeit, Rücksichtslosigkeit oder Unfähigkeit der Texteschreiber dahinter stehen. Andere wiederum werden von kompliziert gehaltenen Texten/Reden zu sehr beeindruckt. Der Nobelpreisträger in Physik, Albert Einstein, beschrieb dies folgendermaßen: „Die meisten Menschen haben einen heiligen Respekt vor Worten, die sie nicht begreifen können; und betrachten es als ein Zeichen der Oberflächlichkeit eines Autors, wenn sie ihn begreifen können.“
Noch eine andere ungünstige Folge: Schwer verständliche Texte und Reden beeinträchtigen die Klarheit des Denkens, sowohl bei dem Schreibenden als auch bei dem Lesenden. Dies ist sehr wichtig: Schreiben wir schwer verständliche Texte oder lesen wir sie, dann haben wir mit vielen Hindernissen zu kämpfen im Verstehen des Textes und sind eingeschränkt in der Beurteilung, ob der dargestellte Sachverhalt richtig oder fehlerhaft ist.
Das vorliegenden Buch kann dazu verhelfen, die Fähigkeiten zum verständlichen Schreiben/Reden wirksam zu steigern. In seinem Mittelpunkt steht ein Trainingsprogramm, mit dem – wissenschaftlich nachgewiesen – deutliche Fortschritte erzielt wurden. Wesentliche Lernelemente darin sind:
► Beschreibungen, worauf es bei der verständlichen Textgestaltung ankommt.
► Beispieltexte ansehen, sowohl misslungene als auch gelungene.
► Beurteilung von Beispieltexten: Was konkret ist an ihnen gelungen bzw. misslungen?
► Gelungene Texte (als Vorbilder) studieren und sich ihre Gestaltungsart einprägen.
► Weniger gelungene Textpassagen umschreiben und verständlicher gestalten.
Wir empfehlen zur Verbesserung des eigenen Stils von Texten und Reden, sich von Lesern und Hörern so oft wie möglich Rückmeldung geben zu lassen. Mit ihren Hinweisen können selbst gelungene Texte/Reden in ihrer Verständlichkeit noch mannigfaltig verbessert werden.
Inghard LangerFriedemann Schulz von ThunReinhard Tausch
Teil I
Grundlagen und Übungen
Einleitung: „Das habe ich nicht verstanden“
Was hat uns veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Ein wichtiger Grund war: Uns selbst fiel es oft schwer, Sachbücher und Sachtexte richtig zu verstehen. Viele Stunden haben wir uns vergeblich bemüht, komplizierte Darstellungen zu begreifen. Oft waren wir verzweifelt und entmutigt. Einer von uns – Reinhard Tausch – erlebte besonders eindringlich die schlechte Verständlichkeit von Schulbüchern: „Es war für mich ein Schlüsselerlebnis. Meine eigenen Kinder baten mich des Öfteren bei ihren Schularbeiten um Hilfe, in Erdkunde, Physik, Geschichte oder Fremdsprachen. Aber auch ich konnte ihre Schulbücher nicht verstehen. Ich konnte ihnen anhand ihrer Lehrtexte z. B. nicht erklären, was es mit den Strahlengesetzen oder der Mondfinsternis auf sich hatte – obwohl ich Professor an einer Universität war.“
Ein zweiter wichtiger Grund für unser Buch: Wir hatten oft in Schulen beobachtet, dass ein Teil der Lehrer sich ziemlich unverständlich ausdrückte – auch bei einfachen Informationsinhalten. Daraus ergaben sich viele Schwierigkeiten zwischen Lehrern und Schülern. Die Schüler erreichten nur geringe Leistungen und waren – ebenso wie ihre Lehrer – unzufrieden mit dem Unterricht. Da nützte es auch nichts, wenn ein Lehrer freundlich und hilfsbereit war und sich den Schülern gegenüber partnerschaftlich verhielt – das konnte seine Schwerverständlichkeit nicht ausgleichen. Mancher Lehrer drohte zu scheitern, nur weil er nicht geübt war, sich verständlich auszudrücken.
Und drittens: Auch außerhalb von Schule und Hochschule gibt es oft Gelegenheit, zu sagen: „Das habe ich nicht verstanden.“ Denn vieles Wichtige wird geschrieben und gesprochen: von der Arbeitsplatzbeschreibung bis zur Zukunftsplanung, über Neuigkeiten in der Welt, Beschreibungen von Vorgängen, Erklärungen von Sachverhalten, Regelungen von Rechten und Pflichten. All dies zu einer Fülle von Gebieten: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Hygiene, Recht, Zusammenleben. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Formulare, Protokolle, Prospekte, Broschüren sind voll davon.
Jeder Bürger muss viel lesen und verstehen, um sachkundig handeln zu können. Aber das wird ihm nicht leicht gemacht. Er muss sich hindurchbeißen durch verschachtelte Satzkonstruktionen und durch unnötig komplizierte Wörter und Wortgebilde. Er muss verworrene Gedankengänge der Autoren mitmachen und ihnen bei den Irrfahrten weitschweifiger und umständlicher Erklärungen folgen. Hier stöhnt fast jeder. Viele bleiben auf der Strecke. Etliche geben es ganz auf, sich zu informieren.
Das ist schade; denn wer sich unzureichend informiert, wird leicht benachteiligt – in materieller Hinsicht und in der Nutzung von Rechten. Hunderttausende von Arbeitnehmern z. B. lassen sich größere Geldbeträge entgehen, wenn es um den Lohnsteuerjahresausgleich oder das prämienbegünstigte Sparen geht. Die Antragsformulare und die Erläuterungen dazu sind zu schwer verständlich. Sie schrecken viele ganz ab und verhindern bei anderen – weil nur Teile verstanden werden – die volle Nutzung gesetzlich geschaffener Vorteile.
Denken wir weiterhin an Schulbücher, Hochschultexte, Fernlehrkurse, behördliche Verordnungen, Politik- oder Wirtschaftsteile anspruchsvoller Zeitungen, an die Verkündung neuer Ideen über Staat und Gesellschaft, an Gebrauchsanweisungen für Haushaltsgeräte – dann steht uns das Problem in seiner ganzen Bedeutung plastisch vor Augen: die Schwerverständlichkeit von Texten.
Warum sind viele Texte so schwer zu verstehen?
Früher glaubten wir, unsere Verständnisschwierigkeiten lägen an uns selbst – an unserer mangelnden Begabung, komplizierte Sachverhalte zu begreifen. Oft hörten wir auch das Argument: „Der Grund für Schwerverständlichkeit liegt in der Sache. Schwierige Dinge lassen sich eben nicht einfach erklären.“
Als wir uns aber näher mit dem Problem der Verständlichkeit befassten, gewannen wir allmählich einen anderen Eindruck. Heute ist unsere Auffassung: Wenn ein Text schwer zu verstehen ist, so liegt das in den wenigsten Fällen an seinem Inhalt. Der Inhalt ist meistens gar nicht so kompliziert. Er wird erst kompliziert gemacht – durch eine schwer verständliche Ausdrucksweise. Und auch wirklich schwierige Sachverhalte lassen sich bei einigem Bemühen oft mit einfachen Worten verständlich erklären. Schwerverständlichkeit beruht weniger auf dem Was, sondern auf dem Wie, nicht auf dem Inhalt, sondern auf der Form eines Textes.
Warum drücken sich viele so schwer verständlich aus?
Manchen ist das Problem gar nicht bewusst. Sie schreiben darauflos, wie ihnen die Sätze und Worte einfallen, wie ihnen „der Schnabel gewachsen ist“. Sie berücksichtigen nicht, wie ihre Ausdrucksweise beim Leser ankommt.
Andere Schreiber oder Redner streben absichtlich Schwerverständlichkeit an. Sie glauben, ein schwer zu verstehender Text mache mehr Eindruck und erwecke Ehrfurcht und Achtung beim Leser oder Zuhörer. Indem sie sich schwer verständlich ausdrücken, wollen sie sich als Personen mit großen geistigen Fähigkeiten darstellen. Wir hoffen, dass in Zukunft eine solche Textgestaltung keine Ehrfurcht mehr erweckt, sondern den Eindruck: Dieser Autor ist ziemlich rücksichtslos oder unfähig, sich in seine Leser und Zuhörer hineinzuversetzen. Wir hoffen, dass Leser und Zuhörer künftig nicht mehr bereit sind, diese Art des Schreibens und Redens hinzunehmen, dass sie es vielmehr leid sind, unnötig und zusätzlich zu arbeiten, um einen Text zu „entschlüsseln“.
Wieder andere Schreiber oder Redner drücken sich absichtlich schwer verständlich aus, weil sie ihre Leser oder Zuhörer in Unwissenheit belassen wollen, z. B. um sie zu übervorteilen. So ist das Kleingedruckte in manchen Verträgen auch „kleinverständlich“. Wir finden es wichtig, dass Leser und Hörer erkennen: Mangelnde Verständlichkeit dient möglicherweise dazu, ungerechte Vorteile zu tarnen.
Den Hauptgrund für Schwerverständlichkeit sehen wir jedoch darin: Die meisten wissen gar nicht, wie man sich verständlich ausdrückt. Sie haben es nicht gelernt. In der Schule z. B. wird dies ja kaum behandelt.
Wollen Sie lernen, sich verständlich auszudrücken?
„Natürlich“, werden Sie denken, „darum lese ich ja dieses Buch!“ Trotzdem bitten wir Sie, dass Sie sich folgende Fragen einmal überlegen. Denn nur, wenn Sie die Fragen bejahen können, werden Sie einen Gewinn von diesem Buch haben:
Achte ich die Zeit und die Arbeitskraft meiner Leser, Hörer oder Schüler? Schätze ich sie als ebenso wertvoll ein wie meine eigene? Bin ich wirklich besorgt darum, anderen nicht zusätzliche Mühen aufzubürden durch Schwerverständlichkeit?
Versuche ich, mich in meine Leser und Hörer hineinzuversetzen? Wie ist ihre Situation, welche Erfahrungen haben sie, was fällt ihnen schwer, was brauchen sie?
Wenn meine Leser und Hörer mich nicht verstehen – bin ich bereit, die Gründe dafür zunächst bei mir selbst zu suchen?
Kann ich ehrlich zu mir selbst sagen, dass ich mich vielleicht nicht intensiv genug um Verständlichkeit bemüht habe?
Wenn Sie Fachtexte für bestimmte Gruppen schreiben, z. B. als Wissenschaftler, so kann noch Folgendes wichtig sein:
Habe ich genug Selbstbewusstsein, meine Ideen, Auffassungen und Schlussfolgerungen einfach und bescheiden darzustellen, ohne sie hinter einer imponierenden Fassade von Schwerverständlichkeit zu verstecken?
Habe ich genug Mut und Selbstbewusstsein, es zu ertragen, wenn ich auf Grund meiner leicht verständlichen Texte von einigen Kollegen als weniger kompetent angesehen werde?
Können Sie es lernen, sich verständlicher auszudrücken?
Ja. Wenn Sie den Wunsch haben, dass Ihre schriftlichen oder mündlichen Informationstexte künftig besser zu verstehen sind, so können Sie mit Hilfe dieses Buches Ihr Ziel erreichen. Es bietet Ihnen wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Antworten auf folgende Fragen:
Was ist überhaupt „Verständlichkeit“? Worin unterscheiden sich leicht verständliche von schwer verständlichen Texten?
Wie lernt man, sich verständlich auszudrücken?
Was ist – neben einer verständlichen Ausdrucksweise – bei der Informationsvermittlung noch zu bedenken?
Welche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es, die unsere Theorie der Verständlichkeit abstützen?
Möchten Sie vorausschauen?
Vielleicht sind sie neugierig, wie kompliziert Vertragstexte, Gesetzestexte, Schulbuchtexte sind und wie viel verständlicher und leichter leserlich sie gestaltet werden können. Dann blättern Sie doch einfach in der Beispielsammlung, S. 95–143.
Was ist Verständlichkeit?
Was zeichnet einen verständlichen Text aus? Durch welche Merkmale lässt er sich charakterisieren?
Bitte überlegen Sie zunächst selbst einmal. Lesen Sie dazu die folgenden beiden Texte. Sie enthalten die gleiche Information, unterscheiden sich jedoch stark in der Art der Darstellung. Es handelt sich um ein Beispiel aus der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung.
Text A
§ 57 StVZO: „Die Anzeige der Geschwindigkeitsmesser darf vom Sollwert abweichen in den letzten beiden Dritteln des Anzeigebereiches – jedoch mindestens von der 50 km/st-Anzeige ab, wenn die letzten beiden Drittel des Anzeigebereiches oberhalb der 50 km/st-Grenze liegen –0 bis +7 vom Hundert des Skalenendwertes; bei Geschwindigkeiten von 20 km/st und darüber darf die Anzeige den Sollwert nicht unterschreiten.“
Text B
§ 57 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung: Um wie viel Prozent darf eine Tachometeranzeige von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abweichen?
1. Für den Bereich von 0 bis 20 km/st bestehen keine Vorschriften.
2. Ab 20 km/st darf der Tachometer nicht weniger anzeigen.
3. Für Tachometer, deren Skala bis 150 km/st reicht, gilt: Sie dürfen in den beiden letzten Dritteln des Anzeigebereiches höchstens 7% ihres Skalenendwertes mehr anzeigen.
Beispiel: Ein Tachometer reicht bis 120 km/st. Von 40 bis 120 km/st darf er höchstens 7% von 120 km/st (= 8,4 km/st) zu viel anzeigen.
4. Wenn der Tachometer über 150 km/st reicht, beginnt die 7%-Regelung schon ab 50 km/st.
Bitte charakterisieren Sie nun stichwortartig diese beiden Texte, so wie sie auf Sie gewirkt haben:
Text A hat folgende Eigenschaften:
Text B hat folgende Eigenschaften:
Bitte sehen Sie sich nun die Wortliste an. Sie stammt von anderen Beurteilern. Sie werden Ähnlichkeiten mit ihrer Eigenschaftsliste bemerken:
Text A
Text B
kompliziert im Satzbau
einfache Sätze
ungeläufige Wörter
geläufige Wörter
unanschaulich
etwas länger
kurz
gut gegliedert
ungegliedert
mit Beispiel
holprig
kurze Sätze
verschachtelt
flüssig
lange Sätze
anregend
ohne Beispiel
übersichtlich
ungruppiert
gruppiert
Diese Listen ließen sich ohne weiteres noch verlängern. Aber bald würden Sie feststellen: Viele Eigenschaften besagen etwas Ähnliches – z. B. „gegliedert“ und „gruppiert“.
Wir haben darum die ähnlichen Eigenschaften zu vier größeren Komplexen zusammengefasst. Diese Komplexe nennen wir von nun an die
Merkmale der Verständlichkeit
1. Einfachheit
2. Gliederung/Ordnung
3. Kürze/Prägnanz
4. Anregende Zusätze.
Sie werden nun ausführlich erläutert.
Einfachheit
Einfachheit bezieht sich auf die Wortwahl und den Satzbau, also auf die sprachliche Formulierung: geläufige, anschauliche Wörter sind zu kurzen, einfachen Sätzen zusammengefügt. Treten schwierige Wörter auf (Fremdwörter, Fachausdrücke), so werden sie erklärt. Dabei kann der dargestellte Sachverhalt selbst einfach oder schwierig sein – es geht nur um die Art der Darstellung.
Das folgende Merkmalsbild zeigt in übersichtlicher Form, welche einzelnen Eigenschaften das Merkmal „Einfachheit“ umfasst. Es enthält auch das Gegenteil von Einfachheit: Kompliziertheit. Was die Plus- und Minuszeichen bedeuten, erklären wir später.
Einfachheit
+ + + 0 – – –
Kompliziertheit
einfache Darstellung
komplizierteDarstellung
kurze, einfache Sätze
lange,verschachtelte Sätze
geläufige Wörter
ungeläufige Wörter
Fachwörter erklärt
Fachwörternicht erklärt
konkret
abstrakt
anschaulich
unanschaulich
■ Ein Beispiel für Einfachheit
Die folgenden beiden Texte „Was ist Raub“ unterscheiden sich wesentlich in ihrer Einfachheit, dagegen kaum in den drei anderen Merkmalen der Verständlichkeit.
Was ist Raub?
Komplizierte Fassung
„Raub ist dasjenige Delikt, das jemand durch Entwendung eines ihm nicht gehörenden Gegenstandes unter Anwendung von Gewalt oder von Drohungen gegenüber einer anderen Person begeht, sofern die Intention der rechtswidrigen Aneignung besteht.“
Einfache Fassung
„Jemand nimmt einem anderen etwas weg. Er will es behalten. Aber es gehört ihm nicht. Beim Wegnehmen wendet er Gewalt an oder droht dem Anderen, dass er ihm etwas Schlimmes antun werde. Dieses Verbrechen heißt Raub.“
Gliederung/Ordnung
Dieses Merkmal bezieht sich auf die innere Ordnung und die äußere Gliederung eines Textes.
Innere Ordnung: Die Sätze stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind folgerichtig aufeinander bezogen. Die Informationen werden in einer sinnvollen Reihenfolge dargeboten.
Äußere Gliederung: Der Aufbau des Textes wird sichtbar gemacht. Zusammengehörige Teile sind übersichtlich gruppiert, z. B. durch überschriftete Absätze. Vor- und Zwischenbemerkungen gliedern den Text. Wesentliches wird von weniger Wichtigem sichtbar unterschieden, z. B. durch Hervorhebungen oder durch Zusammenfassungen.
Gliederung/Ordnung
+ + + 0 – – –
Ungegliedertheit,Zusammenhangslosigkeit
gegliedert
ungegliedert
folgerichtig
zusammenhangslos, wirr
übersichtlich
unübersichtlich
gute Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem
schlechte Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem
der rote Faden bleibt sichtbar
man verliert oft den roten Faden
alles kommt schön der Reihe nach
alles geht durcheinander
Hervorhebungen sind in diesem Buch fett oder kursiv gedruckt oder farblich abgesetzt. Bei Schreibmaschinenschrift oder bei Handschrift empfehlen sich: Unterstreichungen, gesperrt schreiben oder Verwendung von Großbuchstaben. Das Merkmal Gliederung/Ordnung fasst sowohl die innere Ordnung als auch die äußere Gliederung zusammen. Denn beide bewirken, dass der Leser oder Zuhörer sich zurechtfindet und die Zusammenhänge sieht.
■ Ein Beispiel für Gliederung/Ordnung
Was ist Raub?
Ungeordnete Fassung
„Jemand wendet gegen einen anderen Gewalt an. Das ist Raub, es gehört ihm nämlich nicht. Er will es für sich behalten, was er ihm wegnimmt. Zum Beispiel ein Bankräuber, der dem Angestellten mit der Pistole droht. Auch wenn man jemandem droht, dass man ihm etwas Schlimmes antun will, ist es Raub.“
Gegliederte Fassung
„Raub ist ein Verbrechen: Jemand nimmt einem anderen etwas weg, was ihm nicht gehört. Er will es behalten. Dabei wendet er Gewalt an oder droht dem Anderen etwas Schlimmes an. Drei Dinge sind wichtig:
1. etwas wegnehmen, was einem nicht gehört
2. es behalten wollen
3. Gewalt oder Drohung
Beispiel: Ein Bankräuber droht dem Angestellten mit der Pistole und nimmt sich das Geld.“
Sie sehen: In der ersten Fassung „geht alles durcheinander“, in der zweiten Fassung ist „alles schön geordnet“ und das Wesentliche hervorgehoben. Schon bei diesen ziemlich kurzen Texten erhöht Gliederung/Ordnung spürbar die Verständlichkeit. Noch wichtiger ist dieses Merkmal bei längeren Texten. Denn je länger der Text, desto leichter kann man die Übersicht verlieren.
Kürze/Prägnanz
Bei diesem Merkmal geht es um die Frage: Steht die Länge des Textes in einem angemessenen Verhältnis zum Informationsziel? Eine knappe, gedrängte Ausdrucksweise ist das eine Extrem, eine ausführliche und weitschweifige das andere. Solche Weitschweifigkeit beruht z. B. auf: Darstellung unnötiger Einzelheiten, überflüssige Erläuterungen, breites Ausholen, Abschweifen vom Thema, umständliche Ausdrucksweise, Wiederholungen, Füllwörter und leere Phrasen.
Kürze/Prägnanz
+ + + 0 – – –
Weitschweifigkeit
kurz
zu lang
aufs Wesentliche beschränkt
viel Unwesentliches
gedrängt
breit
aufs Lehrzielkonzentriert
ausführlich
knappjedes Wort istnotwendig
abschweifendvieles hätte manweglassen können
■ Ein Beispiel für Kürze/Prägnanz
Was ist Raub?
Weitschweifige Fassung
„Ja, Raub, das darf man nicht machen. Raub ist ein verbotenes Verbrechen. Man darf es nicht mit Diebstahl verwechseln. Diebstahl ist zwar auch ein Verbrechen, aber Raub ist doch noch etwas anderes. Angenommen, jemand raubt etwas. Was heißt das? Das heißt: Er nimmt einem anderen etwas weg, was ihm nicht gehört, um es für sich zu behalten. Das ist natürlich nicht erlaubt. Jetzt muss aber noch etwas hinzukommen: Während der Verbrecher die Sache wegnimmt, wendet er Gewalt an gegenüber dem Anderen, zum Beispiel: er wirft ihn einfach zu Boden – oder er schlägt ihn bewusstlos, dass er sich nicht mehr wehren kann. Es kann aber auch sein, dass er nur droht, dem Anderen etwas anzutun. Auch dann ist es Raub, und der Mann (oder die Frau) wird wegen Raubes bestraft.“
Kurz-prägnante Fassung
„Ein Verbrechen. Wer einem anderen etwas wegnimmt, was ihm nicht gehört, um es zu behalten, begeht Raub. Hinzukommen muss, dass er dabei gegen den anderen Gewalt anwendet oder ihn bedroht.“
Anregende Zusätze
Dieses Merkmal bezieht sich auf anregende „Zutaten“, mit denen ein Schreiber oder Redner bei seinem Publikum Interesse, Anteilnahme, Lust am Lesen oder Zuhören hervorrufen will. Zum Beispiel: Ausrufe, wörtliche Rede, rhetorische Fragen zum „Mitdenken“, lebensnahe Beispiele, direktes Ansprechen des Lesers, Auftretenlassen von Menschen, Reizwörter, witzige Formulierungen, Einbettung der Information in eine Geschichte.
Anregende Zusätze
+ + + 0 – – –
Keine Anregenden Zusätze
anregend
interessant
abwechslungsreich
persönlich
nüchtern
farblos
gleichbleibend neutral
unpersönlich
■ Ein Beispiel für Anregende Zusätze
Was ist Raub?
Nichtanregende Fassung
„Jemand nimmt einem anderen etwas weg. Er will es behalten, obwohl es ihm nicht gehört. Beim Wegnehmen wendet er Gewalt an oder er droht dem Anderen, dass er ihm etwas Schlimmes antun werde. Dieses Verhalten (Wegnehmen mit Gewalt oder Drohung) heißt Raub. Raub wird mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft.“
Anregende Fassung
„Nimm an, du hast keinen Pfennig Geld in der Tasche. Aber was ist das? Da geht eine alte Dame mit ihrer Handtasche über die Straße. Du überlegst nicht lange: ein kräftiger Schlag auf den Arm, und schon bist du mit der Tasche auf und davon. ‚Haltet den Dieb!‘, ruft die Dame, weil sie es nicht besser weiß. Richtiger müsste sie rufen: ‚Haltet den Räuber!‘, denn wenn man dabei Gewalt anwendet oder Drohungen ausstößt, dann ist es Raub.
Und wie endet die Geschichte? Nun, meistens endet sie im Knast.“
Die Beziehungen zwischen den vier Merkmalen
Diese vier Merkmale sind ziemlich unabhängig voneinander. Ist ein Text z. B. einfach, so sagt das noch nichts über die anderen Merkmale aus. Er kann z. B. gut gegliedert und sehr weitschweifig oder ungegliedert und sehr kurz sein usw.
Nicht vollständig unabhängig voneinander sind die Merkmale Kürze/Prägnanz und Anregende Zusätze. Denn Anregende Zusätze verlängern den Text. Der Sprecher oder Schreiber befindet sich in einem Konflikt: Kürze oder Anregung? Ein Ausweg ist: Die Anregenden Zusätze sind selbst kurz sowie ganz auf das Informationsziel ausgerichtet.
Was gehört zu welchem Merkmal?
Wir stellen Ihnen jetzt eine Aufgabe. Sie können damit überprüfen, ob Ihnen die Bedeutung der vier Merkmale ganz klar geworden ist. Bitte betrachten Sie die folgende Liste! Jede Eigenschaft in dieser Liste gehört zu einem der vier Merkmale. Aber zu welchem? Das herauszufinden ist Ihre Aufgabe.
Das Beispiel am Anfang der Liste zeigt Ihnen, wie Sie es machen sollen: Die Eigenschaft „Viele Fremdwörter“ charakterisiert in negativer Weise das Merkmal „Einfachheit“. Denn Fremdwörter sind ungeläufige Wörter, Einfachheit ist aber durch „geläufige Wörter“ gekennzeichnet. Darum steht hinter „Viele Fremdwörter“ die Ergänzung „Einfachheit –“. Machen Sie es nun ebenso für die übrigen Eigenschaften:
Schreiben Sie hinter jede das Merkmal, zu dem sie gehört.
Geben Sie durch „+“ oder „–“ an, ob eine Aussage ein Merkmal in positiver oder negativer Weise charakterisiert.
Vergleichen Sie dann mit den richtigen Zuordnungen auf der nächsten Seite.
Eigenschaft
gehört zum Merkmal
Beispiel: Viele Fremdwörter
Einfachheit–
1. Wichtige Sachen sind gut hervorgehoben.
2. In dem Text sind kurze, anregende Vergleiche.
3. In dem Text geht alles durcheinander.
4. Sehr abstrakt.
5. Nichts ist überflüssig.
6. Der Rote Faden bleibt immer sichtbar.
7. Man langweilt sich beim Lesen.
8. Das hätte man kürzer bringen können.
9. Im Text sind kurze Beispiele.
10. Der Autor weicht nie vom Thema ab.
11. Der Leser kann jeden Satz gut verstehen.
12. Man weiß nicht, was man sich einprägen soll.
13. Der Text enthält wörtliche Rede.
14. Viele Nebensätze.
15. Alles kommt schön der Reihe nach.
16. Manches hätte man weglassen können.
17. Viele Fachausdrücke.
18. Viele Füllwörter.
19. Komplizierter Satzbau.
20. Manchmal weiß man nicht, wie das in den Zusammenhang passt.
■ Richtige Zuordnungen
Hier die „Auflösung“. Wenn Sie mehrere Fehler gemacht haben, lesen Sie bitte noch einmal die Beschreibungen der Merkmale ab Seite 16 durch.
Eigenschaft
gehört zum Merkmal
Beispiel: Viele Fremdwörter
Einfachheit–
1. Wichtige Sachen sind gut hervorgehoben.
Gliederung/Ordnung+
2. In dem Text sind kurze, anregende Vergleiche.
Anregende Zusätze+
3. In dem Text geht alles durcheinander.
Gliederung/Ordnung–
4. Sehr abstrakt.
Einfachheit–
5. Nichts ist überflüssig.
Kürze/Prägnanz+
6. Der Rote Faden bleibt immer sichtbar.
Gliederung/Ordnung+
7. Man langweilt sich beim Lesen.
Anregende Zusätze–
8. Das hätte man kürzer bringen können.
Kürze/Prägnanz–
9. Im Text sind kurze Beispiele.
Anregende Zusätze+
10. Der Autor weicht nie vom Thema ab.
Kürze/Prägnanz+
11. Der Leser kann jeden Satz gut verstehen.
Einfachheit+
12. Man weiß nicht, was man sich einprägen soll.
Gliederung/Ordnung–
13. Der Text enthält wörtliche Rede.
Anregende Zusätze+
14. Viele Nebensätze.
Einfachheit–
15. Alles kommt schön der Reihe nach.
Gliederung/Ordnung+
16. Manches hätte man weglassen können.
Kürze/Prägnanz–
17. Viele Fachausdrücke.
Einfachheit–
18. Viele Füllwörter.
Kürze/Prägnanz–
19. Komplizierter Satzbau.
Einfachheit–
20. Manchmal weiß man nicht, wie das in den Zusammenhang passt.
Gliederung/Ordnung–





























