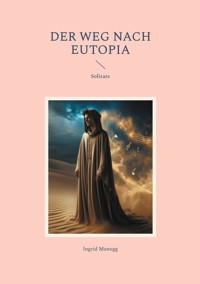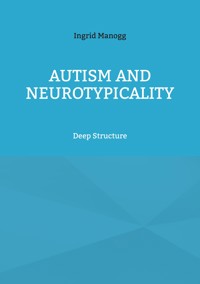Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lithadora
- Sprache: Deutsch
Unheil bricht über die Schwesternschaft ein, mit Lithadoras Freiheit ist es vorbei. Sie muss sich prüfen lassen und gerät in üble Machenschaften. Als sie dem schönen Romuald begegnet, glaubt sie, ihren Platz gefunden zu haben. Doch vielleicht trügt der Schein... Ein poetisches Märchen, voll Esprit und feinem Humor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein schöner Sommer
Der Regen
Die silberne Lichtung
Die Prüfung
Das Haus der Wünsche
Gerettet
Castan ist verschwunden
Das durchsichtige Gewand
Die Späherinnen
Der kleine Vogel
In der Stadt
In der Herberge
Gefährliches Spiel
Rückweg
Der Karren
Die neuen Schwestern
Erwischt
Das Verhör
Im Gefängnis
Entlassen
Unterwegs
Litha
Lunator
Romuald
Das Badehaus
Jenseits der Hügel
Im Großen Haus
Über die Wiesen
Fieber
Mentha
Pläne
Pferdewahl
Hände
Zwischenstation
Wahre Liebe
Wieder im Schloss
Fulmia
Wieder im Turm
Lamento
Suche
Mir ist, ich wär‘ auf meinen Reisen,
Gelaufen immer nur in Kreisen.
Zwar konnte ich viel Schönes sehn,
Und viele neue Wege gehn,
Doch niemals, nicht mit stärkstem Willen,
Die tiefe Sehnsucht in mir stillen,
Nach dem, was früher einmal war,
Es schien mir einst so wunderbar.
Jetzt bin ich hier, am richtgen Ort,
Und will nur eines:
Wieder fort.
Lithadora
Ein schöner Sommer
Tief im Wald, auf einer großen Lichtung, standen fünfzehn einfache Holzhütten. Darin wohnten jeweils drei Schwestern in einer eigenen Kammer, ausgestattet mit Bett, Tischchen, einem Stuhl und einer Truhe. Die Türen knarrten, die Trennwände waren dünn. Jedes Seufzen, jedes Gähnen, jedes Lachen drang durch die Planken; Kerzenschein fand den Weg durch die feinsten Ritzen. Lithadora hatte sich auch nach einem halben Jahr noch nicht daran gewöhnt.
Den Winter und Frühling über hatte sie sich begeistert auf alles gestürzt, was es zu lernen gab. Wie ein Schmetterling war sie umhergeflattert, hatte sich hier im Schneidern geübt, da im Schreinern, im Kochen, Brot backen, Kerzen gießen, Laute spielen, Feuer machen …
Doch nichts hatte ihre Aufmerksamkeit lange zu fesseln vermocht. Ständig schweiften ihre Gedanken zu Castan, ihrem kastanienbraunen Pferd, oder sie verlor sich in Geschichten, die sie sich ausdachte.
Als der Sommer anbrach, mit langen und warmen Tagen, hielt Lithadora sich kaum noch auf der Lichtung auf. Gekleidet wie ein Mann ritt sie ohne Sattel und Zaumzeug kreuz und quer durch den Wald. Manchmal blieb sie tagelang weg.
»Entferne dich nicht zu weit von uns«, ermahnten die Schwestern sie immer wieder. »Es ist nicht, weil du dich verirren könntest. Aber du könntest jemanden auf unsere Fährte locken.«
»Ich bin vorsichtig«, versprach Lithadora. »Niemand wird mich bemerken.«
Längst kannte sie die Stellen, an denen Beeren reiften, Kräuter wuchsen oder Bäume Früchte trugen. Wenn sie es nicht vergaß, füllte sie ihren ledernen Beutel mit allerlei Essbarem, das nicht in der Nähe der Lichtung gedieh, und brachte es den Schwestern. Sie pfiff und zwitscherte mit den Vögeln, die keinerlei Scheu vor ihr zeigten. Wenn diese verstummten oder der Eichelhäher warnend rief, nahm sie sich in Acht; sie wusste, dann war etwas Größeres unterwegs. Ein Bär, ein Wolf oder gar ein Mensch …
Ich streife, freier als ein Ritter,
Durch Regen, Nebel und Gewitter,
Durch Sonnenschein und Sturm,
Brauch keine Burg und keinen Turm,
Nicht Herrn und keine Knappen,
Nicht Fahne, Waffen oder Wappen,
Nicht Sattel, Zügel oder Sporen,
Denn ohne dies sind wir geboren.
Kein Streben, Jagen, Horten, Haben,
Kein Herrschen, Wünschen, Finden, Laben,
Nur Staunen, Wundern über Gaben.
Kein Ring, kein Ding kann das enthalten,
Was Blüte treibt, sich zu entfalten.
Bislang waren die Schwestern freundlich zu ihr gewesen. Doch allmählich begannen sie über ihre ständige Abwesenheit zu murren und drängten auf eine Verlängerung der Probezeit. »Erst hat sie sich alles von uns zeigen und beibringen lassen, und nun drückt sie sich vor den einfachsten Tätigkeiten … Sie hält sich wohl für eine Prinzessin … Oder für einen Edelmann, so wie sie reitet …«
Immerhin schienen ihre Mitbewohnerinnen ihr weiterhin wohlgesonnen. Vor allem Nula, die nur wenige Wochen vor ihr eingetroffen war, suchte ihre Nähe. Sie war auffallend hübsch, trug stets vornehme Gewänder unter einem unauffälligen Umhang und duftete nach einem exquisiten Parfüm, von dem sie unzählige Fläschchen besaß. Sie unterwies die Schwestern in Gesellschaftstänzen, trug höfische Gesänge vor oder erzählte von prächtigen Kleidern, großartigen Bällen und von der liebenswürdigen Königin, der sie als Zofe gedient hatte. Ihre Vergangenheit schien durch und durch schön und gut gewesen zu sein. Lithadora langweilten ihre weitschweifigen Ausführungen.
Auch Mentha, die dritte Bewohnerin der Hütte, war noch nicht lange bei der Schwesternschaft. In ihrer grauen, sackartigen Kutte wirkte sie fast unförmig, dabei war sie so schmal wie Lithadora und aß nichts außer Kräutern und trocken Brot. Nachts schrie sie des Öfteren auf, als plagten sie schlechte Träume. Ansonsten gab sie kaum einen Laut von sich. Täglich suchte sie die Priesterin auf und betete mit ihr. Es hieß, sie sei eine entlaufene Klosterschülerin und fürchte sich vor der Strafe Gottes.
Weder Nula noch Mentha verließen je die Lichtung. Sie zeigten keinerlei Interesse an Pferden, an Lithadoras Geschichten oder an dem Verfahren, welches sie entwickelt hatte, um wahre Wünsche zu erkennen.
So verschwendete Lithadora keine weiteren Gedanken an die beiden.
Der Regen
Kurz nach dem Erntedankfest zogen dunkle Wolken auf und es begann heftig zu regnen. Ohne Unterlass prasselten die Tropfen herab. Nach und nach verwandelte sich die Lichtung in einen Sumpf. Durch die Hütten tropfte es, alles wurde feucht und klamm. Fieberhaft stopften die Schwestern die Ritzen in den Dächern und legten Decken über die Vorräte. Dennoch drang das Wasser von oben und von unten ein und die meisten Nahrungsmittel verdarben. Gemauerte Feuerstellen wurden etwas tiefer im Wald neu angelegt, wo das sich bunt verfärbende Blätterdach noch ein wenig Schutz bot.
Ende Oktober hatte es immer noch nicht aufgehört zu regnen. Erste Stürme schüttelten die Bäume. Ein Blatt nach dem anderen wirbelte davon, bis die Äste kahl in den grauen Himmel ragten. Lithadora unternahm nur noch kurze Ausflüge, um ihr Pferd nicht zu gefährden. Abends legte sie ihm die Decke über, die sie aus dem Schloss mitgenommen hatte, und ließ es sich frei seinen Platz wählen. Danach lief sie zu der Feuerstelle, an der Raga, eine der vier Späherinnen, und Martha, die gutmütigste der Schwestern, saßen. Sie hockte sich zwischen sie und überreichte ihnen, was sie im Wald an Essbarem gefunden hatte.
Eines Tages kehrte Lithadora mit leerem Beutel von ihrem Ausritt zurück. »Ich habe keine einzige Beere mehr gefunden«, sagte sie, während sie sich am Feuer niederließ. »Geschweige denn Nüsse oder Kräuter. Die Bäche sind zu Flüssen angeschwollen, überall rauschen Wind und Wasser. Selbst die stärksten Bäume schwanken, Äste brechen. Und alle Tiere sind verschwunden.«
Raga nickte. »Die Jägerinnen haben schon lange nichts mehr gefangen, und auch die Fallen bleiben leer.«
»Es ist eine Katastrophe«, klagte Martha. »Ich lebe hier schon seit über zehn Jahren und habe so etwas noch nie erlebt. Wir müssen einen Notfallplan entwickeln.«
Martha war groß und füllig. Sie liebte es zu kochen, zu braten, zu backen und vor allem, zu essen. Gierig griff sie nach dem Spieß, an dem ein mageres Kaninchen über den unruhig flackernden Flammen schmorte. Es war schwärzlich verfärbt, ein dumpfiger Geruch stieg von ihm auf.
Während Martha kaute, knirschte und knackte es, und sie schmatzte …
Lithadora wandte den Blick ab. Schon als Kind hatte sie Fleisch verschmäht. Was hatte die Herrin ihr immer gesagt? »Wenn du keine Tiere essen magst, so iss keine. Aber lass andere mit deiner Abneigung in Ruhe. Stell dir einfach vor, die Fleischesser verspeisten Gräser und Körner. Denn davon nähren sich die Tiere, die sie essen, und das Pflanzliche ist in deren Fleisch übergegangen. Raubtiere und Menschen können Pflanzen nicht gut verarbeiten, so nutzen sie Pflanzenfresser als Vorverdauer. Vor allem Männer, die harte körperliche Arbeit verrichten oder kämpfen, brauchen die schnelle und nachhaltige Energiezufuhr. Fleisch ist für sie wie Hafer für Pferde. Ich weiß, dir tun die Tiere leid. Doch auch Pflanzen mögen nicht gegessen werden, nur ihre Früchte stellen sie uns zur Verfügung, damit wir die innenliegenden Samen und Kerne verbreiten. Weißt du, auch Pflanzen kämpfen gegeneinander, sie nehmen sich Licht, Raum und Nährstoffe. Genau wie wir sind sie weder gut noch böse. Auch sie versuchen einfach zu überleben und ihre Verwandten zu schützen.«
Lithadora war nicht überzeugt. Das Leid in den Augen der Tiere ist unübersehbar, dachte sie, es ist so viel leichter zu erkennen als in einem Grashalm. Wie kann man nur so kalt sein und sie töten! Zumal es viele Männer gibt, die weder kämpfen noch harte körperliche Arbeit verrichten. Sie essen Fleisch einfach aus Gewohnheit oder um den Anschein zu erwecken, stark und tätig zu sein.
Endlich hatte Martha auch das letzte Knöchelchen abgenagt. Lithadora atmete auf. Erst jetzt fiel ihr auf, dass niemand außer ihnen am Feuer saß. »Wo sind denn die anderen?«, fragte sie verwundert.
»Regenscheu«, erwiderte Raga. »Oder krank. Die Heilkräuter sind ausgegangen.«
»Uns schützen unsere Umhänge«, erläuterte Martha und tippte an ihre Kapuze, von der die Tropfen herabrannen. »Sie halten die Nässe ab und wärmen. Und sie trocknen schnell. Nicht alle unserer Schwestern sind so gut ausgestattet.«
»Etwas ist seltsam an diesem Dauerregen«, sagte Raga nachdenklich. »Auf unseren Erkundungsritten haben wir festgestellt, dass jenseits des Waldes das Wetter weiterhin gut ist.«
»Das klingt nach einem Zauber«, meinte Martha überrascht.
Raga zuckte die Achseln. »Damit kenne ich mich nicht aus. Wir Späherinnen kümmern uns um die praktischen Angelegenheiten. Heute Morgen sind wir durch die Hütten gezogen und haben alle verbliebenen Wertgegenstände eingesammelt. Leider wird ihr Erlös nicht reichen, um den Winter zu überstehen.«
»Wir werden alle sterben!«, rief Martha verzweifelt.
»Fang bloß nicht an zu jammern«, wies Raga sie zurecht. »Wir könnten Lithadoras Ross verkaufen. Es ist von edelster Rasse, und sie nutzt es nur zu ihrem Vergnügen.«
Empört sprang Lithadora auf. »Niemals werde ich Castan hergeben!«
Raga lachte rau. »Noch ist es nicht soweit. Von mir aus kannst du dein Pferd einstweilen behalten. Aber gewöhne dich an den Gedanken, dass wir Schwestern füreinander einstehen. Vielleicht ist es eines Tages soweit, dass du deine Loyalität zu uns beweisen musst.«
Ohne zu klopfen trat Nula in Lithadoras Kammer. »Du packst?«, fragte sie verblüfft. »Willst du uns verlassen? Hast du dich nicht für sieben Jahre der Schwesternschaft verpflichtet? Ach nein, sie haben ja deine Probezeit verlängert …«
»Sie wollen mir mein Pferd nehmen!«, rief Lithadora aufgebracht. »Um es zu verkaufen!«
»Ich gab mein goldenes Kreuz«, sagte Mentha, die unvermittelt in der Tür stand. Ihre zarten Gesichtszüge wirkten wie eingefroren. »Mein Herz, mein Lieb. Es war alles, was mir blieb.«
Lithadora starrte sie an. »Verlang es zurück!«
»Sollen wir etwa verhungern?« Nula blickte Lithadora vorwurfsvoll an. »Versteh doch. Wir in der Schwesternschaft müssen zusammenhalten. Ich habe mich von meinen schönsten Kleidern und von meinem Geschmeide getrennt. Ich schmücke mich nun in Gedanken. Und Mentha kann sich ein Holzkreuz schnitzen. Gott wird uns unsere Bescheidenheit lohnen.«
»Gott …«, sagte Lithadora gedehnt. »Wisst ihr, dass Martha es für möglich hält, dass ein Zauber gewirkt wurde?«
Mentha nickte. »Auch die Priesterin glaubt das«, sagte sie. »Unsere Dschinn- und Feen-Frauen haben vor einigen Tagen ihre Fähigkeiten aktivieren dürfen. Doch weder konnten sie das Wetter ändern noch dessen Ursache finden. Daher haben sie Kontakt zur nächstgelegenen Misch-Schaft aufgenommen. Du weißt, in einer Misch-Schaft leben sowohl Brüder als auch Schwestern, und die meisten von ihnen sind Drimas. Sie sind viel mächtiger als die Besten unter uns. Jedenfalls sind zwei von ihnen zu uns unterwegs. Sie bringen Vorräte mit. Und sie werden uns alle prüfen und dafür sorgen, dass der Regen endlich aufhört.«
»Wann können wir mit ihrer Ankunft rechnen?«, fragte Nula.
Mentha antwortete nicht. Ihr Vorrat an Worten schien aufgebraucht.
Lithadora blickte die beiden unschlüssig an. Dann räumte sie ihren Beutel wieder aus.
Die silberne Lichtung
Auf ihren Streifzügen durch den Wald verließ Lithadora sich ganz auf ihr Pferd. Es schien genau zu wissen, wohin es seine Hufe setzen musste, von welchen Bäume die Äste zu brechen drohten und an welchen Stellen sie die schnell strömenden Bäche sicher überqueren konnten.
Eines Tages führte Castan sie zu einer Nebelwand. Sie wirkte so dicht, als wäre sie undurchdringlich. Wie im Traum ritt Lithadora hinein. Raum und Zeit verschwammen.
Unvermittelt fand sie sich an einem lichten Ort wieder. Er war auf wundersame Weise vor Wind und Regen geschützt. Ein zarter Schleier stieg vom Boden auf und umhüllte Birken und Haselnussbäume, es herrschte eine fast unwirkliche Stille. Ein Teich schimmerte glatt und reglos wie ein Spiegel.
Lithadora fand frische Birkenblätter und unzählige Nüsse. Sie waren so wohlschmeckend und nahrhaft wie die Beeren von einem Immerfruchtstrauch. Auch das Gras, das Castan fraß, schien überaus sättigend. Eine blasse Sonne verbreitete silbernes Licht, in der Nacht wandelte sie sich zum Mond.
Drei Tage vergingen. Lithadora lehnte an einer Birke, die Augen mit Silber gefüllt. Kaum noch konnte sie etwas erkennen, alle Konturen schienen sich aufzulösen. Wenn sie etwas berührte, griffen ihre Hände hindurch. Erst als Castan ihr seinen warmen Atem ins Gesicht blies und auffordernd schnaubte, verfestigte sich ihre Wahrnehmung wieder. Es war Zeit, zurückzukehren.
Jenseits der Nebelwand flog der Regen im aufheulenden Sturm fast waagerecht. Sie kamen nur langsam vorwärts, immer wieder wechselte Castan die Richtung.
Es war später Abend, als sie die Feuerstellen erreichten. Alle Flammen waren erloschen. Stattdessen schaukelte eine Laterne an einem starken Ast. Darunter waren an langen Stricken drei auffallend edle Pferde angebunden, zwei Rappen und ein Fuchs. Hell wieherten sie Castan entgegen. Er gesellte sich zu ihnen, als gehörten sie zusammen.
Geduckt rannte Lithadora zu ihrer Hütte. Nula erwartete sie schon. »Na endlich!«, rief sie. »Die Drimas haben nach dir gesucht. Du sollst morgen hierbleiben und dich für die Prüfung zur Verfügung halten!«
Die Prüfung
Die Prüfung fand in der ältesten und größten Hütte statt. Martha und ihre Mitbewohnerinnen waren vorübergehend zu den Jägerinnen gezogen. Sie hatten eine der Kammern geräumt, nur drei Stühle standen noch darin und ein kleiner Tisch. Die Fenster waren geschlossen, Kerzen verbreiteten mildes Licht. Obwohl der Wind durch die Ritzen pfiff, war die Luft stickig und verraucht, das Holz der Balken roch feucht.
»Setz dich«, sagte ein Mann mit tiefer Stimme. Er trug einen schwarzen Umhang, sein Gesicht blieb im Schatten der Kapuze verborgen. Neben ihm saß eine dunkelbraun gekleidete, zierliche Frau. Ihre Augen blickten kühl.
»Lithadora. Ein Kunstname … Was verbindest du damit?«, begann sie mit einer Stimme, schneidend wie eine Messerklinge.
Lithadora zuckte zusammen. »Alle Namen sind letztendlich Kunstnamen«, gab sie zurück. »Wie nennt ihr euch?«
»Antworte.«
Sie fühlte sich unbehaglich. War das etwa ein Verhör? Wie lange mochte es wohl dauern? Es war schon später Nachmittag, und sie wollte noch nach Castan sehen.
Bring es hinter dich, ermahnte sie sich.
Die Zusammensetzung und Bedeutung ihres Namens hatte sie schnell erklärt. Doch anschließend musste sie erzählen, woher sie ihr Pferd hatte. Ehe sie sich versah, hatte sie mehr von ihrer Herkunft verraten, als ihr lieb war. Danach wurde sie zu ihren Erfahrungen mit Drimas, Dschinn und Feen befragt. Die Prüfer wirkten ungerührt, fast desinteressiert. Erst bei der nächsten Frage beugten sie sich eine winzige Spur vor.
»Verfügst du über irgendwelche geistigen oder zauberischen Fähigkeiten?«
»Nein«, entgegnete Lithadora. »Deswegen bin ich ja auch bei allen durchgefallen, bei den Drimas, bei den Dschinn und bei den Feen. Ich wurde verbannt, saß sieben Jahre auf einem Felsen!«
»Das hast du nur geträumt. Aber was ist mit dem lichten Ort?«
Verblüfft hielt Lithadora inne. Dann wurde ihr klar, dass die Drimas sich nicht an die Regeln der Schwesternschaft hielten und ihre inneren Bilder absuchten.
»Auch nur geträumt«, sagte sie schließlich.
»Du gehst gern deine eigenen Wege, nicht wahr?«, setzte die Prüferin nach. »Du trägst Männerkleidung, hast keine Freundinnen, du tanzt für dich alleine, du beteiligst dich kaum an den Arbeiten oder an Geselligkeiten. Zweifelst du den Sinn der Schwesternschaft an?«
»Ich bin einsam aufgewachsen und es gewöhnt, mich zurückziehen«, verteidigte Lithadora sich. »Bitte bedenkt, ich habe den Weg hierher gefunden, weil ich hierhin gehöre. Ich wurde geleitet. Ich mag anders sein als andere, doch jeder Mensch ist anders als die anderen. Vielleicht schließe ich mich eines Tages den Späherinnen an. Die tragen ebenfalls Männerkleidung.«
»Beschreibe uns das Haus der Wünsche, dein Verfahren, wahre Wünsche zu erkennen. Wir haben nicht viel Zeit. Fang an.«
Das Haus der Wünsche
»Es geht um Freiheit.« Lithadora rutschte auf dem Stuhl hin und her und rang nach den richtigen Worten. »Um die Freiheit, uns zu wünschen, was wir uns wirklich wünschen, statt uns zu wünschen, was wir uns wünschen sollen.
Im Haus der Wünsche lass dich nieder,
Geschützt der Raum, frei von Geraun,
Von Angst und Scham und Schuld.
Hier kannst du dir und mir vertraun,
Hier herrscht unendliche Geduld.
Hier regen sich die Wünsche wieder,
Sie blitzen auf aus dunklem Grund.
Was treibt, was zieht, was heftig sehnt,