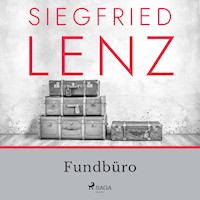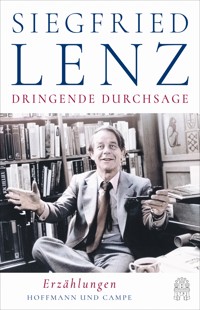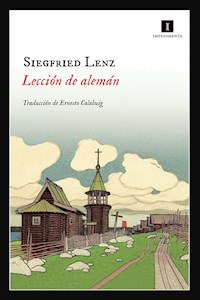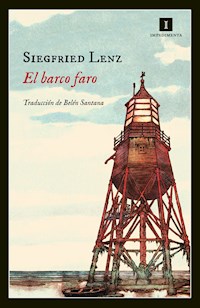Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hamburg war für Siegfried Lenz (1926–2014) weit mehr als Wohnort – die Stadt prägte sein Leben und sein Schreiben über Jahrzehnte. Hier begann er 1946 sein Studium, arbeitete für den Nordwestdeutschen Rundfunk und die Zeitung die "Welt", lernte seine Frau Liselotte kennen und wurde schließlich zum Wahlhamburger und Ehrenbürger der Stadt. Das Lesebuch »Siegfried Lenz. Hamburg.«, herausgegeben von Günter Berg und Maren Ermisch, versammelt Texte, die Hamburg in all seinen Facetten zeigen: von Schwarzmarktgeschichten der Nachkriegszeit über das Leben am Hafen, in einem Altenheim bis zu Romanen wie »Der Mann im Strom« oder Erzählungen wie »Leute von Hamburg«. Auch essayistisch setzte sich Lenz mit der Hansestadt auseinander – mit ihrem Charakter, ihrer Verantwortung oder mit seinem Leben als Hamburger Schriftsteller. So entsteht ein lebendiges Panorama: Hamburg als Bühne der Literatur und als Lebensraum eines der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hamburg
Ein Lesebuch
Herausgegeben von
Günter Berg und Maren Ermisch
Mit einem Nachwort von Günter Berg
Siegfried
Lenz
Hamburg
Ein Lesebuch
wachholtz
Inhaltsverzeichnis
Dankrede zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Hamburg am 14. Februar 2001
Aus den Bekenntnissen eines Schwarzhändlers
Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt
Hafengeschichten
Der Hafen ist voller Geheimnisse
Der Anfang von etwas
Hafengeburtstag
Leute von Hamburg
Lena und Kuddel
Die neuen Stützen der Gesellschaft
Leute von Hamburg
Der Usurpator
Siegfried Lenz und Hamburg
Porträt einer Schutzgöttin
Ich und meine Straße
Rede auf dem Rathausmarkt
Nachwort
Textnachweis
Dankrede zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Hamburg am 14. Februar 2001
Ich bin nicht in Hamburg geboren, bin nicht einmal auf einer Fähre oder einem Stückgut-Frachter zur Welt gekommen, die zwischen dieser Stadt und Harwich oder Newcastle on Tyne verkehrten, – den Anspruch also, auf hansischem Hoheitsgebiet zum ersten Mal die Augen aufgeschlagen zu haben, kann ich nicht stellen.
Aus dem Osten komme ich, aus einer kleinen Stadt in Masuren, weit im Rücken der Weltgeschichte, – dorther, wo Schicksalsdemut und listige Heiterkeit den Alltag kennzeichneten und wo der wunderbare Diminutiv, also die Zärtlichkeitsform, unser Verhältnis zur Welt bestimmte. […]
Doch so entlegen diese Welt auch war, – wir erfuhren schon, daß es draußen, hinter dem Horizont, Bedeutendes gab, einmalige Zentren des Lebens, legendäre Städte an großen Strömen, auch eine bedeutende Stadt namens Hamburg. Aufgeklärt durch Hörensagen, ein wenig auch durch Lektüre, und nicht zuletzt: verführt durch meine frühe Hingezogenheit zum Wasser, machte ich mir ein Bild von Hamburg in meiner Vorstellung. Wie immer weckte Ferne die Übertreibungslust. Ich stellte mir einen Wald von Schiffsmasten vor, die bis in den Himmel wuchsen; ich stand staunend vor unabsehbaren Lagerschuppen, in denen sich die Kostbarkeiten ferner Länder türmten; ich nahm kaltblütig teil an der Enthauptung von Seeräubern – keine andere Stadt war ja so erfolgreich in der Bekämpfung der Piraterie –, und ich machte mir ein Bild backenbärtiger Reeder, die eine goldene Uhrkette überm Bauch trugen. Nah herangeträumt, stellte ich mir hier – wo sich ja so vieles dem Meer verdankt – das Rathaus schwimmend vor, schwimmend auf verläßlichen Pontons – und ich hielt es sogar für möglich, daß Hamburger Mädchen nach Ambra dufteten.
Hamburg, von meiner kleinen Welt Masuren aus gesehen: da schwimmen die sogenannten Brotfische ins Bild, Kabeljau und Schellfisch; da wird vor Festungsmauern gekämpft; da lassen Wikinger, Dänen und Franzosen ihre Muskeln spielen, und da wird früh – zum Schutz der einheimischen Flotten –, die Convoy-Schifffahrt eingeführt. Hamburg war für mich das, was ich in meiner Vorstellung, mit meinem begrenzten Wissen für möglich hielt. Die konkrete Wirklichkeit der Stadt, die heute längst zu meiner Stadt geworden ist, – ich lernte sie 1945 kennen, in dem heißen Sommer nach dem Krieg. Ich war Dolmetscher in einer englischen Entlassungs-Einheit (66. Disbandment-Control-Unit); wir fuhren von Stadt zu Stadt, stellten ordentliche Entlassungsscheine für die deutschen Soldaten aus, die aus dem Krieg einfach nach Hause gegangen waren. Mehrmals durchquerten wir dabei Hamburg oder vielmehr seine unglaubliche, tragische Hinterlassenschaft. In der furchtbaren Stille einer Geisterlandschaft sah ich skelettierte Häuser und gesprengte Brücken, zu beiden Seiten der Straßen sah ich nur aufgeschichtete brandschwarze Ziegel, ich sah zerstörte Bahnstationen und die zerbröckelnden Ruinen ganzer Stadtteile. Schweigend, vor allem schweigend verlief meine erste Begegnung mit dieser einst mächtigen, mit Respekt und Bewunderung genannten Stadt. Vor meinen Augen hoben sich unwillkürlich aus geschichtlicher Dämmerung die Trümmer alter, sagenhafter Städte, die, verbrannt, geschleift, gesprengt, dem Vergessen anheim gegeben schienen. Wie wird man hier wieder leben können, so fragte ich mich angesichts des Resultats einer vermessenen, tobsüchtigen Politik, und ich fragte mich auch: wann wird man hier wieder leben können.
Und ich stand am Hafen, dort, wo das vermutete Herz Hamburgs schlägt; ich stand am Rande eines monströsen Friedhofs. Ich sah die zahlreichen Spieren gesunkener Schiffe, an denen sich die Strömung staute, die zerschmetterten Kaimauern sah ich und die abgesoffenen Docks. Ins Bizarre verrenkt muteten die Werften an, zerrissene Schiffsteile bezeugten die Wut der Explosionen, und wie in endgültiger Trauer geknickt erschienen mir die Kranhälse. Hamburgs stolzer Beiname schien nicht mehr zuzutreffen; das »Tor zur Welt« war blockiert, jedenfalls nicht passierbar; gelbe Wracktonnen überall signalisierten Gefahr.
Wiederum fragte ich mich: wie nur kann dieser unmeßbare Schrott der Geschichte beseitigt werden, und ich fragte mich auch: Wann wohl wird der Hafen dieser Stadt mit den mehr als siebenhundert Häfen in aller Welt verbunden sein, – wie einst, wie in vergangener Zeit. Über dies große Aufräumwerk zu schreiben: schon damals entstand bei mir die Idee, und später habe ich darüber geschrieben, mehrmals, tief beeindruckt vom Mut, von der Ausdauer und der Risikobereitschaft Hamburger Taucher.
Ich war neunzehn Jahre alt, Besitzer eines fabelhaften Vermögens von 1200 Zigaretten, die mir englische Soldaten nach der Auflösung der Einheit geschenkt hatten, und wo alle einen Anfang suchten in dieser unverzagten Stadt, beschloß auch ich, anzufangen. Ich bekam kein Zimmer, wohl aber einen Studienplatz, jeden Morgen fuhr ich von Bargteheide zu meinen Vorlesungen und Seminaren, so mancher von uns trug eingefärbte Uniformteile, auch einige Professoren trugen sie. Ich empfand Achtung und Zuneigung für einige meiner Professoren, deren Fürsorge die ganze studentische Existenz umfaßte: Kleidung, Nahrung, auch kleine Nebenverdienste. Was ich selbst immer so gern hatte werden wollen: Lehrer wurde ich allerdings nicht. Keine Schulklasse habe ich mit meinem bedachtsamen Zweifel infiziert, vor keiner Klasse habe ich für das Überlebensprinzip Vernunft geworben. Ich wurde Journalist.
Englische Freunde ermunterten mich, in ihrer damaligen Besatzungszeitung zu arbeiten, und ich absolvierte ein kurzes Volontariat in der »Welt« und wurde Redakteur. Ich hatte sehr gute Lehrer, welterfahrene Journalisten in englischer Uniform. Ich denke in Dankbarkeit an Captain Willy Haas, der einst in den zwanziger Jahren in Berlin »Die literarische Welt« gegründet hatte, jene legendäre Zeitschrift, in der die besten Schriftsteller Europas schrieben; er stammte aus Prag, war über England und Indien nach Hamburg gekommen. Willy Haas wurde mein Mentor. Etliche amerikanische Schriftsteller haben bei Gelegenheit zugegeben, wie viel sie dem Journalismus verdanken, auch ich bin mir bewußt, welch eine gute Schule er für mich, für den jungen Autor war.
Vor fünfzig Jahren erschien mein erstes Buch; seitdem falle ich unter die Berufsbezeichnung Schriftsteller.
[…]
Seit mehr als fünfzig Jahren lebe und schreibe ich in Hamburg. Meine Frau ist Hamburgerin, sehr nahe Freunde, sehr liebe Freunde sind Hamburger. Schon werde ich, wenn ich in Kopenhagen rede oder Saarbrücken, in Boston Massachusetts oder in Flensburg als Hamburger Schriftsteller eingeführt. Anscheinend imprägniert diese Stadt die Menschen, die länger in ihr leben, macht sie auf diskrete Weise kenntlich. Um den Geist, um das innere Wesen einer Stadt zu erfahren – so sagte mein amerikanischer Kollege Truman Capote – mußt du in ihr entweder drei Tage oder aber dreißig Jahre gelebt haben. Nun, ich bin weit über dies Limit hinaus, und deshalb glaube ich, das bemerkt zu haben, was Hamburger und Nicht-Hamburger das Hamburgische nennen. Es als activa lobend aufzuzählen, widerspräche allerdings Hamburger Eigenart; ich möchte es darum genug sein lassen mit dem Bekenntnis, daß, wenn ich noch einmal wählen dürfte, ich ohne zu zögern die Entscheidung wiederholen würde, die ich vor fünfzig Jahren getroffen habe.
Aus den Bekenntnissen eines Schwarzhändlers
Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt
I
Die Not ist meine schönste Zeit. Schon früh erkannte ich, welche Möglichkeiten der Mangel birgt, die Knappheit an allen Dingen: schon als Schüler war mir der Unterschied vertraut zwischen Haben und Nicht-Haben, und nicht nur dies: ich habe einen Gaumen für spezifische Not, spüre eine gewisse schöpferische Erregbarkeit, sobald irgendwo ein quälender Bedarf besteht, kurz gesagt, Armut ist mein höchstes Glück. Nichts inspiriert mich tiefer als die Not der anderen, niemals ist meine Phantasie so zuverlässig, als wenn es darum geht, den Mangel der anderen zu beheben – schon als Junge merkte ich es. Ich merkte es beispielsweise, wenn sich meine jüngere Schwester, sobald sie nichts mehr hatte, Sahnebonbons von mir lieh: bereitwillig half ich ihr aus der Verlegenheit, allerdings mußte sie diese Verlegenheit extra bezahlen. Ich bekam die doppelte Anzahl von Bonbons zurück. Und ich stieß auf die schöpferischen Möglichkeiten des Mangels, als sich mein Vater gegen Monatsende den Rest meines Taschengeldes pumpte, zögernd zuerst, dann mit einträglicher Regelmäßigkeit; ich half ihm, wo ich konnte, denn er zahlte pünktlich fünfzig Prozent Zinsen und war mir sicher.
So erwarb ich bereits im zarten Alter die Erkenntnis, daß die Not viele Vorzüge hat, und daß sie den, der auf sie baut, nicht nur ernährt, sondern auch in seinen Begabungen fördert. Denn Begabung ist nötig, um all die Chancen wahrzunehmen, die sich aus dringendem Mangel ergeben.
In Zeiten des Überflusses stirbt die Phantasie, nichts wird uns abverlangt an Überlegung, an Abenteuer, an Ungewißheit: wem es an irgend etwas mangelt, der drückt die Klinke des nächsten Geschäfts und deckt seinen Bedarf. Diese Zeit ist nicht meine Zeit. Wie einfallslos, wie degeneriert und unkünstlerisch erscheint unser Markt: überschwemmt von Angeboten, überwacht von Preisbehörden, besucht von Leuten, die jederzeit wissen, was sie brauchen und wieviel sie für die Mark bekommen. Überall ist man sich des Wertes gewiß und des Gegenwertes; keine Unsicherheit, kein Zaudern und blitzartiges Zupacken, und auf allen Gesichtern, die ich auf dem weißen Markt des Überflusses sehe, liegt die gleiche Freudlosigkeit, die gleiche träge Selbstgewißheit und der gleiche Überdruß. Die Sinne sind nicht mehr geschärft, das helle, räuberische Bewußtsein ist nicht mehr auf Beute gerichtet: die große Zeit ist vorbei, die Zeit der wundervollen Not.
Damit ist meine Zeit vorbei: der Überfluß hat alle meine Begabungen außer Kraft gesetzt, der Wohlstand hat meine Fähigkeiten verkümmern lassen – alles, was mir bleibt, ist die Erinnerung und die Sehnsucht. Ja, an kühlen Abenden habe ich oft Sehnsucht nach der Zeit der Not, erinnere ich mich an das Abenteuer meines Marktes – des Schwarzen Marktes –, und stumm vor Rührung denke ich an den Ruhm, den ich mir damals erwarb. Der Schwarze Markt war mein Metier.
Ich war für ihn geschaffen, wie Churchill für den Posten eines Kriegspremiers geschaffen war. Meine Fähigkeiten wurden immer vollkommener, und ich näherte mich meiner Vollendung. Schon begann man sich in einigen Hamburger Kreisen ehrenvolle Namen für mich auszudenken, als der Tag hereinbrach, der meine gesamte Muskulatur lähmte: der 20. Juni 1948, der schmähliche Sonntag der Währungsreform.
Seitdem habe ich gewartet, gehofft, daß meine große Zeit wiederkehre – bisher ist sie nicht wiedergekehrt. Ich finde nur noch den Trost der Erinnerung. Erinnerung ist das einzige, was mich wach und aufrecht hält, doch da auch sie – ich spüre es – mehr und mehr an Schärfe verliert wie alte Fotografien, möchte ich alles aufschreiben, zum Nutzen eines Gleichgesinnten, für mich selbst aus Notwehr. Wäre ich ein Dichter wie Whitman, würde ich sagen: »Ich singe den Schwarzen Markt« –, doch ich bin nur ein Künstler des Mangels, und ich möchte nur aufschreiben, wie alles gewesen ist: mein Markt, mein Ruhm, mein Untergang. Ich möchte, da ich die nötige Schwermut des Erzählers zu besitzen glaube, anfangen, wo es begann, und enden, wo einstweilen alles endete.
Zuerst kamen Autos mit hohen Offizieren vorbei, Tag und Nacht; dann kamen Omnibusse mit nicht sehr hohen Offizieren, dann Pferdewagen und zum Schluß staubgepuderte Soldaten ohne Waffen, die Tag und Nacht an dem Gutshof vorbeimarschierten, in dem unser Marinestab damals untergebracht war. Die Offiziere in den Autos und Omnibussen sahen enttäuscht aus, saßen mit schweigender Bitterkeit in den Lederpolstern, während die Soldaten uns zuwinkten und lachten und riefen, daß der ganze Mist vorbei sei. Alle, die müde und lachend vorbeimarschierten, riefen es uns zu, Tag und Nacht, und schließlich muß es unser Admiral gehört haben, denn er nahm sein Auto und fuhr enttäuscht weg. Und nachdem er weg war und die waffenlosen Soldaten nicht aufhörten zu rufen, daß der ganze Mist vorbei sei, setzte sich unser Korvettenkapitän mit den verschiedenen Leutnants in den Omnibus und fuhr ebenfalls enttäuscht weg. Für den Bootsmann war kein Pferdewagen da, so verließ er uns zu Fuß, und während draußen noch immer Soldaten vorbeimarschierten, rief der letzte Stabsgefreite die Schreiber und Burschen zusammen und erklärte uns, daß nun alles vorbei sei. Er führte uns ins Magazin und forderte uns auf, von den Sachen so viel zu nehmen, wie wir tragen konnten, denn hinterher wollte er den Rest in die Luft sprengen. Wir suchten hastig nach Sahnemilch, nach Kognak, Zigaretten und Büchsenschokolade – aber seltsamerweise fanden wir nur Sauerkraut in Dosen und Erbsen und allenfalls fettes Schweinefleisch. Die besseren Sachen mußten offenbar termingerecht ausgegangen sein. Als ich mit meinem Seesack ankam, war nicht einmal mehr fettes Schweinefleisch da, und ich suchte verzweifelt herum, bis ich eine riesige Pappkiste fand, die man offenbar auch schon vor mir entdeckt, doch, weil nichts darin zu finden gewesen war, mit Fußtritten in eine Ecke geschubst hatte, denn quer über die Kiste zogen sich Schrammen von Stiefelsohlen hin – wie Stigmen der Enttäuschung. Ungeduldig öffnete ich die Kiste, sah, daß sie gefüllt war mit Sahnelöffeln, Hunderten von Sahnelöffeln in rosa schimmerndem Seidenpapier, und gerade als ich ihr den letzten Fußtritt geben wollte, rief der Stabsgefreite von unten, daß die Sprengung vorbereitet sei. Verzweifelt sah ich mich um; nichts war in der Nähe als Sauerkraut und ein Gebirge von grauer RIF-Seife, deren Anblick schon genügte, um ein Schaudern hervorzurufen. So zwängte ich – vor der Wahl: entweder ohne etwas umzukehren oder mit dem absurden Reichtum der Sahnelöffel in Sicherheit zu gelangen (denn etwas mußte ich doch mitnehmen) – zwängte ich also die Pappkiste mit Hunderten von Sahnelöffeln in meinen Seesack, schwang ihn auf die Schulter, brach nahezu unter dem Gewicht zusammen, doch die Gefahr, die bereits Hölderlin in ähnlichem Zusammenhang erwähnte, gab mir die rettende Kraft: ich ließ den Seesack die Treppe hinunterfallen und sprang hinterher, gerade noch rechtzeitig genug. Später, nach der Sprengung, habe ich die Löffel gezählt, es waren zweihundertvierzig, oder zwanzig Dutzend, und mit ihnen auf dem Rücken zog ich die Straßen, die auch die lachenden Soldaten gezogen waren, die uns so oft zugerufen hatten, daß der ganze Mist vorbei sei.
Auch die Soldaten brachten etwas aus dem Krieg nach Hause: Konserven, Kugellager, Schnaps, Werkzeuge oder Zigaretten, und einer, der vom Nordkap kam, vertraute mir an, daß er sich zehntausend Stopfnadeln aus einem Schneidermagazin geholt hatte, bevor es in die Luft gesprengt worden war: jeder schleppte etwas nach Hause, die seltsamste Beute manchmal, doch Sahnelöffel hatte keiner, Sahnelöffel hatte nur ich, und ich verdankte diesen überraschenden Besitz lediglich dem Umstand, daß unser Marinestab zwei Jahre in Dänemark stationiert gewesen war. So war ich, als der Friede losbrach, Eigentümer von zweihundertvierzig Sahnelöffeln, ein Besitz, der mich anfangs ständig irritierte, denn einmal haßte ich Sahne, und zum anderen glaubte ich mich überwinden zu können, Schlagsahne, wenn es schon sein mußte, auch mit einem schlichten Löffel zu essen. Das verwirrte mich zunächst sehr, und es gab Stunden, Mittagsstunden in hämmernder Hitze, in denen ich, was sonst keineswegs üblich ist, meinen Besitz verfluchte. Doch ich brachte es nicht übers Herz, mich von ihm zu trennen, vor allem deswegen nicht, weil ich die Sahnelöffel mit der Zeit als ein ausgefallenes Honorar ansah, mit dem man mich für den ganzen Mist bezahlte, in dem ich gesteckt hatte. Ich behielt es also bei mir, zog in südliche Richtung und erreichte in frischem Frieden die Freie und Hansestadt Hamburg.
Da ich mich nicht entscheiden konnte, ob die Stadt mir gefiel, marschierte ich zum Bahnhof, ging in den Wartesaal und schob den Seesack unter den Tisch und stellte einen Fuß drauf, so wie alle, die ich sah, einen Fuß auf ihren Koffer, ihren Karton oder Beutel gestellt hatten. Ich bestellte eine warme Steckrübensuppe, einen Steckrübensalat hinterher, und während ich aß, kam ein kleiner Junge an meinen Tisch, Rotz und Fröhlichkeit im Gesicht; er beobachtete mich durch das blaßgrüne Glas einer Flasche, schnitt mir Grimassen, dann tauchte er, nestelte unter dem Tisch an meinem Seesack, und bevor ich ihn wegjagen konnte, hatte er drei Sahnelöffel in der Hand, mit denen er zu seiner Mutter rannte. Seine Mutter riß ihm die Löffel aus der Hand und brachte sie mir unter Entschuldigungen zurück.
Als ich bezahlen wollte, den verdrossenen Kellner heranwinkte, fiel sein Blick sofort auf die Sahnelöffel. Überraschend beugte er sich zu mir herab und flüsterte: »Wieviel?« Und ich flüsterte zurück: »Wieviel was?«, und er legte eine Schachtel englischer Zigaretten auf den Tisch, legte fünfzig Mark dazu und strich die Löffel ein und fragte: »Einverstanden?« Ich verstand schneller, als ihm angenehm sein konnte, obwohl ich mir Mühe geben mußte, meine Verblüffung zu verbergen. Ich brachte einen Ausdruck von Zögern, von Unentschiedenheit in mein Gesicht, worauf er zwanzig Mark zulegte und ging. Instinktiv hob ich meinen Seesack auf, nahm ihn fest zwischen die Knie – so als sei mir in diesem Augenblick erst bewußt geworden, welch einen Schatz ich bei mir hatte.
Meine Verblüffung schwand und schwand nicht: in welch eine Zeit war ich hineingeraten? Was hatte es zu bedeuten, daß man nur Sahnelöffel auf den Tisch zu legen brauchte, um sofort ein Angebot zu erhalten? War das die neue Währung? Trugen die Leute neuerdings vielleicht Sahnelöffel in der Lohntüte nach Hause? Ich studierte die Speisekarte, in der Meinung, es herrsche ein Überangebot an Sahne, zu der man nur entsprechende Löffel brauchte, doch auf der Speisekarte waren lediglich Heißgetränke erwähnt, Räucherfischpaste und die dralle Steckrübe in vierundzwanzig Variationen. Wahrscheinlich, sagte ich mir, ist in meiner Abwesenheit ein Vorhaben Nietzsches ausgeführt worden, eine Umwertung aller Werte, bei der Löffel einen neuen Kurs erhalten hatten. Neugierde, und zwar schöpferische Neugierde, erwachte in mir, die Freie und Hansestadt Hamburg begann mir zu gefallen, und mit zweihundertsiebenunddreißig blanken Dingerchen auf dem Rücken beschloß ich, ein Zimmer zu suchen.
Das Wohnungsamt war wegen Überfüllung geschlossen, doch ich konnte warten, legte mich neben die rote Backsteinmauer, nahm meinen Seesack als Kopfkissen. Ich schlief nicht ein, denn ständig kamen Leute vorbei, wütende, schimpfende, aufgebrachte Zeitgenossen, die ergebnislos verhandelt hatten und nun die interessantesten Flüche hören ließen. Ich merkte mir einige der Flüche für alle Fälle, dann wurde ein neuer Schub reingelassen, wälzte sich unendlich langsam durch die Korridore, verteilte sich vor Zimmertüren, an denen Pappschilder mit Anfangsbuchstaben angeklebt waren, und schließlich stand ich in einem kahlen Raum, sah mich einem feindseligen, zerknitterten Gesicht gegenüber, das sozusagen lippenlos geworden war vom vielen Nein-Sagen. Argwöhnisches Warten, während ich, nach einem sehr höflichen Gruß, meinen Seesack bumsend absetzte, die Schnur aufzog und – wortlos, ohne Eile – eine Handvoll Sahnelöffel aus dem rosafarbenen Papier wickelte. Mit schöner Selbstverständlichkeit legte ich das blitzende Zeug auf den Festungstisch, hinter dem, unerreichbar, das feindselige Gesicht stand. Jetzt blickte ich es mit der mir eigenen, großäugigen Melancholie an und sagte leise: »Nun bin ich zurückgekommen. Ich habe mir erlaubt, unterwegs an Sie zu denken. Es ist nur ein kleiner Gruß von vorn.« Darauf senkte ich den Blick, sah zwei gelbliche, magere Hände über dem Tisch erscheinen und nach den Sahnelöffeln, es waren sieben, schnappen, wie ein Fisch nach einem Insekt schnappt, sah weiter, wie meine Löffel herabgezogen wurden in die Dämmerung heimlicher Schubladen, und als ich den Kopf wieder hob, sah ich ein nachdenkliches Gesicht vor mir.
»Ich habe nur ein unheizbares Zimmer.«
»Es wird reichen«, sagte ich, in Gedanken an die zweihundertdreißig Sahnelöffel, die noch im Seesack steckten.
Dann empfing ich meinen Einweisungsschein, wechselte einen warmen Händedruck und machte mich vergnügt pfeifend zu meinem neuen Heim auf, mißtrauisch verfolgt von den Blikken der Wartenden.
Meine Wirtin, eine schwermütige, athletische Frau, empfing mich im Kittel, blickte flüchtig auf den Einweisungsschein und zeigte mir mein Zimmer. Sie hatte einst bei der weiblichen Polizei gedient, war norddeutsche Judo-Meisterin gewesen, doch aus irgendeinem Grund hatte sie vorzeitigen Abschied genommen. Zur Begrüßung kochte sie Kaffee. Ich schenkte ihr einen Sahnelöffel, den sie lange betrachtete und mir dann zurückgeben wollte, weil sie glaubte, er sei zu kostbar. Als ich ihr anvertraute, wieviel ich davon besaß, verschwand sie für kurze Zeit und kehrte mit einer Flasche wieder, die zu einem Drittel mit Schnaps gefüllt war. Wir tranken den Schnaps – worauf ich mich auf die kratzige, rote Plüsch-Couch legte und acht Tage liegenblieb. Meine Wirtin versorgte mich. Geschäftig ging sie hin und her, brachte Tee, Käsebrote, manchmal auch Fleisch und Honig; sanft servierte sie, sanft trug sie ab, und nach acht Tagen war ich ausgeschlafen und hatte die Wirkung des Alkohols überwunden. Während ich mich vergnügt über dem Ausguß rasierte, brachte sie das Frühstück herein, und bei diesem Frühstück vollzog sich sozusagen die Wiedergeburt eines jungen Mannes aus dem Geiste des Mangels.
Sie – meine Wirtin – gestand mir, daß sie während meiner achttägigen Müdigkeit mehrere Sahnelöffel eingetauscht hatte, auf dem Schwarzen Markt, wie sie sagte, und sie erinnerte mich an Käse, Fleisch und Honig, die sie dafür bekommen hatte. Von ihr hörte ich den Ausdruck zum ersten Mal: »Schwarzer Markt«; ich muß gestehen, daß ich einen Augenblick lang an Brikett dachte, doch nur einen Augenblick, denn ich empfand sofort eine eigentümliche Sympathie für diesen Ausdruck, eine unerklärliche Hingezogenheit – etwa wie Rimbaud zu illegalen Waffengeschäften.
Ich wiederholte unhörbar diesen Ausdruck, der auf Geheimnis und Vorteil zu verweisen schien, und später, nachdem ich gefrühstückt, nähere Auskünfte erhalten und mir – für alle Fälle – einige Sahnelöffel eingesteckt hatte, zog ich los, um den Schwarzen Markt leibhaftig zu erfahren. Meine Wirtin hatte mir die Straße beschrieben, in der mein Markt stattfand, eine stille Trümmerstraße, in der einst Villen gestanden hatten; ich fuhr hin, glücklich und verwirrt. Ah, ich werde diese erste Begegnung nie vergessen, die sonderbare Überraschung, die ich erlebte! Ich hatte nichts vor. Ich wollte nur sehen, und ich sah mehr, als ich erwartet hatte.
Die Sonne schien. Die Straße war still, ohne Verkehr. Nirgendwo ein Stand, eine Marktbude; nur Männer und Frauen, die – und das mutete einen Fremden zunächst rätselhaft an – auf und ab schlenderten, gelassen nach außen hin, wenn auch eine versteckte Wachsamkeit in ihren Gesichtern lag. Sie gingen vorbei, ohne einander anzusehen, mit vorgegebener Gleichgültigkeit. Niemand schien in Eile. Auch ich ging die stille Straße hinab, schlendernd wie die anderen. War das der Markt, den ich erträumt hatte? Wo war das Geheimnis, wo der Vorteil? Und wie erfolgte der Handel? Aufmerksam ging ich weiter, und dann, ja, dann merkte ich es: ich hörte die Vorübergehenden leise sprechen, es klang wie Selbstgespräche, so daß ich an Kinder denken mußte, die, wenn man sie zum Einkaufen schickt, unaufhörlich wiederholen, was sie mitbringen sollen: einen Liter Milch, einen Liter Milch …
Auch die Leute, die sich hier gelassen aneinander vorbeischoben, wiederholten unaufhörlich denselben Spruch, als fürchteten sie, sie könnten ihr Stichwort vergessen. Ich hörte genau hin, hörte Stimmen, die im Vorbeigehen ehrgeizlos flüsterten: »Brotmarken« oder »Nähgarn«, hörte eine Frau, die mit gesenktem Blick nur ein einziges Wort sagte: »Marinaden, Marinaden«, ein Greis murmelte: »Bettzeug«, ein rotgesichtiges Mädchen: »Amis«. Jede Stimme empfahl ehrgeizlos etwas anderes: Schuhe, Fischwurst, Stopfnadeln – vielleicht waren es die vom Nordkap –, Uhren, Schinken, Kaffee und Eipulver. Niemand gab sich aufdringlich, marktschreierisch – wie wohltuend war doch die Diskretion meines Marktes. Ich empfand, während ich leise »Sahnelöffel, Sahnelöffel« zu flüstern begann, die tiefere Bedeutung dieses Vorgangs: die Nachfrage übertraf das Angebot bei weitem, der Mangel triumphierte, bestimmte den Kurs, und die Zeitgenossen bewiesen, daß sie dem Mangel gewachsen waren. Eine Revision der alten Werte hatte stattgefunden, die Not setzte den Preis fest. Man bezog, was man gerade effektiv brauchte, und nicht, was man zu brauchen glaubte – nicht mehr. Der unmittelbare Bedarf hatte den Vorrang. Die Bezahlung wurde von gegenwärtigem, nicht von zukünftigem Verlangen bestimmt, und was besonders zu Ehren kam, war die uralte Praxis der ersten Märkte – der Tausch. Ich selbst wurde es gewahr, denn nachdem ich mehrmals »Sahnelöffel, Sahnelöffel« geflüstert hatte, setzte sich mir ein hagerer Mann auf die Spur, drängte mich hinter eine geborstene Mauer, wo ich – nur aus Spaß und Neugierde – ein Angora-Kaninchen eintauschte. Allerdings trug ich es nicht nach Hause, sondern stieß es gleich gegen wollenes Unterzeug ab, erhielt dafür wieder englische Zigaretten und bezahlte mit ihnen drei Flaschen Bratenöl, das sich indes, später zu Hause, als Torpedoöl herausstellte. Doch obzwar die Bratkartoffeln das Bild einer Seeschlacht vor meinem Auge hervorriefen, war ich mit allem zufrieden, was ich für den Anfang erfahren hatte. Ich war auf den Geschmack gekommen. Die erste Begegnung hatte mich bereits elektrisiert. Ein Ziel begann sich deutlich abzuzeichnen, die Zuversicht einzustellen, daß ich dieses Ziel erreichen würde. Ich hatte ohne Anstrengung einen Beruf gefunden. Das Abenteuer konnte beginnen.
II
Mit dem Ruhm ist es wie mit dem Kapital: das erste Guthaben erwirbt man sehr mühsam, von einer gewissen Höhe ab braucht man nichts mehr zu tun; dann vermehren sich Ruhm und Kapital mit der überzeugenden Fruchtbarkeit der Natur. Auch mein Anfang war von Mühe nicht frei. Zwar besaß ich noch über zweihundert Sahnelöffel, die aus dem Magazin meines Marinestabes stammten, doch ich kann nicht sagen, daß sie ausreichten, um meinen Ruf auf dem Schwarzen Markt zu begründen. Ich benutzte sie allenfalls zu gelegentlichen Subalterngeschäften – tauschte etwa eine Matratze ein, ein Bild (Heidelandschaft) und eine Kiste Margarine, aber es gelang mir einstweilen nicht, einen interessanten Namen zu erwerben, sozusagen eine Gütemarke meines schwarzen Wappenschildes. Das erfolgte erst später, und zwar anläßlich einer Siegesfeier, die unsere alliierten Freunde in ihrem Victory-House feiern wollten. Diese Siegesfeier verhalf mir zu unerwartetem Prestige, und ich kann ohne Eitelkeit sagen, daß mich ein ganzes Bataillon der berühmten »Wüstenratten«, das sich in Nordafrika so bemerkenswert hervorgetan hatte, als Künstler des Mangels feierte – was natürlich nicht verborgen blieb und auf meinen Markt zurückschlug.
Jene Siegesfeier, welche unsere alliierten Freunde zu feiern entschlossen waren, litt unter einem überraschenden Mangel: es fehlte ein gewisses Quantum Schnaps, ohne den ja – was jeder weiß – auch ein strahlender Sieg eine melancholische Angelegenheit werden kann, und außerdem handelte es sich bei den Teilnehmern der Feier um »Wüstenratten«, bei denen man chronischen Durst schon beim Klang des Namens voraussetzen darf. Ich erfuhr das von Allan, einem sehr liebenswürdigen Korporal, den meine Wirtin, schwermütig und athletisch, eines Tages in die Wohnung brachte. Allan war Kantinen-Korporal, was für den Instinkt meiner Wirtin sprach – wenngleich ich es ihr auch nicht allzu hoch anrechnete, da sie ja ehedem bei der weiblichen Polizei gedient hatte. Jedesmal, wenn Allan uns besuchte, war er tadellos gepolstert mit Schokolade, Konserven und Büchsenkaffee, und während wir ihn am Anfang in ungestümem Spiel Zentimeter für Zentimeter absuchten, begnügten wir uns später damit, zuzusehen, wie er lakonisch die Feldbluse hochzog und seine Mitbringsel auf den Boden plumpsen ließ – gleichsam ein lustloses Wunderhorn.
Seine Lustlosigkeit war an jenem Abend besonders groß, als er uns anvertraute, daß eine Siegesfeier zwar terminiert war, daß aber alle seine Kameraden ihr ohne Freude entgegensähen, da pro Mann nur eine drittel Flasche Whisky vorgesehen sei. Wir, meine Wirtin und ich, empfanden freundschaftliches Bedauern, ja, da es sich um nicht vorhandenen Alkohol handelte, sogar Mitleid; schließlich hatte bereits Dostojewskij, der vom Trinken etwas verstand, verlautbart: Mann, Mann, ohne Mitleid geht es nicht.
Da es mir wirklich leid getan hätte, wenn die berühmten »Wüstenratten« auf ihrer Siegesfeier gewissermaßen mit einer Fatamorgana hätten vorliebnehmen müssen, forschte ich verzweifelt nach einer Möglichkeit, um das ganze Bataillon – bildlich gesprochen – zu einer Zisterne zu führen.
Ich fand keine Möglichkeit; doch in leichtsinniger Kühnheit sprang ich plötzlich auf – so wie möglicherweise Entdecker aufspringen, wenn sie einen Bazillus unverhofft ausgemacht haben – und sagte zu Allan: »Sorry, Allan, daß ihr für die Siegesfeier keinen Schnaps habt, sehr sorry. Aber macht euch keine Sorgen. Ich werde ihn beschaffen, und zwar für alle, fürs ganze Bataillon.« Allan reichte mir spontan die Hand, meine Wirtin jedoch musterte mich mit durchdringender Skepsis. Ich gestehe, in diesem Augenblick war ihre Skepsis angebracht. Ein wesentliches Element des Schwarzen Marktes ist die Überraschung, ist der Zufall; d. h. man kauft zunächst einmal nicht das, was man gerne will, sondern was sich zufällig oder günstig bietet. Der schönste Markt herrscht immer da, wo man den Augenblick am Schwanz packen kann. Worauf hatte ich mich nur eingelassen mit meinem leichtfertigen Versprechen? Würde mein Markt solch ein Angebot bereithalten? Nachdem Allan gegangen war, machte meine Wirtin mir die erwarteten Vorwürfe; sie liefen an mir herunter wie Wasser an einer Ente. Ich spürte nichts als eine Chance und setzte auf sie.
Am nächsten Morgen bereits machte ich mich auf in die Trümmerstraße, wo – lautlos, argwöhnisch und diskret – der Schwarze Markt stattfand. Wachsame Gesichter schoben sich vorbei, ich hörte die halblauten, monoton geflüsterten Angebote: »Marinaden, Marinaden«, hörte eine Frauenstimme sagen: »Socken für den Winter«, Angebote, die ich nicht zur Kenntnis nahm.
Eine begründete Unruhe begann mir zuzusetzen: ich dachte an die anberaumte Siegesfeier, an ein durstiges Bataillon von »Wüstenratten«, das sich auf die Feier freute, weil es meinem Versprechen vertraute. Ich hatte vier Tage Zeit. Ich ging die Straße hinauf und hinab, horchte auf die Stimmen und kalkulierte Preis und Gewinn: vier Schachteln Zigaretten wollten die »Wüstenratten« pro Flasche zahlen; eine Schachtel kostete hundertzwanzig Mark, eine Flasche Schnaps zweihundertvierzig –: zügig rechnete ich alles durch und kam zu dem Ergebnis, daß ich bei rund fünfhundert Flaschen beiläufig tausend Schachteln Zigaretten für meine schöpferische Begabung erhalten würde, wenn sie den akuten Mangel der »Wüstenratten« aufhob. Triumph der Gelegenheit! Mit der Erregbarkeit des Künstlers tat ich mich um. Es sah schwarz aus. Obwohl ich – bis auf eine kurze Mittagspause – den ganzen Tag arbeitete, hörte ich nur zweimal eine Stimme »Alkohol« murmeln: einmal war es ein unrentabler Krönungskognak aus der Zeit Napoleons, den eine gebildete alte Dame anbot; beim zweiten Mal handelte es sich um einen Kanister Brennspiritus – von einem Mann offeriert, der wie ein hungernder Feuerschlucker aussah, der seine eiserne Ration abstoßen wollte. Nach kurzer Vergewisserung verzichtete ich auf beides.
Schon wollte ich den Schwarzen Markt verlassen, als – in der Dämmerung – doch noch das Glück kam. Dieses Glück – das sich allerdings später nicht als vollkommen rein erwies – kam in Gestalt einer kräftigen, energischen Frau, die wie eine Fregatte durch die Trümmerstraße segelte, selbstgewiß um sich blickte und, ohne eine Hand vor den Mund zu nehmen, »Fusel« sagte, »prima Fusel«. Sie sagte nicht Kognak oder Schnaps oder Alkohol, sondern »prima Fusel«, und das klang wie eine aufrechte Untertreibung, hinter der sich, wie mir schien, ein sozusagen köstlicher Tropfen verbarg. Als sie es zu mir sagte, hob ich den Kopf, nickte und gab ihr durch mein Nicken zu verstehen, daß ich interessiert sei. Von diesem Augenblick an schwieg sie, gab mir Gelegenheit, mich auf ihre Spur zu setzen, und sie ging vor mir her zu einer Kneipe. An einem Ecktisch nahmen wir Platz, und wir schüttelten uns die Hand wie alte Bekannte oder Komplizen – eine Wahrnehmung, die ich später noch oft machen sollte: der Schwarze Markt verband die Zeitgenossen in einer ganz bestimmten Art von Rabentraulichkeit. Er rief tatsächlich etwas wie eine schwarze Familiarität hervor. Man kam ohne große Vorverständigung zueinander. Außerdem beeinflußte er in gewisser Weise auch die Sprache, zeigte ein überraschendes Vokabular. Beispielsweise sagte die Fregatte, als wir uns am Ecktisch niederließen: »Anita enttäuscht nicht. Auf wieviel Pullen willst du stehen?« Ich zögerte, dachte, daß sie mir bestenfalls zehn Flaschen würde überlassen können, doch um meinen Bedarf anzuzeigen, sagte ich träumerisch: »Fünfhundert.«
Sie stutzte nicht einen Augenblick, sagte vielmehr ohne Verwunderung: »Fünfhundert, bis wann?« »Bis morgen«, sagte ich. »Bei Überstunden wird’s möglich sein«, sagte sie. »Fünfhundert?« fragte ich skeptisch. »Die Pulle zu zweihundertfünfzig«, sagte sie. »Zu zweihundert«, sagte ich. »Zu zweihundertvierzig«, sagte sie. »Abgemacht«, sagte ich, denn damit waren wir auf dem Preisniveau, das ich kalkuliert hatte. Bevor wir uns noch über die Einzelheiten