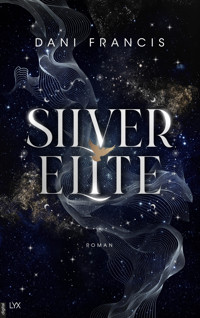
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Silver Elite
- Sprache: Deutsch
Vertraue niemandem. Belüge jeden. Und was auch immer geschieht: Verliebe dich nicht in deinen größten Feind
Wren Darlington hat ihr gesamtes Leben im Verborgenen verbracht. Sie unterstützt das Rebellen-Netzwerk Uprising, das seit Beginn der Neuen Ära Widerstand gegen General Redden leistet. Gleichzeitig muss sie ihre telepathischen Fähigkeiten verstecken. Denn auf dem Kontinent zu den Modifizierten mit übernatürlichen Kräften zu gehören, bedeutet den sicheren Tod. Aber dann gerät Wren in die Fänge der Company und soll im Trainingsprogramm der Silver-Elite ausgebildet werden - ihr schlimmster Albtraum, und vielleicht auch die einzige Chance das Regime endlich zu stürzen! Doch ihr Vorgesetzter ist niemand Geringeres als Captain Cross Redden, der misstrauische und viel zu attraktive Sohn des Generals, der den Auftrag hat, Wren nicht aus den Augen zu lassen ...
»Dani Francis bringt die Dystopien zurück in unsere Bücherregale! Ich habe ewig auf ein Buch wie Silver Elite gewartet, und es hat all meine Erwartungen übertroffen.« ALI HAZELWOOD
Band 1 der SILVER-ELITE-Reihe von TIKTOK-Hype-Autorin Dani Francis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 833
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Über das Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Karte
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Danksagung
Die Bücher von Dani Francis bei LYX
Die Autorin
Impressum
DANI FRANCIS
Silver Elite
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maira Busse
ÜBER DAS BUCH
Wren Darlington hat ihr gesamtes Leben im Verborgenen verbracht. Als Rebellin unterstützt sie das Netzwerk Uprising, das seit Beginn der Neuen Ära Widerstand gegen die Militärdiktatur von General Redden leistet. Gleichzeitig muss sie ihre telepathischen Fähigkeiten verstecken. Denn auf dem Kontinent zu den Mods, den Modifizierten mit übernatürlichen Kräften zu gehören, bedeutet den sicheren Tod. Doch in einem unachtsamen Moment gerät Wren in die Fänge der Company! Sie wird völlig überraschend ins Trainings-programm für die Silver-Elite aufgenommen, wo nur die talentiertesten und gefährlichsten Soldaten und Gedankenleser ausgebildet wer-den – ihr schlimmster Albtraum, und gleichzeitig die größte Chance, die das Netzwerk je hatte, das Regime endlich zu stürzen! Wren muss sich unter den Rekruten im berüchtigten Silver-Block beweisen. Dort ist ausgerechnet der misstrauische und viel zu attraktive Captain Cross Redden ihr Vorgesetzter. Captain Redden ist der Sohn des Generals und hat den Auftrag, Wren nicht aus den Augen zu lassen. Aber als der Krieg zwischen Primes und Mods erneut losbricht, muss Wren sich entscheiden: Wie weit ist sie bereit zu gehen – für ihre eigene Sicherheit und die Zukunft des Kontinents?
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung:
Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für die Frauen, die die Welt verändern.
Dieses Buch ist all denjenigen gewidmet, die kämpfen, Hindernisse überwinden und sich niemals unterkriegen lassen. Ihr inspiriert mich jeden Tag.
1. KAPITEL
Ich wuchs auf in einer reinen, unendlichen und erstickenden Dunkelheit.
Ich würde gerne sagen, dass das übertrieben ist, aber das stimmt nicht. Ich war gerade erst fünf Jahre alt, als mein Onkel mich aus der Stadt schmuggelte und ich fortan in den Blacklands leben musste. Ein Ort, von dem Kinder Albträume haben. Ein Wald der ewigen Dunkelheit. Ich weiß noch, wie ich die Augen aufriss, als ich ihn zum ersten Mal sah: diesen bedrohlich schwarzen Nebel, der aus der Erde aufstieg und bis hoch über die Baumkronen schwebte. Ich erinnere mich auch an eine tiefsitzende Angst und eine Panik, die mir die Kehle zuschnürte, als wir von der pechschwarzen Nacht verschlungen wurden. Ich erinnere mich, wie ich, weniger als eine Stunde nach Beginn unserer Wanderung, über einen Schädel stolperte. Ich kniete mich hin, um zu untersuchen, worüber ich gestolpert war, weil ich nichts sehen konnte. Meine Finger fuhren über die klaffenden Augenhöhlen und glatten, verwitterten Knochen.
Als ich Onkel Jim fragte, was dies sei, sagte er: »Nur ein Stein.«
Doch selbst im Alter von fünf Jahren war ich nicht so leicht zu täuschen.
Es sollte nicht das letzte Skelett sein, welches wir in den drei Jahren, die wir in den Blacklands verbrachten, sahen. Als wir in die Zivilisation zurückkehrten, waren die Angst und ich alte Freunde. Heute könnte sich ein Raubtier auf mich stürzen, und ich würde nicht mal blinzeln. Ein Kommando-Jet könnte eine Bombe auf unser Haus werfen, und mein Herzschlag würde ruhig bleiben.
Wenn man als Kind täglich Angst hat, gibt es nicht mehr viele Dinge, die man als Erwachsener noch fürchtet.
Außer vielleicht unangenehme Gespräche.
Ich würde lieber mit bloßen Händen gegen einen Puma kämpfen, als mich einem unangenehmen Gespräch auszusetzen. Ernsthaft.
»Wo gehst du hin?«
Verdammt. Ich hatte versucht, mich aus dem Bett zu schleichen, ohne ihn zu wecken.
Die Stimme des jungen Soldaten klingt schlaftrunken, doch da ist auch einen Hauch von Verführung. Ich richte den Blick nach unten, während ich meine Jeans zuknöpfe. Ich weiß, dass er unter dem dünnen Laken nichts trägt.
»Oh. Ähm. Nirgends. Ich wollte mich nur anziehen, weil mir kalt ist«, lüge ich und ziehe die Vorderseite meines schwarzen Tanktops über das raue Narbengewebe an meiner linken Hüfte.
Meine Verbrennungen, die von dort bis zur Mitte meines Oberschenkels reichen, sind eine ständige Erinnerung daran, wer ich bin und warum ich nicht länger als nötig in der Nähe dieses Typen bleiben kann.
Ich hatte ihm gesagt, dass die Narben die Folgen eines Unfalls wären. Ein Topf mit kochendem Wasser, der auf mich geschüttet wurde, als ich noch ein Kind war.
Das war nicht ganz gelogen.
Wenn er allerdings wüsste, was sich unter diesen Narben verbirgt, hätte er sie wahrscheinlich nicht mit so viel Mitgefühl gestreichelt.
»Komm wieder her. Ich werde dich wärmen«, verspricht er.
Ich täusche ein Lächeln vor und begegne seinem Blick. Seine Augen sind schön. Ein tiefes Braun. »Merke dir, wo wir stehen geblieben sind, okay? Jetzt, wo ich wach bin, muss ich ins Bad. Du hast gesagt, es sei gleich nebenan?«
Klinge ich zu hastig?
Ich glaube schon, aber ich will hier unbedingt weg. Es ist schon spät. Viel später, als ich es versprochen hatte fortzubleiben. Ich wollte nur im Dorf vorbeischauen, um etwas zu trinken und ein paar Freunden bei den Feierlichkeiten zum Tag der Freiheit Hallo zu sagen.
Und nicht um ausgerechnet mit einem Kommandosoldaten rumzumachen.
Auf dem Kontinent gibt es nicht viele Dinge, die es wert sind, gefeiert zu werden.
Keiner dieser idyllisch klingenden Feiertage, von denen man in Geschichtsbüchern liest. Und sind wir mal ehrlich – es ist wahrscheinlich eine kranke Ironie, dass ein Haufen modifizierter Menschen tanzt, trinkt und vögelt, um den Jahrestag eines Ereignisses zu feiern, das zu ihrer eigenen Abschlachtung führte. Aber Mods tanzen, trinken und vögeln eben gerne, also können wir es auch genauso gut tun, wann immer wir können, egal zu welchem Anlass.
»Du willst doch nicht weglaufen, oder?« Er will mich necken, aber ich kann auch einen Unterton von Unzufriedenheit heraushören. So ein Mist. Er weiß, dass ich vorhabe abzuhauen.
»Natürlich nicht.«
Ich tue so, als ob ich mich darauf konzentriere, meine Stiefel zuzuschnüren, und komme zu dem Schluss, dass das hier eine furchtbare Idee gewesen ist. Ich versuche, es mir nicht zur Gewohnheit zu machen, mit jemandem aus dem Kommando, dem Militär des Kontinents, ins Bett zu hüpfen. Aber ihre Unbeständigkeit macht mich einfach an. Soldaten dürfen das Basislager nur dreimal im Jahr verlassen, was bedeutet, dass sie immer nur kurz bleiben.
»Gut. Denn ich bin noch nicht bereit, dich gehen zu lassen«, sagt er mit einem Lächeln. Er ist fünfundzwanzig und war sehr sanft, als seine Hände meinen Körper erforschten.
Ist es gemein, dass ich mich nicht mal an seinen Namen erinnern kann?
Ich hebe mein Gewehr auf und lege mir den Riemen über die Schulter. Ich bemerke, dass er mich beobachtet.
»Was ist?«
»Du siehst gerade ziemlich heiß aus«, sagt er und beißt sich auf die Lippe.
»Wirklich?«
»Ja. In der Stadt sieht man keine Mädchen mit Waffen.«
Er hat recht. Das tut man nicht. Das ist der Hauptgrund, warum mein Onkel uns in Bezirk Z angesiedelt hat, so weit westlich, wie es nur geht. Es ist einer der Besitzbezirke, wo die Berufe eher Viehzucht und Landwirtschaft umfassen und die Bürger Waffen besitzen dürfen. Natürlich sind alle Waffen registriert und vollständig erfasst. Man bekommt keine Lizenz, ohne umfangreiche Tests zu bestehen und Kompetenz im Umgang mit der Waffe nachzuweisen. Aber das war kein Problem für mich. Ich habe meine Waffengenehmigung bekommen, als ich dreizehn Jahre alt war. Ich bin mehr als kompetent, mehr, als den Prüfern bewusst gewesen ist. Onkel Jim hatte mich gewarnt, ich solle am Prüfungstag »einen Gang runterschalten«.
»Das ist hier draußen ganz praktisch«, sage ich zu dem Soldaten. »Jede Nacht versuchen irgendwelche weißen Kojoten, meine Kühe zu reißen.«
Er lacht. »Ich muss eines Tages mal auf deine Ranch mitkommen und sehen, was du da so treibst.«
Die beiläufige Bemerkung weckt mein Misstrauen. Will er wirklich auf die Ranch kommen? War das nur eine unschuldige Bemerkung, oder muss ich mir Sorgen machen?
Wenn es um das Kommando geht, neige ich zur Paranoia, also öffne ich schnell einen mentalen Pfad, um in seinen Verstand zu dringen. Sein Schild ist dicker als Stahl. Ich könnte wahrscheinlich ein Loch finden, wenn ich lange genug suchen würde, aber auf der Stelle gelingt es mir nicht. Das ist keine Überraschung. Zu den ersten Dingen, die Soldaten wie ihm beigebracht werden, gehört, sich vor Mods zu schützen. Und das ist auch gut so. Primes haben keine besonderen Gaben. Sie spüren es auch nicht körperlich, wenn jemand in ihre Gedanken eindringt, während es Mods wie einen elektrischen Schlag wahrnehmen. Menschen wie er sollten auf der Hut sein.
Ich trenne den Pfad. Es war einen Versuch wert. Das einzige Mal, dass sein Schutzschild heute Abend ins Wanken geriet, war, nachdem wir uns ausgezogen hatten, ab da waren seine Gedanken eine Mischung aus nicht aufhören und ja.
Das war ein netter Ego-Booster, das will ich nicht leugnen.
»Gibt es einen Grund, warum du deine Waffe mit auf die Toilette nimmst?« Er hebt eine Augenbraue.
»Alle registrierten Waffen müssen immer bei sich getragen werden«, zitiere ich pflichtbewusst aus dem Handbuch, welches jeder Waffenbesitzer nach der Zertifizierung erhält. »Halte das Bett für mich warm. Ich bin gleich zurück.«
Ich werde nicht gleich zurück sein. Ich muss mich sogar dazu zwingen, nicht aus der Tür zu sprinten.
»Ich zeige dir, wo es ist«, bietet er an.
Ich will widersprechen, aber er klettert schon aus dem Bett und zieht sich seine Hose über die schlanken Hüften. Wenigstens trägt er nicht diese marineblaue Standard-Kommando-Uniform. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendeine Erregung hätte verspüren können. Abgesehen von den gelegentlichen alkoholbedingten Soldatentreffen hasse ich diese Arschlöcher, und die meisten von ihnen hassen mich auch. Sie sind darauf aus, Leute wie mich auszulöschen. Die Aberranten, wie sie uns nennen. Oder Silverbloods, wenn sie nett sind.
Eine besondere Ausnahme ist General Redden und sein irrationaler Hass auf Mods. Wir haben uns das hier doch nicht ausgesucht. Ein unüberlegter Krieg vor 150 Jahren setzte das Gift frei, das uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Wir hatten keine Wahl in dieser Angelegenheit.
Obwohl jede Zelle in meinem Körper fliehen will, erlaube ich dem Soldaten, mich zur Tür hinauszuführen. Wir laufen über den burgunderroten Teppich des Flurs im zweiten Stock des Gasthauses und biegen um die Ecke.
»Hier, bitte.« Da er ein Gentleman ist, öffnet er sogar die Badezimmertür für mich.
»Danke.« Ich zwinge mich zu einem erneuten Lächeln. »Wir sehen uns gleich in deinem Zimmer.«
»Ruf mich, wenn du dich verirrst, dann komme ich dich retten, okay?«
Im Bad bleibe ich hinter der Tür stehen und lausche dem Geräusch seiner sich entfernenden Schritte. Ich atme stoßweise und warte, bis ich nichts mehr höre. Im Spiegel sehe ich, dass sich Röte auf meiner gebräunten Haut abzeichnet. Das macht Sex eben mit einem. Meine Augen verraten meine Ungeduld. Der Soldat hatte ihre Farbe am Abend mehrmals gelobt – Honigbraun, gesprenkelt mit Goldgelb.
Mein Onkel behauptet immer, ich hätte die Augen meiner Mutter, aber ich kann mich leider nicht an ihr Gesicht erinnern. Ich war fünf, als sie mich wegschickte, eigentlich alt genug, um Erinnerungen an sie zu haben. Ich sollte mich zumindest an ihre Augen erinnern. Manchmal glaube ich, dass ich mich an ihre Stimme, ihr Lächeln erinnere, aber vielleicht ist das auch nur meine Fantasie, die versucht, die Lücken zu füllen.
Ich warte noch eine weitere Minute, bevor ich aus dem Bad trete. Ich will nur weg hier, aber ich muss an seiner Tür vorbei, um die Treppe zu erreichen. Also werde ich auf Zehenspitzen schleichen müssen.
Ich halte den Atem an, biege um die Ecke und tappe über den abgenutzten Teppich. Ich bin fast am Ende des Flurs angelangt, als ich sehe, wie sich der Türknauf seines Zimmers dreht.
Als sich die Tür öffnet, stürze ich mich instinktiv in das nächstgelegene Zimmer und werfe die Tür hinter mir zu.
In das Quartier eines Wildfremden zu stürmen war wahrscheinlich nicht die klügste Strategie, aber zumindest eine blitzschnelle Entscheidung – und eine, die ich zutiefst bereue, als sich ein muskulöser Arm um meinen Brustkorb legt.
»Beweg dich nicht«, ertönt eine männliche Stimme.
Wieder einmal reagiere ich reflexartig. Meine Faust schnellt nach oben und trifft einen harten Kiefer.
Doch dessen Besitzer zuckt nicht einmal. Er entwaffnet mich schneller, als ich blinzeln kann, und knallt mein Gewehr auf den Boden. Dann wirbelt er mich herum und drückt mich an die Tür. Seine große Gestalt ist mir bedrohlich nahe, und sein Arm presst sich an meine Brust, hart wie Stahl.
»Wer zum Teufel bist du?«, knurrt er mir ins Ohr.
Mein Herz hämmert wie wild gegen meine Rippen. Ich atme tief ein und lecke mir über die trockenen Lippen. »Ich bin …«
Die Worte bleiben mir im Hals stecken, als ich den Blick zu seinem Gesicht hebe.
Oh.
Ich glaube, ich habe mir den falschen Kandidaten für die heutigen Aktivitäten ausgesucht.
Dieser Typ vor mir ist … unfassbar attraktiv. Ich glaube sogar, ich habe noch nie einen besser aussehenden Menschen gesehen, ob männlich oder weiblich. Einen Moment lang verliere ich mich in diesen kobaltblauen Augen, die mich unter dichten Wimpern hervor anstarren. Sein dunkles Haar ist zurückgestrichen aus einem makellosen, symmetrischen Gesicht, das wie aus Stein gemeißelt wirkt. Ein perfekter Stoppelbart betont seinen markanten Kiefer, und in einem seiner Mundwinkel sehe ich ein Grübchen. Ich frage mich, wie ausgeprägt es wohl ist, wenn er richtig lächelt, aber nach dem kalten, gefährlichen Schimmer in seinen Augen zu urteilen, lächelt er nicht sehr oft.
»Wenn du hier bist, um mich zu töten, machst du das nicht besonders gut.«
»Dich … töten?«, wiederhole ich. »Das ist nicht, warum ich hier bin.«
»Ach nein?« Ich höre ein klapperndes Geräusch und begreife, dass es mein Gewehr ist, das er weggekickt hat. Es kostet mich große Überwindung, nicht hinterherzustürzen. »Du schleichst dich mitten in der Nacht mit einem Gewehr in mein Zimmer, und ich soll glauben, dass du keine bösen Absichten hast?«
»Glaub doch, was du willst.« Ich stemme mich gegen seinen Griff. Ein vergeblicher Versuch. Sein Arm rührt sich nicht einen Millimeter. »Ich bin nicht hier, um dich zu töten.«
»Also ist das ein Freundschaftsbesuch?« Er befeuchtet sich die Lippen mit der Zunge. Seine glänzenden Augen senken sich auf mein Dekolleté, das sich unter dem festen Druck seines Arms hervorwölbt. »Ich schätze die Geste, aber ich bin nicht interessiert. Ich hatte für heute Abend schon genug.«
Er verzieht die Lippen zu einem Lächeln. »Hättest früher vorbeikommen sollen, als mein Gast noch hier war. Wir hätten eine nette Party draus machen können.«
Mir fällt die Kinnlade runter. »Daran bin ich nicht interessiert. Ich verstecke mich hier bloß, Arschloch.«
Er zieht amüsiert eine Augenbraue hoch. »Vor wem?«
»Das geht dich einen Scheißdreck an. Kannst du jetzt bitte deinen Arm bewegen? Ich kann nicht atmen.«
»Nein. Und du scheinst gut genug Luft zu kriegen.«
Doch da liegt er falsch. Denn jedes Mal, wenn ich einatme, nehme ich seinen Duft wahr.
Er enthält Noten von Kiefer, Leder und einen Hauch von Gewürzen. Er ist unbeschreiblich. Und sein Körper ist nahezu surreal. Groß, breit, geschmeidig und muskulös zugleich, sein Bizeps spannt sich, während er mich festhält. Ich wette, er sieht nackt spektakulär aus.
»Lass mich los«, befehle ich. »Es tut mir leid, dass ich in dein Zimmer gestürmt bin, aber ich kann dir versichern, dass ich keine Bedrohung darstelle.«
»Warum bist du dann bewaffnet?«
»Ich bin ein Rancher. Ich habe eine Lizenz für die Waffe.«
Sein Blick streift über mein Gesicht und ruht kurz auf meinem Mund. Obwohl mein Herzschlag unter seiner Beobachtung ins Stocken kommt, versuche ich seine Ablenkung auszunutzen, indem ich mein Knie in Richtung seiner Leiste stoße. Er reagiert, ohne auch nur zu blinzeln, und packt mein Bein, bevor ich ihn treffen kann. Im nächsten Moment lande ich mit einem Aufprall auf meinem Hintern. Meine Knochen knacken, als sein schwerer Körper auf meinem landet. Seine Beine drücken mich an den Boden, und sein Unterarm an meiner Kehle schnürt mir die Luft ab.
Jetzt kann ich wirklich nicht mehr atmen.
Ich schnappe nach Luft, schlage mit beiden Händen auf seine Schultern, aber er rührt sich nicht und blickt ungerührt mit spöttischem Blick auf mich herab.
»Das war nicht sehr nett«, murmelt er. »So auf die Leiste zu zielen.«
Ich kann nicht antworten, weil mir die Luft fehlt. Ich hole noch einmal nach ihm aus. Gott, er ist stark. Ich dachte, ich wäre eine starke Kämpferin. Mein Onkel hat mich trainiert, seit ich fünf war. Aber hier bin ich nun, flach auf dem Rücken und unfähig, etwas zu tun, während er mich mit seinem Körper zerquetscht.
Nein, das ist nicht wahr. Ich kann etwas tun.
Eine weitere wichtige Lektion, die mein Onkel mir beigebracht hat, ist, dass man im Kampf die Oberhand gewinnen muss, egal wie. Bei Männern gibt es einen todsicheren Weg, das zu erreichen.
»Ich kann nicht sagen, dass ich es bereue«, keuche ich. »In Anbetracht des Ergebnisses.« Meine Stimme klingt heiser durch den Sauerstoffmangel.
In seiner schwingt Misstrauen. »Das Ergebnis?«
»Es hat dich auf mich gebracht.«
Ich schenke ihm ein winziges, unschuldiges Lächeln und bemerke das Aufflackern von Hitze in seinem Blick.
»Fühlt sich gar nicht so schlecht an«, füge ich hinzu und schaffe es, einen flachen Atemzug zu machen. »Ich war vorher nicht interessiert, aber jetzt …«
Einladend wiege ich die Hüften.
Er versteift sich und öffnet leicht den Mund. Für einen kurzen Moment macht er mit, und sein Unterkörper bewegt sich an meinem.
Dann beginnt er zu lachen.
»Netter Versuch.« Er bringt den Mund näher an mein Ohr, und mein Puls fängt an zu rasen. »Wenn ich dich aufstehen lasse, versprichst du dann, deine Hände und Knie bei dir zu behalten?«
»Wenn du es auch tust«, schieße ich zurück.
Immer noch lachend, lässt er von mir ab und holt mein Gewehr. Ich stehe entrüstet auf und glätte mein Hemd, während er die Seriennummer studiert. Ich nutze die Gelegenheit, um endlich meine Umgebung zu betrachten, aber es gibt nicht viel zu sehen. Die Bettlaken sind zerwühlt, wahrscheinlich durch das, was er und sein »Gast« vorhin getrieben haben. Ich weiß nicht, ob ich eifersüchtig auf das Mädchen bin oder – angesichts seiner charmanten Persönlichkeit – Mitleid mit ihr haben sollte.
Auf dem Nachttisch liegt ein Funkgerät, eine schwarze Jacke ist über einen roten Sessel unter dem Fenster drapiert, und neben der Tür steht ein Paar schwarzer Stiefel. Das ist alles. Keine Hinweise, die mir verraten könnten, wer er ist. Ich habe ihn vorhin nicht auf dem Platz unter den anderen Feiernden gesehen, was seltsam ist. Warum ist er hier in Hamlett, wenn nicht wegen des Tages der Freiheit? Es ist selten, dass Reisende auf der Durchreise hier Halt machen. Alles westlich von Ward Z ist unter Wasser, und es gibt keine Gemeinden an der Küste. Jedes Mal, wenn die Company versucht, dort wieder etwas aufzubauen, kommt ein weiteres Erdbeben und zerstört eine ganze Stadt oder ein Dorf.
Ich schaue wieder zu ihm zurück und versuche, seine Gedanken zu lesen, aber er ist stark abgeschirmt. Interessant. Die meisten Primes haben keine Schilde, oder wenn sie welche haben, sind sie leicht zu durchdringen. Das heißt, dieser Mann ist entweder ein Modifizierter, ein Soldat oder ein ziviler Prime, der aus irgendeinem mysteriösen Grund die Fähigkeit beherrscht, seine Gedanken zu schützen.
Er hält mein Gewehr gekonnt in der Hand, richtet es aber nicht auf mich. Er steht einfach nur da und mustert mich aus diesen gefährlichen blauen Augen.
»Wirst du jetzt endlich meine Seriennummer über dein Funkgerät durchgeben? Dann bekommst du bestätigt, dass ich keine Auftragsmörderin bin, und ich kann mein Leben weiterführen.«
»Oder ich töte dich einfach und kann mein Leben weiterführen«, sagt das Arschloch.
»Oh nein, ich habe solche Angst vor dir.« Ich stemme die Hände in die Hüften. »Tu es doch. Erschieß mich. So oder so, meine Qual hat ein Ende.«
Er neigt den Kopf und mustert mich weiterhin. »Wie heißt du?«
Ich fahre zusammen, als jemand anderes auf diese Frage antwortet.
»Wren?«
Oder besser gesagt, es antwortet jemand im Flur, der versucht, mich ausfindig zu machen.
»Wren? Bist du noch hier?«
Ich höre die Schritte des Soldaten, der an der Tür vorbeigeht, und sie werden schwächer, als er um die Ecke biegt.
»Du gehst jetzt besser, Wren«, raunt der Fremde spöttisch. »Vielleicht schaffst du es ja bis zur Haustür, bevor dein Freund dich erwischt.«
»Er ist nicht mein Freund, und ich gehe nirgendwohin ohne mein Gewehr.«
Nach einem kurzen Augenblick nimmt er das Gewehr am Lauf und reicht es mir mit dem Schaft zuerst.
Ich schiebe mir den Riemen über die Schulter und marschiere zur Tür. »Nett, dich kennenzulernen, Arschloch«, murmele ich, ohne mich umzudrehen.
Sein leises Lachen trifft mich mit einem Stechen zwischen den Schulterblättern.
Ich nutze den leeren Korridor aus und renne zur Treppe, dann hinunter ins Hauptgeschoss. Doch kaum habe ich den Ausgang erreicht, höre ich schon wieder meinen Namen.
»Wren, warte.«
Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Soldat ist schon auf halbem Weg die Treppe hinab.
»Du hast versprochen, nicht abzuhauen«, sagt er, als er sich mir nähert. Enttäuschung liegt in seinem Blick.
»Tut mir leid.« Ich stoße ein übertriebenes Seufzen aus und konstruiere eine passende Lüge. »Ich bin einfach nicht gut im Verabschieden.«
Seine Gesichtszüge werden weicher.
»Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Einer unserer Zäune ist bei einem Sturm zusammengebrochen, und mein Onkel wird mich umbringen, wenn ich morgen nicht in aller Herrgottsfrühe aufstehe, um ihn zu reparieren.«
»Ich will dich wiedersehen. Vielleicht kann ich versuchen, nächsten Monat Urlaub zu bekommen?«
»Du weißt ja, wo du mich findest«, sage ich leichthin, denn es ist gut möglich, dass er für eine lange Zeit keinen Urlaub kriegen wird. Bis dahin wird er mich vergessen haben.
Hoffentlich.
Es besteht natürlich das Risiko, dass er so vernarrt ist, dass er einen Weg findet, mit einem anderen Soldaten zu tauschen und dann meinem Bezirk zugewiesen wird.
Aber ich glaube nicht, dass ich so gut im Bett bin.
»Wie ist deine Ausweisnummer?«
Zögernd gebe ich sie ihm und beobachte, wie er die Ziffern in sein Funkgerät eingibt. Einen Moment später vibriert das schlanke Gerät in meiner Tasche leise.
Er schenkt mir ein Grübchenlächeln. »Das war ich.«
Ich ziehe es heraus und speichere seine ID. Ich verabscheue dieses Ding. Wir sind verpflichtet, es zu tragen, aber ich achte nur dann auf mein Funkgerät, wenn eine Meldung der Company reinkommt. Den Rest der Zeit führe ich die obligatorische Korrespondenz mit Onkel Jim oder meinen Freunden. Nichts Wichtiges, natürlich; wir haben andere Kommunikationswege für die wirklich wichtigen Dinge. Kein Mod, der bei Verstand ist, würde ein Gerät der Company benutzen; nicht, wenn jedes gesprochene oder getippte Wort aufgezeichnet wird und ein Raum voller Geheimdienstagenten jeden Austausch überwacht. Dasselbe gilt auch für Nexus, unser Online-Netzwerk. Wir wären leichtsinnig, uns auf einen dieser beiden Kommunikationswege zu verlassen, um offen zu sprechen.
»Ich begleite dich hinaus«, sagt er.
Ich höre das Stimmengewirr hinter den Türen des Gasthauses. Das schnelle Tempo der Band, die ein Lied spielt, das ich nicht kenne. Ich nehme an, es steht auf der Liste der von der Company genehmigten Melodien des Kommunikationsministeriums. Alle Medien müssen von ihnen geprüft werden, bevor sie für die Bürger freigegeben werden.
Wir treten auf den Hof hinaus. Die Brise ist genauso mild wie vorhin, bevor wir uns in das Innere des Gasthauses verzogen hatten. Der Geruch von gegrilltem Fleisch und gebutterten Maiskolben liegt in der Nachtluft. Der Dorfplatz ist heute Abend beleuchtet. Es ist voll und laut, und immer wieder ertönt Gelächter über die Musik hinweg.
Dass ein Dutzend Soldaten sich dort herumtreiben, bereitet mir Unbehagen. Der Tag der Freiheit ist die einzige Zeit im Jahr, in der viele von ihnen in ihre Bezirke zurückkehren und Familie und Freunde sehen können. Die meisten von ihnen sind in der Regel harmlos, aber heute sind für meinen Geschmack dann doch zu viele blaue Uniformen hier.
Ich wünschte, sie würden wieder zurück in die Stadt gehen und uns verdammt noch mal in Ruhe lassen. Niemandem hier gefällt es, ein Lächeln und Freundlichkeit vorzutäuschen. Sogar die Primes verabscheuen die harte Hand des Generals, die Art, wie er jeden Bereich unseres Lebens kontrolliert. Oder zumindest hassen es die meisten. Es gibt sicherlich eingefleischte Loyalisten, die bereit wären, ihre eigenen Mütter für ein wohlwollendes Nicken dieses Mannes oder eines seiner Kriecher zu verraten. Ein Prime-Scheißkerl in meinem Bezirk hat seine Mutter buchstäblich verraten, als er herausfand, dass sie modifiziert war. Fast zwei Jahrzehnte hatte sie es erfolgreich geschafft, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Doch nur ein Fehltritt, ein unachtsamer Moment des Gedankenlesens, ohne ihre Ärmel herunterzuziehen reichte aus, dass ihr einziger Sohn sie meldete. Das Letzte, was ich hörte, war, dass er dazu befördert wurde, seine eigene Einheit im Kommando zu leiten.
Obwohl ich schätze, dass so was nicht so schlimm ist wie Mods, die sich gegen ihre eigenen Leute wenden – die Sympathisanten, die Redden in Sanctum Point, unserer Hauptstadt, dienen. Diese Verräter führen dort ein bequemes Leben. Loyalität zum General zahlt sich eindeutig aus.
Die freudigen Schreie von Kindern ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich drehe mich in Richtung des Lärms und lächle. Einige Hundert Meter entfernt, auf einer grasbewachsenen Lichtung, spielen sie Fangen. Die Kinder des Dorfes schreien und lachen, während die Fängerin, ein dünnes Mädchen mit leuchtend rotem Haar, herumrennt und versucht, jemanden zu erwischen.
»Wren!«, ruft eine fröhliche Stimme.
Dann sehe ich Tana Archer, die zu uns hinüberschlendert. Ihre Augen leuchten, ihre Wangen sind gerötet. Sie hat offensichtlich ihren eigenen Vorrat überprüft. Tanias Vater, Griff, betreibt die einzige Trinkhalle auf diesem Platz.
»Ich habe mich schon gefragt, wohin du verschwunden bist.« Ihr wissender Blick wandert zwischen dem Soldaten und mir hin und her. Noch während sie uns beide anlächelt, spüre ich, wie sie versucht, eine Verbindung zu mir herzustellen.
Alle Telepathen haben ihre eigene, einzigartige Signatur. Als ich ein Kind war, beschrieb mein Onkel sie wie eine Essenz, ein spezifischer Energieschub, der nur einem selbst gehört. Es ist fast unmöglich, es zu erklären, es sei denn, man fühlt es selbst. Wurde eine Verbindung erst mal hergestellt, erkennt man sofort die Energie der Person, die um eine Verlinkung bittet.
»Da war jemand aber beschäftigt«, neckt Tana mich in Gedanken.
Ihre Stimme in meinem Kopf hat immer einen tieferen Ton als ihre gesprochene Stimme. Ich habe meinen Onkel einmal danach gefragt, warum die telepathischen Stimmen der Leute so anders klingen. »Hast du noch nie eine Aufnahme von dir selbst gehört und gedacht: So klinge ich doch gar nicht?«, war seine Antwort. »Das liegt daran, dass du dich selbst immer anders hörst. Wenn wir telepathisch sprechen, höre ich deine Stimme so, wie du sie hörst. Wenn du laut sprichst, höre ich deine Stimme so, wie ich sie höre.« Es ergab seltsamerweise Sinn, als er es so erklärte.
»Du musst aufhören, mit Soldaten zu schlafen, Süße.«
»Hey, das ist das Einzige, wozu sie gut sind«, entgegne ich, und Tana dreht rasch den Kopf weg, um ein Lachen zu verbergen.
Ich weiß, dass ihre Adern, verborgen unter langen Ärmeln, pulsieren. Bei ihrer dunkelbraunen Haut sehen sie besonders hell aus, wenn sie leuchten.
Ich hingegen trage ein Top und muss mir darum keine Sorgen machen. Eine weitere Sache, mit der ich meinen Onkel immer genervt habe, weil es mich irritierte, den leuchtenden Silberstrom unter seiner Haut zu sehen, jedes Mal, wenn wir Telepathie benutzten. Warum blieben meine Adern normal? Ich war ein nerviges Kind, das ihn andauernd mit Fragen löcherte. Darauf hatte er jedoch keine gute Antwort. Er zuckte bloß mit den Schultern und sagte: »Es sind mehr als hundert Jahre vergangen. Es gibt immer noch vieles über uns, das niemand erklären kann.«
Das ist das Komplizierte an uns Modifizierten – wir folgen keiner einheitlichen Formel. Ja, die Mehrheit von uns sind echte Silverbloods, mit Adern in den Armen, die leuchten, wenn wir unsere Kräfte einsetzen. Doch ich bin eine seltene Ausnahme, die nicht in diese Schublade passt. Was auch immer der Grund für diese Anomalie ist, ich kann nicht leugnen, dass es mich … nun ja, ich möchte nicht arrogant klingen, aber doch unersetzlich macht.
Eine Mod, die ihre Kräfte einsetzen kann, ohne es ihre Feinde sehen zu lassen, ist ein großer Gewinn für Uprising.
Als das Netzwerk der Rebellen mich erstmals rekrutieren wollte, sagte mein Onkel jedoch ganz klar »Nein«. Er war komplett dagegen. Wren setzt ihr Leben nicht aufs Spiel. Punkt. Doch sobald ich ein Teenager war, wurde es für ihn schwieriger, mich aufzuhalten. Ich bin ziemlich stur. Ich liebe Onkel Jim über alles, aber ich habe auch meinen eigenen Kopf.
Wir fingen an, gemeinsam Missionen durchzuführen, als ich sechzehn Jahre alt war. Kleine Lieferfahrten. Abgaben. Wir nutzten unsere Ranch auch, um Mods zu verstecken, die aus der Stadt oder den Minen geschmuggelt wurden. Ich koche vor Wut, wenn ich daran denke, wie viele von uns immer noch in den Arbeitslagern festgehalten werden, die über die Bezirke verstreut sind.
»Du gehst doch nicht schon, oder?«, fragt Tana. »Ich habe dich heute Abend kaum gesehen. Du kannst nicht gehen!«
Der Soldat lächelt. »Das habe ich ihr auch gesagt.«
»Ich muss«, antworte ich mit einem Schulterzucken. »Du kennst meinen Onkel. Er tigert wahrscheinlich schon auf der Veranda auf und ab und wartet auf mich.«
Wie auf Kommando spüre ich einen harten Stoß in meinem Kopf – Jims Signatur. Er bittet um eine Verbindung, und ich lasse ihn herein.
»Es ist spät. Komm nach Hause.« Seine Stimme ist ein tiefes Brummen.
Ich widerstehe dem Drang, mit den Augen zu rollen. »Bin schon auf dem Weg.«
»Bleib doch noch für einen Tanz«, bettelt Tana.
»Ich kann wirklich nicht.«
Ehrlich gesagt, würde ich gern noch eine Weile mit Tana abhängen, wenn dieser Soldat nicht so an mir kleben würde. Verdammt, wie hieß er noch mal? Ich glaube, es war Max. Oder vielleicht Mark?
Angesichts dessen, was wir vorhin gemacht haben, ist es mir peinlich, ihn zu fragen, also berühre ich seinen Arm. »Okay, äh … Schatz … hat mich gefreut, aber ich muss jetzt gehen.«
Tana sieht aus, als würde sie gleich in Gelächter ausbrechen.
»Schatz?«
»Halt die Klappe. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ist es Max oder Mark?«
»Sein Name ist Jordan!«
Oh. Da lag ich wohl ziemlich daneben.
»Die wichtigere Frage ist aber – wer ist dieser umwerfende Typ, der im Gasthof übernachtet?« Mein Herzschlag ist immer noch ein bisschen aus dem Takt nach unserer explosiven Begegnung.
»Ich weiß nichts von einem umwerfenden Typen. Aber ich habe heute niemanden außer Soldaten einchecken sehen. Oder vielleicht habe ich ihn gesehen und wieder vergessen? War er ein Soldat?«
»Keine Ahnung. Aber glaub mir, du würdest dich an dieses Gesicht erinnern.«
Es war ein bemerkenswertes Gesicht. Und völlig verschwendet an so einen Arsch wie ihn.
»Na ja. Wenn ich von einem Gesicht geblendet werden soll, dann muss es schon zu einer wunderschönen Frau gehören, sonst bin ich glücklicherweise vollkommen blind.«
»Darf ich dich nach Hause bringen?« Jordan unterbricht unser stilles Gespräch, sein hoffnungsvoller Blick ist auf mich gerichtet.
»Schon gut. Ich habe mein Bike.«
Tana tritt zurück, um uns einen Moment der Privatsphäre zu geben, den Jordan sich offensichtlich wünscht.
Er nimmt mein Gesicht in seine Hände. »Du bist echt schwierig«, tadelt er mich neckend. »Gib mir wenigstens einen Abschiedskuss.« Sein Daumen streicht über die Kante meines Kinns, als er seinen Mund auf meinen legt.
Ich lasse ihn mich küssen, trotz der Ungeduld, die sich in meiner Brust zusammenbraut.
Wir reißen uns voneinander los, als die Schreie von Kindern ertönen.
Eine Sekunde später bricht Chaos auf dem Platz aus.
»Was zur Hölle?«, sage ich, dann rennen wir drei los in die Richtung des Tumults. Was ich in der Dunkelheit erkennen kann, ist ein Kind am Boden, sonst sehe ich nur das hektische Wirbeln von Armen, die herumfuchteln, und tretende Beine. Weitere Kinder strömen von der Lichtung uns entgegen und rufen um Hilfe.
»Das ist sicher dieser verdammte weiße Kojote!«, flucht Tana. »Er schleicht schon die ganze Woche im Wald am Rand des Dorfes herum.«
Verdammt. Dieselben Wolf-Kojote-Hybridwesen sind auch eine Plage bei uns an der Ranch. Vor zwei Tagen fand ich eins meiner Kälber tot auf der südlichen Weide. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Biest es durch unseren Zaun geschafft hat.
»Er hat ihn!«, kreischt ein kleines Mädchen den Erwachsenen entgegen, die sich am Rand der Lichtung versammeln.
Ein weiterer Schrei zerreißt die Luft, diesmal ein Schrei voller Terror und Qual. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, und mein Puls rast. Auf der anderen Seite der Lichtung sehe ich einen Jungen, der auf dem Rücken liegt, und der weiße Kojote beugt sich über ihn. Das Tier ist riesig.
»Robbie!«, schreit eine Frau. Es ist Rachel, eine Lehrerin der Dorfschule. Was wohl bedeutet, dass der Junge, der da in Lebensgefahr schwebt, ihr Sohn ist.
Es ist zu schattig, um es aus diesem Winkel genau zu erkennen, aber es sieht nicht so aus, als wären die Zähne des Tieres am Hals des Jungen. Ich glaube, dass es sich eher in Robbies Arm verbissen hat und – heilige Scheiße, der Koyote fängt an, den Jungen wegzuziehen.
Ohne zu zögern, zücke ich mein Gewehr.
»Wren!«
Trotz Tanas Protestschrei gehe ich einige Schritte weiter und nehme Robbie und den weißen Kojoten ins Visier. Mehrere Männer kommen herbeigeeilt. Sie sind schon auf halbem Weg, aber der Junge wird tot sein, bevor sie ihn erreicht haben.
»Nein! Haltet sie auf!«, schreit eine panische Rachel. Ich nehme mein Ziel ins Visier, den Gewehrlauf an meine Schulter gepresst.
»Nicht, Wren! Du wirst meinen Sohn treffen!«
Ich ignoriere sie und drücke ab.
2. KAPITEL
Ein Gefühl der Vorahnung durchströmt mich, als ich den großen bärtigen Mann näher kommen sehe. Controller Fletcher war der Erste, der den Jungen erreichte, nachdem ich das Raubtier erschossen hatte. Mehrere Männer folgen dem Controller, einer von ihnen trägt Rachels Sohn in den Armen.
»Gebt ihn mir!« Rachel kommt herbeigestürzt und greift nach dem Jungen, dessen Kleidung blutgetränkt ist. »Wo ist Betta? Jemand muss Betta holen!« Tränen überströmen ihr Gesicht.
»Nina ist schon losgelaufen, um sie aufzuwecken«, versichert ihre Schwester Elsie. »Schon gut, Liebes. Atme tief durch. Betta wird ihm helfen.«
Betta ist unsere Ärztin. Rachel hat verdammtes Glück, dass sie in der Nähe wohnt, denn nicht jedes Dorf hat eine. Die Bewohner unserer Nachbarstadt müssen für jede Behandlung nach Hamlett kommen.
Tana und ich drängen uns weiter nach vorne, um uns den schluchzenden Jungen genauer anzusehen. Die Tatsache, dass er bei ausreichend Bewusstsein ist, um zu weinen, ist ein gutes Zeichen. Trotz der großen Menge an Blut scheint sich seine Verletzung auf seinen linken Arm zu beschränken. Tana zuckt zusammen, als sie die Zahnabdrücke und das Stück Fleisch, das von der klaffenden Wunde hängt, sieht.
»Wird er wieder gesund?«, fragt sie.
Elsie drückt einen Stofffetzen auf den Arm des Jungen. »Die Blutung scheint langsam aufzuhören. Er muss jedoch mit einigen Stichen genäht werden.«
Rachel fängt wieder zu weinen an, als sie mich dort stehen sieht. »Du hast ihn gerettet, Wren. Danke!«
Ich berühre ihren Arm und streichle sanft über Robbies Kopf, seine dichten schwarzen Locken. »Ich bin einfach nur froh, dass es ihm gut geht.«
Die Gruppe eilt nun zu dem langen Streifen aus ein- und zweistöckigen Gebäuden an der Nordseite des Dorfplatzes. Die Menschen von Hamlett finden hier alles, was sie brauchen. Einen Lebensmittelladen, Kneipe, Schulhaus, Tanzsaal, Medienhaus, Arztpraxis. Unser ganzes Leben reduziert auf ein paar Quadratmeter. Was wir nicht haben, sind die Politiker oder Polizeikräfte, von denen wir in der Schule gehört haben. Anders als in den Generationen vor uns werden unsere Dörfer und Städte von Soldaten überwacht und von Controllern geleitet. Die Controller unterstehen den Gemeindevorstehern, die wiederum General Merrick Redden unterstehen, unserem gütigen Führer. Reddens Company ist eine hocheffiziente Militärmaschine. Er hat keinen Bedarf an Politikern oder anderen überflüssigen Positionen.
Der Controller von Hamlett, Fletcher, bleibt stehen und schaut mich mit erhobenen Augenbrauen an. »Deine Kugel ging durch sein Auge«, bemerkt er. »Nicht schlecht.«
Ich zucke mit den Schultern. Ich bin mir schmerzlich bewusst, dass Jordan mich von der Seite ansieht.
»Werte das nicht ab«, sagt Fletcher. »Du hast diesen Jungen gerettet, Wren.«
Ich widerstehe dem Drang, meine Schultern noch einmal zu heben. »Na ja, wissen Sie, ich habe viel Erfahrung mit diesen Raubtieren, weil sie meine Rinder jagen. Ich habe nur nach Instinkt gehandelt.«
»Verdammt guter Instinkt. Sag deinem Onkel, er hat dich gut unterrichtet.«
Das werde ich ihm ganz bestimmt nicht sagen. Jim wäre entsetzt, wenn er wüsste, dass ich meine Waffe in der Stadt abgefeuert habe, auch wenn das Leben eines Kindes in Gefahr war.
Ich verspüre plötzlich den starken Drang zu fliehen. Meine Beine tragen mich davon, bevor ich mich von Fletcher verabschieden kann. Sowohl Tana als auch Jordan folgen mir, wobei Letzterer nicht so willkommen ist.
»Alles okay?,« fragt Tana besorgt und greift meine Hand, um mich zu stoppen.
»Mir geht’s gut. Aber ernsthaft, ich muss jetzt nach Hause.« Ich drücke kurz ihre Hand und wende mich ab. »Komm uns diese Woche besuchen. Dann können wir einen Ausritt machen.«
»Du musst mich jetzt gehen lassen, Tana. Sonst wird er es auch nicht tun.«
»Sorry. Wir sprechen uns später.«
»Klingt gut«, sagt sie, bevor sie verschwindet.
Doch Jordan klebt mir weiterhin an den Fersen. Als wir mein staubiges altes Motorrad erreichen, hat er schon wieder ein Strahlen in den Augen.
»Ich habe noch nie jemanden so schießen sehen«, staunt er.
»Wie gesagt, ich habe Erfahrung von der Ranch.«
»Wren«, sagt er bestimmt. »Du hast sein Auge getroffen. Das waren gut hundert Meter Entfernung und ein sich bewegendes Ziel. Und ein Kind direkt daneben. Du hättest ihm aus Versehen den Kopf wegblasen können.«
Ich sträube mich beleidigt. Ihm den Kopf wegblasen! Wohl kaum. Ich bin mir sicher, dass ich ein besserer Schütze bin als jeder in Jordans Einheit. Er ist nicht mal im Silver-Block, wo die Elitesoldaten hingehen. Ich glaube, er hatte erzählt, er sei im Copper-Block, Kupfer. Ich könnte einen Copper-Typen mit geschlossenen Augen im Schießen schlagen. Ich hätte fast Lust, den Kerl zu einem Schießwettbewerb herauszufordern.
Nein, rügt mich mein gesunder Menschenverstand. Du wirst nichts dergleichen tun.
Die eine Regel, die mein Onkel mir von klein auf eingebläut hat, ist, niemals Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
Und genau das habe ich heute Abend getan.
Scheiße.
Ich hätte nicht abdrücken sollen.
»Ich würde gern mit dir auf die Ranch kommen und auf ein paar Ziele schießen. Ich will nicht angeben, aber ich bin auch ziemlich gut mit dem Gewehr. Könnte Spaß machen.«
»Oh, mein Onkel erlaubt leider keine Besucher«, sage ich und zucke zusammen, als ich mich daran erinnere, dass ich Tana eben gerade eingeladen habe, vorbeizukommen. Ich versuche, die Lüge zu vertuschen, indem ich rasch hinzufüge: »Tana ist die Einzige, die er akzeptiert. Wahrscheinlich, weil wir Freundinnen aus Kindheitstagen sind. Sie ist eher wie eine weitere Nichte für ihn«.
»Na ja, vielleicht ein anderes Mal.« Jordan schüttelt erneut den Kopf. »Das war echt ein Schuss.«
Ich versuche, ihn von meiner Meisterleistung abzulenken, indem ich mich auf die Zehenspitzen stelle und ihn küsse.
Er zuckt überrascht zusammen, dann lächelt er. »Wofür war das?«
»Nichts Besonderes. Ich hatte einen sehr schönen Abend.« Ich trete einen Schritt zurück. »Gute Nacht, Jordan«.
Ich nehme den schwarzen Helm vom Rücksitz meines Bikes, setze ihn auf und weiche seinem Blick aus, während ich den Gurt schließe. Einen Moment später lasse ich den Motor aufheulen und rase los. Ich spüre immer noch seinen Blick auf mir.
Tana hat recht, ich muss wirklich damit aufhören, mit Soldaten zu schlafen. Das nächste Mal, wenn mich das … Bedürfnis packt, sollte ich woanders Ausschau halten. Es gibt ein paar ledige Männer im Dorf, aber Tana sagt, dass die eher an etwas Ernsthaftem interessiert sind. Ich möchte nichts Ernsthaftes. Ich bin erst zwanzig. Noch nicht bereit, mich verbindlich jemand anderem zu widmen. Die Beziehungen anderer Leute erscheinen mir erdrückend, und ich habe genug Frauen gesehen, die sich jeder Laune eines Mannes beugen.
Ich beuge mich nicht.
Ich erreiche die asphaltierte Straße am Ortsende, wo ein blaues Metallschild in der Dunkelheit aufleuchtet. In weißer Schrift steht dort unser Bezirk, unser Dorf und die Einwohnerzahl. Es wird jährlich aktualisiert, aber Hamletts Einwohnerzahl ist über die Jahre kaum gewachsen. Genau so gefällt es Redden. Der General behauptet immer, dass die Überbevölkerung vor dem letzten Krieg ein Kernproblem war. Wir wären nie an diesen schrecklichen Punkt gelangt, zu dem globalen Konflikt, zu sieben verwüsteten Kontinenten, von denen vier zerstört oder unter Wasser sind, wenn es nicht all diese Menschen gegeben hätte, die sich um die wenigen Ressourcen stritten.
Gier. Alles kommt immer wieder auf Gier zurück.
Ich spüre, wie mein Kopf kribbelt, als ich eine Anfrage bekomme. Ich lächele, weil ich diese vertraute Energie kenne. Nachdem ich die Verbindung angenommen habe, ertönt eine tiefe Stimme in meinem Kopf.
»Bist du noch unterwegs?«
»Nein. Ich fahre gerade nach Hause.«
»Verdammt. Du hast ihm schon das Herz gebrochen? Du bist schnell.«
»Ach, halt die Klappe. Als ob du nicht jede Nacht irgendwelche Herzen brechen würdest.«
»Ich lebe im Zölibat.«
»Haha!«
»Du lachst mich immer aus. Hör auf damit.«
»Dann hör auf, so lächerliche Dinge zu sagen.«
Aber das ist nicht Wolfs Art. Er hat keinen Filter, hatte er noch nie. Und er flirtet unverschämt viel, obwohl das erst im Teenageralter losging. An einem Tag waren wir noch zwei Kinder, die über Kinderkram redeten, am nächsten Tag sprachen wir über unser Liebesleben. Ein bisschen beunruhigend, wenn man bedenkt, dass wir uns nie wirklich getroffen haben.
Ich habe mich mit Wolf verbunden, als ich sechs Jahre alt war, und bis heute kann ich mich an die Aufregung erinnern, die ich verspürte, als ich zum ersten Mal seine Stimme hörte. Es war ein warmer Sommermorgen. Ich hatte auf der Lichtung vor dem kleinen Haus gespielt, das Onkel Jim gebaut hatte. Es gibt in den Blacklands einige Stellen, an denen die Sonne durchkommt, wenn auch nur ein Bruchteil davon, und unsere grasbewachsene Lichtung war einer dieser Zufluchtsorte. Jeden Tag hatten wir fünf oder sechs Stunden gebündeltes Sonnenlicht, welches auf uns herabschien, bis der Nebel sich hob und wir wieder von der Dunkelheit verschluckt wurden. An jenem Morgen rannte ich zu meinem Onkel, vor Freude ganz aufgewühlt.
»Jim!«, rief ich. »Ich habe einen Freund.«
Wie vorherzusehen war, reagierte er misstrauisch. Ich weiß nicht, warum ich etwas anderes erwartet hatte. »Was für einen Freund?«, fragte er und schaute von dem Balken hoch, den er gerade schmirgelte. In diesem Jahr hatte er begonnen, erhöhte Stege zu errichten, die über die schwarzen Treibsandgruben führten. So sollten wir uns leichter zurechtfinden, wenn wir auf die Jagd gingen. Ich liebte es, während unserer Ausflüge über diese Balken zu balancieren.
Anstatt meine Freude zu teilen, als ich ihm erzählte, dass ein unbekannter Junge sich zufällig den Weg in meine Gedanken gebahnt hatte, packte Jim die Vorderseite meines Pullovers, umklammerte die kratzige Wolle mit seiner Faust. Erst später, als ich älter war, gab er zu, wie viel Angst er an diesem Tag verspürt hatte. Wie er immer befürchtet hatte, dass so etwas passieren könnte. Spontane Verknüpfungen passieren bei telepathischen Kindern häufig. Kinder, besonders junge, haben noch wenig Kontrolle über ihre Gabe. Aber an jenem Morgen auf der Lichtung sah mein Onkel eher wütend als ängstlich aus. Er befahl mir, nie wieder mit diesem Jungen in meinem Kopf zu sprechen.
Die Erinnerung löst ein vertrautes Schuldgefühl in mir aus. Ich hatte es versprochen, die Verlinkung zu diesem neugierigen Jungen, der nur ein paar Jahre älter war als ich, zu kappen. Doch das Problem, wenn man in einer Welt aus Dunkelheit aufwächst, nur mit einem mürrischen Vormund und niemandem im gleichen Alter, ist, dass man froh ist, mit einem anderen Kind reden zu können, auch wenn man nur in Gedanken kommuniziert.
Ich ignorierte Onkel Jims Wunsch aber nicht völlig. Als der Junge erneut mit mir in Kontakt trat und ich ihn schlechten Gewissens in meine Gedanken ließ, machte ich ihm klar, dass ich ihm nicht meinen Namen verraten würde. »Das ist doch blöd«, meckerte er, als ich ihm sagte, dass ich es nicht dürfe. Aber wir machten uns einen Spaß daraus, uns Codenamen auszusuchen. Ich wählte Daisy, weil Gänseblümchen meine Lieblingsblumen waren. Er wählte Wolf, weil er Wölfe mochte.
Ich wusste, dass ich den Jungen aus meinen Gedanken hätte verdrängen sollen – buchstäblich –, aber mein Leben war einsam damals. Es gab nur Jim und mich, an einem Ort mit nur fünf Sonnenstunden am Tag und einer Menge unheimlichem Zeug, das uns umbringen wollte. Ich brauchte Wolf. Und ich mochte seine Gesellschaft. Das tue ich immer noch, auch wenn er mich damit aufzieht, dass ich Herzen breche.
»Ernsthaft«, sagt er jetzt. »Wie lief dein Abend? Ich muss so was stellvertretend durch dich erleben. Bei mir ist’s schon ein paar Monate her …«
Das überrascht mich. Aus der selbstgefälligen Art, mit der er sonst prahlt, habe ich geschlussfolgert, dass er bei Frauen sehr beliebt ist.
»Wie kommt’s?«
»Ich war beschäftigt.«
»Deshalb warst du so ruhig in letzter Zeit.« Ich hatte seit Wochen nichts von ihm gehört, bevor er sich vorhin meldete.
Doch ich frage ihn nicht, womit er beschäftigt war, denn er würde mich auch nie fragen. Das ist der Standard, wenn man ein Mod ist. So etwas wie vollkommenes Vertrauen gibt es nicht. Nicht mal Jim, der Mann der sein Leben für mich und meine Eltern riskiert hatte, theoretisch die einzige Person, der ich bedingungslos vertrauen sollte, bekommt nicht volle hundert Prozent von mir. Ansonsten wüsste er über Wolf Bescheid.
»Um deine Frage zu beantworten, es hat Spaß gemacht. Aber er wurde am Ende ein bisschen zu anhänglich. Hat gefleht, mich wiederzusehen. Aber das kann ich ihm wohl nicht übel nehmen. Ich bin der Hammer.«
Das löst ein Lachen aus. »Arrogante Bitch.«
Ich muss auch lachen, aber mir vergeht der Spaß, als ich an Jordans ernsthaftes Drängen denke, mich wiederzusehen.
»Macht es dir manchmal was aus?«, frage ich Wolf.
»Was?«
»Primes anzulügen. Die, mit denen du schläfst. Oder deine Freunde aus der Oberstufe. Kollegen. Du weißt schon, die Guten. Fühlst du dich schlecht dabei?«
Es ist einen Moment lang still.
»Manchmal«, gibt er zu. »Aber ich ziehe die gelegentlichen Schuldgefühle der Alternative vor. Oder besser, den Alternativen, Mehrzahl. Man weiß ja nie, wie ein Prime reagiert, wenn er herausfindet, dass sein Geliebter oder Klassenkamerad oder Arbeitskollege ein Silverblood ist.«
Damit liegt er nicht falsch. Im besten Fall sind sie schockiert, aber gewillt, deine Identität geheim zu halten. Der wahrscheinlichere Fall? Sie zeigen dich an und kommen zu deiner Hinrichtung – zum Jubeln, wenn das Erschießungskommando den Abzug drückt.
»Was ist los, Daisy? Hast du etwa ein schlechtes Gewissen, weil du deinen Soldaten heute Abend angelogen hast?«
»Nicht so richtig. Ich fühle mich nur … entmutigt, weil er nie erfahren wird, wer ich bin. Er hat keine Ahnung, dass er die ganze Nacht mit einer Frau verbracht hat, die er nie wirklich kennenlernen wird. Manchmal wünschte ich mir, andere Leute könnten mich kennenlernen.«
»Ich kenne dich.« Seine Stimme klingt heiser in meinem Kopf. »Zählt das?«
Mein Herz zieht sich zusammen, und ich muss den plötzlichen Klumpen in meinem Hals runterschlucken. »Ja. Das tut es.« Ich warte noch kurz, um die Spannung zu lösen. »Okay, ich muss jetzt aufhören. Ich versuche, mich aufs Fahren zu konzentrieren. Du weißt ja, ich kann nicht telepathisch sprechen und fahren.«
»Das ist keine feste Regel.«
»Wenn es nach Redden ginge, wäre es eine.«
Vielmehr noch: Wenn es nach unserem geschätzten Anführer ginge, wäre Telepathie komplett verboten und verschwunden, weil wir dann alle tot wären. Er hatte es fast schon geschafft, uns vor fünfundzwanzig Jahren während der Silberblütersäuberung auszulöschen, bevor er den Kontinent übernahm. Seine Männer zerrten Zehntausende Mods aus ihren Häusern, um sie zu exekutieren. So sehr hasst er uns.
Das Traurige ist, dass der Coup nicht so erfolgreich gewesen wäre, gäbe es nicht Horden von Menschen, die ihm zustimmten. Dass wir abnormal seien. Abscheulichkeiten mit unnatürlichen Fähigkeiten, auch wenn die Dinge, die ich mit meinen Gedanken tun kann, für mich so natürlich sind wie Atmen.
Ich drossele mein Tempo, als ich mich der langen Einfahrt zu unserem Grundstück nähere. Bald kommt unsere Ranch in Sicht, das alte Halbetagenhaus und eine Handvoll Nebengebäude auf einem weitläufigen Grundstück, das viel zu groß für uns beide ist. Unsere zweihundertköpfige Rinderherde braucht jedoch viel Platz.
Onkel Jim hatte ziemlich gute Beziehungen, als wir aus den Blacklands auftauchten, und schaffte es, uns einen erstklassigen Standort zu sichern, und das auch noch in einem Vermögensbezirk. Uprising war immer gut zu Jim, dessen aufständische Bemühungen unter dem Namen Julian Ash so zahlreich wie effektiv waren. Leider machten ihn diese Bemühungen auch zu einer Person von großem Interesse für das Kommando. Onkel Jim ist für den Rest seines Lebens ein gejagter Mann.
Jetzt, wo es stockdunkel ist und nur der schwache Schein des Solardaches mich lotst, werde ich an die Blacklands erinnert. Die ewige Nacht. Es klingt total bescheuert, aber manchmal vermisse ich es. Es war eine leichtere Zeit.
Drei Jahre Überlebenskampf … wie leicht! Mein Unterbewusstsein lacht mich aus.
Ja, okay. Es war schwierig und nicht zu vergessen, schrecklich ermüdend, immer wachsam sein zu müssen. Einmal fiel ich von einem von Onkel Jim’s Balken in eins der schwarzen Erdlöcher und bemerkte, wie schnell ich ertrunken wäre, wäre ich allein gewesen, ohne Jim, der mich rauszog. Für ein kleines Mädchen war das Furcht einflößend.
»Warum warst du so lange weg?«, fragt mein Onkel, als ich das Haus betrete.
Er sitzt in seinem verschlissenen Ledersessel und nippt an einem Glas synthetischem Whiskey. Er klagt immer, dass synthetischer Alkohol nichts im Vergleich zu echtem sei. Doch ich habe noch nie puren Alkohol probiert und kann es schlecht beurteilen.
»Du musstest nicht auf mich warten.«
»Ich muss nichts tun, was ich nicht möchte.« Seine dunkelbraunen Augen verfolgen meine Bewegungen, während ich mein Gewehr mit dem Riemen an den Haken an der Tür hänge. »Wie war die Feier?«
Ich zögere, frage mich, wie viel ich ihm erzählen soll. Ich entscheide mich für die Wahrheit, denn wir wissen beide, dass er mich direkt durchschaut, wenn ich versuche zu lügen.
»Reg’ dich jetzt nicht auf«, fange ich an.
»Verdammt noch mal, Wren«, knurrt er.
»Ich habe gesagt, du sollst dich nicht aufregen.« Ich nähere mich seinem Sessel und verschränke die Arme vor der Brust. »Es ist keine große Sache, versprochen. Und ich glaube, du wirst sogar sagen, dass ich richtig gehandelt habe. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre Robbie jetzt nämlich tot.«
»Wer zum Teufel ist Robbie?«
Ach ja, Jim hat nie versucht, sich mit den Bürgern von Hamlett anzufreunden. Er ist ein Einsiedler. Und irgendwie auch ein schwieriger Typ. Die anderen Dorfbewohner kennen ihn nur als den grummeligen Einzelgänger, der ein paarmal im Monat vorbeischaut, um sich flachlegen zu lassen oder Whiskey in Mr Pauls Laden zu kaufen. Manchmal, wenn ihm nach mehr Gesellschaft ist, geht er für eine Mahlzeit und ein Bierchen in die Kneipe. Doch er hält sich nicht groß mit Höflichkeiten auf. Trotz seines Nachnamens ist es wahrscheinlicher, ein »Verpiss dich!« von Jim Darlington zu hören zu bekommen, als ein »Hallo«. Ich vermute, dass jemand bei Uprising das Wort Darling seiner neuen Identität hinzugefügt hat, um ihn zu ärgern.
Er ist aber loyal. Mir gegenüber. Seinen Freunden bei Uprising gegenüber. Wenn er jemanden liebt und ihm vertraut, würde er bis ans Ende der Welt gehen, um ihn zu beschützen. Er hat mich in die verdammten Blacklands gebracht, um mich in Sicherheit zu bringen.
Wenn er eine Person jedoch weder liebt noch ihr vertraut – dann sollte man sich von ihm fernhalten, denn Jim ist kratzbürstiger als unser Kaktus hinterm Haus.
»Robbie ist Rachel Solways Sohn, und er wurde gerade fast von einem weißen Kojoten getötet. Der gleiche, der uns schon angegriffen hat.«
»Dieses verdammte Hybrid-Biest ist eine Plage.«
»Ja, eine hungrige Plage, denn es hat den Jungen attackiert. Also hab ich es getötet.« Ich stocke, als Jim die Augen zusammenkneift. Er kennt mich gut. »Es war ein beeindruckender Schuss.«
Er legt die Stirn in Falten. »Wie beeindruckend?«
»Der Controller hat es sogar kommentiert. Hat gesagt, du hättest mich gut unterrichtet.«
»Wren.« Er sagt meinen Namen, als wäre er ein Fluch.
»Es tut mir leid! Was hätte ich sonst tun sollen, das Kind einfach sterben lassen?«
»Ja.«
»So wie du mich hast sterben lassen, ja?«, fordere ich ihn heraus.
»Das ist etwas anderes. Ich hatte deinen Eltern versprochen, dich zu retten.«
»Vielleicht habe ich Rachel ja versprochen, ihren Sohn zu retten. Ich meine, ich habe dieses Versprechen gemacht, drei Sekunden nachdem ich den Hybrid-Koyoten sah, aber ich habe es trotzdem eingelöst.«
»Ich will nicht, dass du Aufmerk…«
»Aufmerksamkeit auf dich ziehst«, vollende ich in gelangweiltem Ton. »Ja. Das verstehe ich. Aber ich bin erwachsen und ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Falls du es vergessen hast, ich arbeite für das Netzwerk.«
Er stößt ein zynisches Lachen aus. »Du arbeitest nicht für sie. Du hast nur ein paar kleine Gelegenheitsjobs erledigt. Das bedeutet rein gar nichts.«
Ich öffne empört den Mund, aber er unterbricht mich.
»Du warst noch nie im Kampf. Musstest noch nie versuchen, in der Stadt zu überleben.«
»Ich habe schon viel Schlimmeres überlebt«, entgegne ich.
»Nein, das hast du nicht. Das da unten ist eine Grube voller Giftschlangen. Du darfst niemals aus deiner Deckung in Point City. Niemals.«
»Ich habe einen Vorteil«, erinnere ich ihn und versuche, nicht zu selbstgefällig zu wirken, als ich meine nackten Arme vorstrecke. Ich schalte auf Telepathie um, um meinen Standpunkt zu untermauern.
»Siehst du? Nichts passiert in meinen Adern. Ich kann in der Stadt arbeiten, ohne entdeckt zu werden.«
»Klar, Kleines. Bis du wieder aus Versehen jemanden manipulierst. Wie willst du dich dann rausreden, hm?«
Seine Worte bringen mich dazu, mich an der Hüfte zu kratzen. Eine reflexartige Bewegung. Meine Verbrennung dort existiert nur wegen diesem Mann. Meinem Vormund. Der Person, dich mich eigentlich beschützen sollte.
Es hatte wirklich wehgetan. Ich erinnere mich noch an den Geruch verbrannter Haut. Es geschah zu meinem Besten, wie ich jetzt weiß, aber das heißt nicht, dass ich ihn nicht auch ein bisschen dafür hasse, dass er mir das angetan hat.
»Sei nicht so dramatisch. Ich habe seit Jahren nicht manipuliert«, brumme ich.
Doch zugleich hat er recht. Wenn es passiert, passiert es meist unerwartet. Wir haben über die Jahre hinweg hart trainiert, um es kontrollieren zu können, aber vergeblich. Ich kann nicht mal genau sagen, wie ich manipuliere. Das erste Mal, als ich es bei Jim tat, war ich sieben Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits seit Stunden, Tagen, Monaten auf unserer Lichtung geübt. Jeden Morgen saßen wir uns gegenüber, neben ihm sein Messer im Gras liegend, während er mir befahl, eine Verbindung herzustellen, mir einen Weg in seinen Verstand zu bahnen, und ihn zu zwingen, sein Messer aufzuheben. Es aufzuheben und sich in die Handfläche zu schneiden.
»Sag es noch einmal, Wren«, befahl er an jenem Morgen.
Also tat ich es noch einmal. Wieder und wieder in meinem Kopf: Heb das Messer auf, heb das Messer auf. Doch seine Hand rührte sich nicht.
Irgendwann fing ich zu jammern an. »Ich will das nicht mehr machen. Bitte.«
»Du musst weitermachen. Du musst in der Lage sein, deine Fähigkeiten zu kontrollieren.«
»Aber warum?«
»Weil sie dich töten werden, wenn sie wissen, dass du sie hast.« Jim hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, nicht mal vor verängstigten kleinen Mädchen. »Versuch mal, es laut auszusprechen«, riet er mir. »Ich habe gehört, dass das manchmal hilft.«
Gehorsam benutzte ich meine Stimme. »Heb das Messer auf, heb das Messer auf …«
Wieder und wieder und wieder. Ich wurde immer frustrierter und wütender wegen dieser sinnlosen Übung, in meinem Kopf summte es lauter und lauter, bis sich eine Welle der Energie in mir aufbaute und dann …
Er hob das Messer auf und schnitt sich eine Linie in die Mitte seiner Handfläche. Ich war so verängstigt, dass ich in unsere Hütte rannte und sie für mehrere Stunden nicht verließ.
»Planst du immer noch, diese Woche in den Bezirk T zu fahren?«, frage ich, um das Thema zu wechseln. Ich bin seine Belehrungen leid. Ich bekomme mindestens einen Jim-Vortrag am Tag, und wir haben diese Quote heute Morgen schon erfüllt, als er mich rügte, weil ich vergessen hatte, Kelleys Stall auszumisten.
»Wahrscheinlich übermorgen. Lass mich wissen, ob du irgendetwas von dort brauchst.«
»Mach ich, danke. Und wag es bloß nicht zu gehen, ohne dich zu verabschieden.«
»Niemals«, sagt er schroff, und jede Genervtheit, die ich bis eben verspürt habe, schmilzt dahin.
Als ich zehn war, verschwand Jim für eine Woche wegen einer Mission für Uprising. Einfach so und ohne ein Wort zu sagen. Er schickte Tanas Vater zur Ranch, um bei mir zu sein. Als er dann einige Tage später zurückkam, war er völlig entgeistert, warum ich denn so aufgebracht war. Nachdem er einen ganzen Tag lang mein Schweigen ertragen hatte, versprach er mir, mich nie wieder zu verlassen, ohne mir vorher Lebwohl zu sagen.
Jim ist ein zäher Mann, aber ich weiß, dass er mich liebt. Ich bin mir sicher, dass er sich sein Leben anders ausgemalt hat. Vor fünfzehn Jahren wurde er von einem 30-jährigen Kommando Colonel zu einem gejagten Deserteur, verantwortlich für eine Fünfjährige, deren Leben ihm anvertraut worden war. Er wurde gezwungen, alles zurückzulassen. Seine Karriere, sein Zuhause, seine Freunde. Aber er tat es. Für meine Eltern. Für mich.
»Na gut. Ich leg mich hin.« Er hievt sich aus seinem Sessel. »Gute Nacht, Little Bird.«
Dieser Kosename bringt mich zum Lächeln. »Gute Nacht.«
In meinem Zimmer wasche ich mich und mache mich bereit zum Zubettgehen. Ich gleite in den Schlaf und denke dabei nicht an den Soldaten, mit dem ich den Abend verbracht habe, sondern an den heißen, unhöflichen Fremden im Gasthaus.
–––
Bei Tagesanbruch mache ich mich auf den Weg zum Stall, um meine sanfte Appaloosa-Stute zu satteln. Ich könnte den Geländewagen nehmen – das wäre schneller – aber ich liebe meine Zeit mit Kelley. »Hey, du Schöne,« gurre ich und lasse die Hand über ihren gefleckten Rücken gleiten. Sie hat die schönste dunkelbraun-weiße Färbung, die ich je gesehen habe, und in ihren großen, glänzenden Augen spiegelt sich mein lächelndes Gesicht. »Bereit, einen Zaun zu reparieren?«
Kelley wiehert. Ich nehme das als Zustimmung und steige auf, die Lederzügel locker in der Hand, während ich sie von den Ställen weg in Richtung Weg lenke.
Das Schlimmste an der Viehzucht sind die lästigen Aufgaben. Sosehr ich es auch möchte, kann ich nicht die ganze Zeit auf Kelley reiten und im Bach schwimmen gehen. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Tiere zu füttern, Ställe auszumisten und Wassertröge aufzufüllen. Und das sind noch die spaßigeren Aufgaben. Zäune zu reparieren ist meine ungeliebteste Aufgabe, aber eine der wichtigsten. Unsere Zäune halten unsere Kühe drinnen und die Raubtiere draußen.
Kelley und ich reiten auf die nördliche Weide, wo ich absteige und sie grasen lasse, während ich das kaputte Stück Zaun suche, von dem mein Onkel mir erzählt hat. Ich mache mich schnell an die Reparatur und ziehe mit einem Drahtspanner die Ränder der Lücke straff zusammen, sodass ich sie mit einer Quetschhülse wieder verbinden kann. Danach verbringe ich den restlichen Vormittag damit, jeden Zentimeter des Zauns zu inspizieren, bis ich mich vergewissert habe, dass es keine Zugangspunkte für die weißen Kojoten gibt, die unsere Herde angreifen wollen.
Als ich gerade meine dicken Arbeitshandschuhe abstreife, versucht Onkel Jim plötzlich, eine Verbindung herzustellen. Eine Sekunde später flutet seine Warnung meinen Kopf.
»Komm nicht zum Haus zurück. Bleib weg.«
Meine Schultern straffen sich sofort. »Warum? Was ist los?«
»Das Kommando ist hier«, ist seine verbissene Antwort.
Mein Herzschlag verdoppelt sich. Warum ist das Kommando bei uns? Wir werden vor einer Inspektion sonst immer gewarnt.





























