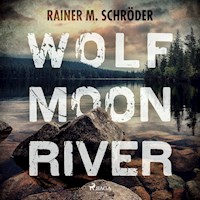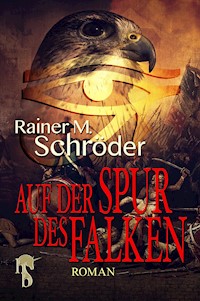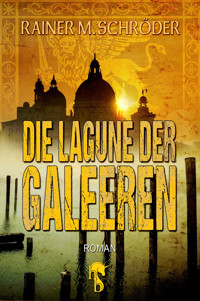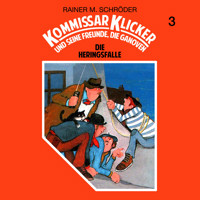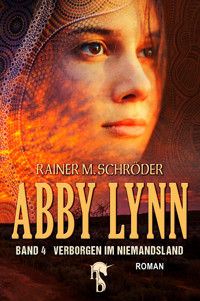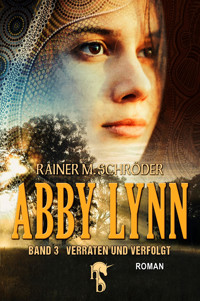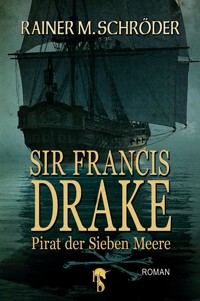
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Francis Drake – allein der Name des Freibeuters und Entdeckers lässt die Feinde Englands in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erzittern. Francis Drake überfällt und plündert, angetrieben von persönlichem Ehrgeiz und einem unbändigen Hass auf alles Katholische, die spanischen Kolonien in der Karibik und in Mittelamerika. Im Auftrag der Königin Elisabeth I. macht er sich im Jahre 1577 erneut auf zu einem Beutezug in die Karibik. Doch oft ist es ungewiss, wie die Reise enden wird. Nicht nur die Unwägbarkeiten des Wetters drohen, das Unternehmen zum Scheitern zu bringen, sondern auch Verrat und politische Intrigen. Wenn Francis Drake und seine Mannschaft es schaffen, wieder in den Hafen von Plymouth einzulaufen, liegt hinter ihnen das größte Abenteuer ihrer Zeit: die Umseglung der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Sir Francis Drake
Pirat der Sieben Meere
Roman
1.
John Hampton war am Ende seiner Kräfte. Die Beine drohten ihm den Dienst zu versagen. Sein hagerer, ausgemergelter Körper protestierte mit heftigen Schmerzwellen gegen diese Strapaze. Er stolperte mehr, als dass er lief. Der unbändige Hass jedoch, der in ihm loderte, trieb ihn weiter.
Er musste es schaffen und die anderen warnen!
Mit keuchendem Atem und schmerzverzerrtem Gesicht rannte er durch den dichten Wald. Sonnenlicht fiel durch das grüne Blätterdach hoch über ihm und warf helle Flecken auf sein stoppelbärtiges, blutüberströmtes Gesicht. Über den buschigen Augenbrauen klaffte eine breite Platzwunde, die sich quer über die Stirn zog. Und schweißnass klebte das graue, strähnige Haar am Kopf des fünfundvierzigjährigen Mannes.
Zweige peitschten schmerzhaft durch sein Gesicht, als er sich einen Weg durch das verfilzte Dickicht zwischen den Bäumen bahnte. Dann endlich erreichte er den Waldrand, und vor ihm erstreckten sich die weiten, fruchtbaren Felder und kräftig grünen Wiesen, die die hügelige Landschaft um Crowndale in der englischen Grafschaft Devon prägten. Keine dreihundert Yards vom Waldrand entfernt lag der Bauernhof seines Freundes Edmund Drake, der nach langen Jahren zur See eine Familie gegründet und hier in Crowndale sesshaft geworden war.
Benommen taumelte John Hampton aus dem kühlen Schatten der hohen Bäume in das grelle Licht der Morgensonne. Einen Augenblick blieb er schwankend stehen und rang nach Atem. Am liebsten hätte er sich ins Gras fallen lassen, aber diesem quälenden Wunsch gab er nicht nach. Er wusste nur zu gut, dass alles verloren war, wenn er sich jetzt hinsetzte.
Er musste einfach weiter!
Bevor John Hampton wieder loslief, blickte er mit zusammengekniffenen Augen nach links. Dort führte, gut zweihundert Yards entfernt, ein breiter Sandweg mit tiefen Spurrillen, die von den schweren Rädern der Oberlandkutschen und Fuhrwerke der Bauern herrührten, durch eine Waldlichtung und schlängelte sich durch die angrenzenden Wiesen und Felder. Die Landstraße verlief in einem Bogen um Edmund Drakes Bauernhof herum und führte dann hinunter nach Crowndale.
Noch lag die Straße ausgestorben im Licht der frühen Morgensonne dieses unheilvollen Pfingstsonntages. Man schrieb das Jahr 1549. Eine scheinbar friedliche Stille lag über dem Land. Doch diese Ruhe war trügerisch. Jeden Augenblick konnten nämlich die aufständischen Katholiken dort auf der Lichtung auftauchen und Feuer und Tod auch hinunter nach Crowndale tragen.
Der Gedanke an das, was die Aufständischen in seinem Dorf jenseits des Waldes angerichtet hatten, verlieh John Hampton neue Kräfte, und er rannte auf den Bauernhof zu.
Francis Drake bemerkte als Erster die hagere Gestalt, die durch das Kornfeld taumelte. Der siebenjährige Junge mit den braunen Haaren und den hellen Augen hockte auf den steinernen Stufen, die zur breiten Tür des Bauernhauses hochführten. Er trug ein einfaches, aber sauberes Leinenhemd, das mit einem dünnen Lederriemen vor der Brust zugeschnürt wurde. Die braune Hose reichte ihm knapp bis zu den Knien.
Francis wartete auf seine Eltern und Geschwister. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er sein Messer zur Hand genommen und schnitzte einen Birkenstock zurecht. Als er nun den Mann entdeckte, der auf den Bauernhof zu rannte, war er nicht etwa erschrocken, sondern einfach nur gespannt, wer das wohl sein mochte und welche Nachricht er brachte. Auch als die Gestalt wild mit den Armen durch die Luft fuchtelte und ihm irgendetwas Unverständliches zuschrie, war Francis noch weit davon entfernt, beunruhigt zu sein. Er hielt nur im Schnitzen inne.
Es kam nicht selten vor, dass Bettler, Straßenhändler und merkwürdige Gestalten, die nicht ganz klar im Kopf waren, auf dem Bauernhof erschienen. Francis hatte sich nie vor ihnen gefürchtet, auch nicht, als er noch kleiner gewesen war. Stets hatte er sie mit unstillbarer Wissensgier beobachtet, so, als wollte er sich nichts entgehen lassen, was das Leben in seiner Vielfalt zu bieten hatte.
Schließlich war John Hampton so weit herangekommen, dass Francis das blutüberströmte Gesicht und das zerfetzte Hemd des Mannes sehen konnte. Er erkannte John Hampton jedoch nicht.
Francis Drake legte den Birkenstock beiseite und erhob sich. Das Messer behielt er in der Hand. Eine leichte Unruhe erfüllte ihn nun doch.
»Dad! … Da kommt jemand!«, rief er über die Schulter ins Haus, ohne sich von der Stelle zu rühren. Und nach kurzem Zögern fügte er hinzu: »Er ist im Gesicht ganz blutig!«
John Hampton torkelte über den sandigen Vorplatz des Bauernhofes. Beinahe wäre er zu Boden gestürzt, so erschöpft war er. »Francis …«, keuchte er und fasste sich an die Brust. Er hatte das Gefühl, als müssten seine Lungen jeden Augenblick platzen.
Erschrecken trat in die wachsamen Augen des Jungen. Hastig steckte er das Messer weg, als schämte er sich, es in der Hand behalten zu haben, und lief ihm entgegen. Einen Schritt vor ihm blieb er stehen.
»Onkel John!« Er starrte ihn fassungslos an.
John Hampton verzog das Gesicht. »Habe ich dir einen Schrecken eingejagt?«
Francis schüttelte stumm den Kopf.
»Ich sehe zum Fürchten aus, nicht wahr? Bestimmt hast du mich für einen üblen Strolch gehalten.« John Hampton versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen, als er sah, wie erschrocken Francis ihn anschaute. Das Lächeln geriet ihm jedoch zur Grimasse, und er schmeckte sein eigenes Blut auf der Zunge.
»Du blutest!«
»So schlimm, wie es aussieht, ist es nicht, mein Junge«, beruhigte John ihn. »Nur eine Platzwunde. Habe schon ganz andere Sachen überlebt.« John Hampton besann sich darauf, dass keine Zeit zu verlieren war, und ging schleppenden Schrittes auf das Hauptgebäude des Bauernhofes zu.
In diesem Augenblick trat Edmund Drake, ein Mann von untersetzter, kräftiger Gestalt, aus der Tür. Man sah auf den ersten Blick, dass Francis das volle, braune Haar und die hellen Augen von seinem Vater geerbt hatte.
»Um Gottes willen, John!«, rief Edmund Drake erschrocken. »Wer hat dich so zugerichtet?«
John Hampton verzog hasserfüllt das zerschundene Gesicht. »Die verfluchten Katholiken sind über uns hergefallen, Edmund. Sie haben mein Haus niedergebrannt … und nicht nur meins. Ich habe geahnt, dass es so kommen würde.«
Die ganze Familie Drake strömte nun aus dem Bauernhaus. Francis hatte noch elf Geschwister. Sie alle scharten sich aufgeregt um John Hampton, der allmählich wieder zu Atem kam.
Mary, Edmund Drakes stille, aber resolute Frau, warf nur einen kurzen Blick auf Johns Gesicht und eilte ins Haus zurück. Sie holte Salbe, einen Kübel kaltes Wasser und lange Streifen aus Leinenstoff.
»Wie die Heuschrecken sind sie über uns hergefallen«, berichtete John Hampton, während Mary seine Kopfwunde säuberte, kühlte und verband. Dabei hockte er auf einem dreibeinigen Schemel. »Ehe ich recht begriff, was passierte, standen die Häuser meiner Nachbarn schon in Brand. Ich konnte nicht das Geringste tun. Sie waren in der Überzahl. Mindestens vierzig Katholiken. Wie die tollen Hunde sind sie über uns hergefallen!«
»Schon gut«, versuchte Edmund Drake ihn zu beruhigen und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Hauptsache, du bist mit dem Leben davongekommen.«
Hampton sah mit düsterem Blick zu ihm hoch. »Das war pures Glück, Edmund. Als ich von dem Geschrei alarmiert aus meiner Werkstatt rannte, lief ich geradewegs in eine Gruppe Aufständischer hinein. Ich wehrte mich so gut ich konnte, aber sie umringten mich sofort. Ich bekam einen fürchterlichen Schlag gegen den Kopf und stürzte bewusstlos zu Boden.«
John Hampton tastete unwillkürlich über den Verband und fuhr dann fort: »Das hat mir das Leben gerettet. Die Burschen hielten mich wohl für tot. Als ich wieder zu mir kam, stand auch meine Fassbinderei in Flammen. Ich sah, wie sie unsere Gebetsbücher verbrannten. Niemand bemerkte, dass ich mich davonschlich.«
Mary blickte ihren Mann mit mühsam unterdrückter Angst an. »Sie werden auch nach Crowndale kommen.«
John Hampton nickte. »Sie sind schon auf dem Weg. Und sie werden hier genug Leute finden, die sich ihnen anschließen. Deshalb bin ich so schnell ich konnte die Abkürzung durch den Wald gelaufen, um euch zu warnen. Sie werden bald da sein!«
»Wir werden sie gebührend empfangen!«, knurrte Edmund Drake.
»Widerstand ist sinnlos!«, widersprach der Fassbinder heftig. »Wir haben nicht die geringste Chance. Sie sind in der Überzahl, Emund, glaub mir. Und der Aufstand hat erst begonnen. Die Katholiken werden sich in ganz Devon erheben. Kein Protestant ist jetzt seines Lebens noch sicher. Ihr müsst fliehen!«
»Ich soll das alles aufgeben?« Edmund Drake machte eine Handbewegung, die den Bauernhof und die Felder umschloss. »Für all das habe ich hart gearbeitet …«
»Wir alle haben hart gearbeitet«, fiel der Fassbinder ihm ins Wort, »aber das wird uns nicht helfen. Es ist sinnlos, sich dieser Meute in den Weg stellen zu wollen. Sie brennen alles nieder und bringen jeden Protestanten, den sie in die Hände bekommen, gnadenlos um.«
Emund Drakes Blick wanderte zum Haupthaus und den sich anschließenden Stallungen und Scheunen hinüber. Er hatte es zu etwas gebracht. Durch jahrelange, harte Arbeit. Nichts war ihm in den Schoß gefallen. Und das sollte er nun kampflos aufgeben und einfach den Katholiken überlassen?
»Warum fügen sich die verdammten Katholiken nicht in die Entscheidung unseres Königs?« Ohnmächtige Wut klang aus Edmunds Stimme, und er ballte die rechte Hand zur Faust.
»Weil sie nur den Popen in Italien als ihr Oberhaupt akzeptieren«, antwortete John Hampton wütend. »Für sie ist Rom der Nabel der Welt und nicht London.«
Der Fassbinder hatte damit den Kern getroffen.
Vor über fünfzehn Jahren hatte sich König Heinrich der VIII. vom Papst in Rom losgesagt und sich selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche gemacht – und zwar aus einem sehr weltlichen Grund: Der Papst war nicht bereit gewesen, die zweite Ehe des Königs für nichtig zu erklären.
Die ungeheuerliche Entscheidung des englischen Königs, sich selbst zur letzten Instanz Gottes auf Erden zu erheben, hatte der Papst mit dem Bannfluch beantwortet. Heinrich der VIII. hatte sich vom Bannfluch jedoch nicht daran hindern lassen, den Aufbau einer von Rom unabhängigen, anglikanischen Kirche in Angriff zu nehmen.
Nach dem Tod Heinrich des VIII. hatte sein Thronfolger das protestantische Reformprogramm, das auf erbitterten Widerstand der Katholiken gestoßen war, mit Nachdruck fortgesetzt. Die Katholiken, die auch weiterhin einzig und allein den Papst in Rom als ihr geistliches Oberhaupt zu akzeptieren gewillt waren, hatten immer wieder aufbegehrt, niemals jedoch Gewalt gebraucht.
Bis zu diesem Pfingstsonntag des Jahres 1549. An diesem Tag war das erste protestantische Gebetsbuch eingeführt worden. Diese revolutionäre kirchliche Neuerung hatte die Anhänger des römisch-katholischen Glaubens auf die Barrikaden gebracht, und dieser Aufstand sollte auf ganz Devon und Cornwall übergreifen und das Land für kurze Zeit mit einer Woge maßloser Gewalt und religiösen Terrors überschwemmen.
Davon ahnten jedoch weder John Hampton noch Edmund Drake etwas.
»Zur Hölle mit allen Katholiken!«, rief Francis Drake plötzlich und brach das lastende Schweigen, das einen Moment geherrscht hatte.
»Du kannst entweder hierbleiben und zusehen, wie dein Hof in Flammen aufgeht und deine Frau und deine Kinder ermordet werden, oder aber versuchen, dich und deine Familie in Sicherheit zu bringen«, sagte John Hampton und zuckte mit den Achseln. »Es ist deine Entscheidung, Edmund. Musst wissen, woran dir mehr liegt. Ich für meinen Teil sehe zu, dass ich so schnell wie möglich von hier verschwinde. Diese blutrünstigen Teufel können jeden Augenblick drüben am Waldrand auftauchen.« Er erhob sich so abrupt, dass der Schemel umkippte.
»Warte!« Edmund Drake umklammerte die rechte Hand des Fassbinders mit eisernem Griff und starrte ihn finster an, als wollte er ihn für den Aufstand der Katholiken verantwortlich machen.
»Hast du dich endlich entschieden?«, fragte John.
Edmund Drake nickte knapp. »Wir verschwinden!«, stieß er bitter hervor und gab mit befehlsgewohnter Stimme Anweisungen. »Jane und Anne, geht in die Speisekammer und füllt einen Sack mit Proviant. Francis und Peter, ihr spannt die beiden Braunen vor das Fuhrwerk. Mary, du kümmerst dich um das, was vom Hausstand aufgeladen werden soll. Denkt daran, dass wir nur das allernotwendigste mitnehmen können. Und jetzt beeilt euch!«
Wenige Minuten später drängten sich die Kinder zwischen zwei Kisten und drei Leinensäcken auf der Ladefläche des Fuhrwerkes. Edmund, seine Frau sowie John hatten vorn auf dem Kutschbock Platz genommen. Rumpelnd setzte sich der Wagen in Bewegung. Die Räder knirschten über Sand. Edmund Drake wandte sich nicht ein einziges Mal um. Er blickte stur geradeaus.
Francis dagegen ließ den Bauernhof nicht aus den Augen. Merkwürdigerweise erfüllte ihn nicht nur Trauer, sondern auch Freude. Es war schlimm, dass sie alles aufgeben mussten was ihnen wert und vertraut war. Andererseits war diese Flucht aber auch ein aufregendes Abenteuer.
»Da! … Die Katholiken!«, rief John Hampton plötzlich. »Sie kommen!«
Alle, mit Ausnahme von Edmund Drake, blickten sich nun um. Über vierzig Männer kamen aus dem Wald und folgten mit offensichtlicher Eile der staubigen Landstraße.
Sie waren mit Äxten, Mistgabeln, Dreschflegeln und langen Messern bewaffnet, die im Sonnenlicht blitzten. Einige von ihnen trugen zudem noch brennende Fackeln.
Edmund Drake packte die Zügel fester und trieb die Pferde zu einem schärferen Tempo an. Kein Wort kam über seine Lippen. Sein Gesicht war wie aus Stein gemeißelt.
»Sie stecken die Scheune in Brand!«, stieß Francis wenig später hervor, als Flammen an dem langgestreckten Anbau hochleckten und prasselnd über dem Dach zusammenschlugen.
»Irgendwann werden sie dafür büßen!«, rief der Fassbinder mit heiserer Stimme und drohte mit der geballten Faust. Eine Geste ohnmächtiger Wut.
Francis bemerkte plötzlich, dass seine Mutter still weinte. Und auf einmal spürte er einen grenzenlosen Hass auf die Katholiken, der alle anderen Empfindungen wie eine stürmische Bö hinwegfegte.
2.
Ein kühler Wind blies aus Nordost und blähte die Segel der Schiffe, die auf dem Medway-Fluss kreuzten. Francis Drake hockte hoch über dem Wasser auf der schmalen Plattform des Ausgucks und blickte sehnsüchtig zu den stolzen Segelschiffen hinüber. Er war jetzt zwölf Jahre alt und wünschte sich nichts sehnlicher, als auf einem dieser Schiffe Dienst tun zu dürfen. Mit vom auffrischenden Wind geröteten Augen beobachtete er, wie die Seeleute an Bord einer stattlichen Karavelle mit atemberaubender Schnelligkeit die Wanten des Großmastes aufenterten und das Segel refften. Heisere Rufe drangen über das Wasser zu ihm ans Ufer.
Und in diesem Augenblick hasste Francis Drake das abgetakelte, verrottete Schiff unter ihm noch mehr, als er es sonst schon tat. Voller Abscheu blickte er auf das namenlose Schiff hinunter, das nun schon seit Jahren der Familie Drake als billiges und armseliges Quartier diente.
Es sah abstoßend hässlich aus ohne Klüverbaum und Bugspriet. Ein Großteil der Reling fehlte. Die Decksplanken waren morsch und teilweise aufgebrochen. Alles, was auch nur einen Penny wert gewesen war, hatte man abmontiert. Aus dem Vorderdeck ragte der Stumpf des Fockmastes und verfaulte. Und dort, wo sich früher einmal der Besanmast auf dem Achterdeck in den Himmel gereckt hatte, klaffte ein Loch.
Merkwürdigerweise existierte der Großmast noch, zumindest bis zur Höhe des Ausgucks. Ein jämmerlicher Teil des ehemaligen Riggs und der Wanten hielt den Großmast aufrecht. Dennoch war es nicht ganz ungefährlich, zur Plattform des Ausgucks aufzuentern. Das Tauwerk der Wanten war an vielen Stellen schon brüchig, doch das hinderte Francis nicht daran, so oft es ging seinen Lieblingsplatz aufzusuchen.
Das etwa fünfzig Fuß lange Schiff mit dem hoch aufragenden Achterkastell war ein Wrack und schon seit über einem Jahrzehnt nicht mehr seetüchtig. Mit leichter Krängung nach Steuerbord lag es am Ufer des Medway und verfaulte langsam im tiefen Schlamm, in den sich der rissige, plumpe Rumpf gegraben hatte. An heißen, windstillen Sommertagen war der Fäulnisgestank, der dann aus allen Ritzen zu quellen schien, übelkeiterregend.
»Immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf und trockene Schlafstellen. Wir sind arm, brauchen aber nicht zu betteln. Dafür können wir Gott nach all dem, was wir durchgemacht haben, dankbar sein!«, hatte sein Vater ihn scharf zurechtgewiesen, als er sich einmal unbedachterweise über den unerträglichen Gestank beklagt hatte.
Sie hatten wahrlich viel durchgemacht. Und Francis würde das sein Leben lang nicht vergessen. Seit dem Aufstand der Katholiken an jenem Pfingstsonntag waren sie ständig auf der Flucht gewesen. Und in diesen Jahren der Not und der Angst hatte er die Katholiken hassen gelernt.
Seit gut zwei Jahren lebten sie nun auf diesem Wrack am Medway. Hier lag die königliche Flotte vor Anker, und weiter flussaufwärts befanden sich die Schiffswerften von Chatham. Sein Vater hatte den Traum von einem neuen Bauernhof längst aufgegeben und verdiente sich den ärmlichen Lebensunterhalt als Prediger und Bibelvorleser für die Matrosen und Schiffsbauer. Er war ein großartiger Redner und überzeugter Protestant.
»Vergiss nie, was die Katholiken uns angetan haben!« Diesen Satz bekam Francis fast täglich zu hören, denn sein Vater schickte ihn nicht in die Schule, sondern brachte ihm selbst Lesen und Schreiben bei. Er unterrichtete ihn auch gewissenhaft in Bibelkunde und führte ihn auch in die anfangs verwirrende Welt der Politik ein.
Während Francis’ Blick der Karavelle flussaufwärts folgte, erinnerte er sich daran, was sein Vater vor wenigen Tagen mit finsterer Miene prophezeit hatte.
»Wenn die Königin keine Vernunft annimmt und so weitermacht, wird es bald einen neuen Aufstand geben. Auch hier am Medway, das lasst euch gesagt sein. Und dann wird viel Blut fließen!«
Vor gut einem Jahr, also im Jahre 1553, hatte Maria I. den englischen Thron bestiegen und seitdem gegen den Widerstand der überwiegend protestantischen Bevölkerung versucht, den Katholizismus wieder in England einzuführen. Die Unzufriedenheit des Volkes war noch stärker geworden, als die Königin die Ehe mit dem Prinzen Philipp von Spanien einging. Es gärte in der Bevölkerung, und es sah wirklich so aus, als würde es bald zu einem gewaltsamen Aufstand kommen. Und was dann geschah …
»Francis!«
Der zwölfjährige Junge auf der schmalen Plattform schreckte aus seinen Gedanken auf. Er beugte sich etwas vor und blickte hinunter auf das Deck des Wracks. Er war überrascht, als er seinen Vater mit leicht gespreizten Beinen neben dem Niedergang, der unter Deck führte, stehen sah. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sein Vater aufs Schiff zurückgekehrt war.
»Komm da oben runter, Francis!«, rief sein Vater ihm zu. »Ich habe mit dir zu reden.«
»Aye, aye, Sir!«, rief Francis zurück und schwang sich mit einer geschmeidigen, oft geübten Bewegung über den Rand des Ausgucks. Geschickt turnte er an den Wanten hinunter. Er wusste, dass sein Vater jeden seiner Handgriffe in der Takelage genau und mit dem Blick des Fachmannes beobachtete. Edmund Drake erinnerte sich gern und oft an seine Jahre auf See. Für Francis waren es stets die schönsten Stunden des Tages, wenn sein Vater von seinen Erlebnissen an Bord und in fremden Ländern berichtete. Er konnte nie genug davon bekommen.
Ein verstecktes Lächeln zeigte sich auf Edmund Drakes Gesicht, als Francis sich zwei Yards über dem Deck von den Wanten abstieß und mit einem Satz direkt vor seinen Füßen landete.
»Ja?«, fragte Francis und blickte seinen Vater forschend an.
»Du möchtest Seemann werden, nicht wahr?« Edmund Drake kam sofort zur Sache. Es war nicht seine Art, mit langatmigen Einleitungen Zeit zu vergeuden.
Die Augen des Jungen leuchteten auf. »Lieber heute als morgen!«, versicherte er mit Nachdruck.
»Nun, es sind schlechte, unruhige Zeiten«, sagte Edmund Drake mit sorgenvoller Stimme und fuhr sich mit der Hand durch das schüttere, ergraute Haar. Die vergangenen fünf Jahre hatten tiefe Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. »Königin Maria wird mit allen Mitteln versuchen, uns Protestanten in die Knie zu zwingen. Aber viele werden das nicht widerstandslos hinnehmen. Blutige Zeiten stehen uns bevor.«
Mit ernstem Gesicht blickte Francis zu seinem Vater hoch und nickte stumm.
»Du hast das Zeug zu einem guten Seemann«, fuhr Edmund Drake scheinbar ohne jeden Zusammenhang fort. »Das habe ich schon immer gewusst. Außerdem bist du auf einem Schiff sicherer aufgehoben als hier am Medway.«
»Ich darf also zur See gehen?«, vergewisserte sich Francis aufgeregt.
»Ja.«
Francis hatte Mühe, seine überschwängliche Freude in Zaum zu halten. Tausend Gedanken schossen ihm durch den Kopf. »Ich … ich werde sofort zum Hafen hinunterlaufen und mich um eine Heuer bemühen«, stieß er hastig hervor. »Vielleicht kann ich schon …«
»Das brauchst du nicht«, fiel sein Vater ihm ins Wort. »Ich habe mich schon für dich umgehört. Du wirst bei Mister Sheldon anfangen.« Seine Stimme ließ keinen Widerspruch zu. »Er ist Besitzer und Kapitän der Trinity.«
Weder der Name des Kapitäns noch der des Schiffes sagten Francis etwas. Das konnte ein schlechtes, aber auch ein gutes Zeichen sein. Er hoffte nur, dass die Trinity kein Fischerboot war, denn ihn zog es hinaus auf die Meere und zu fernen Ländern.
Edmund Drake bemerkte den fragenden Blick seines Sohnes. »Die Trinity ist eine Bark, ein hübsches Schiff«, erklärte er. »Henry Sheldon ist ein alter, erfahrener Seemann. Du wirst eine Menge bei ihm lernen können, wenn du dir Mühe gibst. Zudem ist er überzeugter Protestant. Mach mir also keine Schande!«
»Und wann … wann gehe ich an Bord?«
»Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Er bricht bei Sonnenaufgang zu einer Reise nach Frankreich auf. Du meldest dich also bei ihm an Bord, sowie du deine Sachen gepackt hast.«
Viel zu packen gab es nicht. Francis rollte zwei Hemden und eine Hose zu einem Bündel zusammen, verstaute sie mit den wenigen Habseligkeiten, die ihm gehörten, in einem Leinensack und verabschiedete sich von seinen Eltern und Geschwistern. Er verließ das stinkende Wrack mit dem berauschenden Gefühl, endlich von der erdrückenden Enge und Untätigkeit befreit worden zu sein.
Frankreich!
So schnell er konnte, lief er an der Wasserfront entlang und hielt Ausschau nach der Trinity. Mehrere Dutzend Schiffe jeder Größe drängten sich im engen Hafenbecken. Plumpe Leichter und Frachtkähne lagen neben schnittigen Karavellen und mächtigen, kanonenbestückten Galeonen. Kleine Schoner und Barken ankerten zwischen den großen Segelschiffen.
Ein geschäftiges Leben und Treiben herrschte im Hafenviertel und an den Pieren. Fuhrwerke rumpelten über das Kopfsteinpflaster. Vor den Landungsstegen stapelten sich die Tonnen mit Pökelfleisch und Mehl, schwere Segeltuch-ballen und Kisten mit Waren jeglicher Art. Die Luft war erfüllt von den knappen Kommandos der Vorarbeiter, den Flüchen der Matrosen und den Anpreisungen der Straßenhändler.
Francis zwängte sich durch das Gewühl, wich einem betrunkenen Matrosen aus, sprang auf ein mit Vierkanthölzern beladenes Fuhrwerk und ließ sich ein Stück mitnehmen.
Plötzlich entdeckte er die Trinity am Ende der Pier. Er hechtete vom Fuhrwerk, schulterte den Leinensack und musterte die Bark mit kritischen Blicken. Der Dreimaster mit dem Gaffelsegel am Besanmast gefiel ihm auf Anhieb. Der kräftige Rumpf der Bark verriet, dass nicht Schnelligkeit, sondern gute Segeleigenschaften bei jedem Wetter die starke Seite dieses Schiffes waren. Obwohl sich an Deck neben der Frachtluke Kisten und Tonnen stapelten, machte das Schiff einen fast erschreckend sauberen und aufgeräumten Eindruck. Nirgends lag ein Tau oder ein Tampen herum. Alles war ordentlich aufgeschossen oder belegt. Und als Francis zu den hohen Masten hochblickte, die sanft hin und her schwangen, stellte er fest, dass die eingeholten Segel mit Zeisings sorgsam festgezurrt waren.
Francis überschäumende Begeisterung erhielt einen kleinen Dämpfer, als ihm klar wurde, dass Kapitän Henry Sheldon seinen Matrosen offensichtlich mehr abverlangte als viele andere Schiffseigner. Francis machte sich keine Illusionen. Harte Arbeit wartete auf ihn. Sein Vater hatte schon gewusst, weshalb er ihm eine Stelle als Decksjunge an Bord der Trinity verschafft hatte.
Fest entschlossen, seine Chance zu nutzen und sich nicht unterkriegen zu lassen, schritt Francis Drake über das Fallreep und betrat das Deck der Bark durch die Schanzkleidpforte. Matrosen in verwaschenen, himmelblauen Hosen und weiten Jacken rannten geschäftig über das Deck.
Plötzlich stand ein Mann vor ihm. Francis wusste sofort, dass er es mit Henry Sheldon zu tun hatte. Der Kapitän war von kleiner Gestalt. Doch niemand wäre auch nur einen Augenblick auf die Idee gekommen, ihn für einen schwächlichen Mann zu halten. Henry Sheldon strahlte eine derartige Autorität und Kraft aus, dass Francis unwillkürlich zusammenzuckte und sein Bündel fester packte.
»Francis Drake?«, fragte Henry Sheldon in beinahe barschem Tonfall und ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen.
Francis nickte. »Ja, Sir.«
»Alter?«
»Fast dreizehn, Sir«, antwortete Francis mit belegter Stimme und war auf sich selbst wütend, weil er sich von Henry Sheldons Tonfall einschüchtern ließ.
»Hast du schon mal an Bord eines Schiffes Dienst getan?«
Francis wollte die Frage im ersten Moment bejahen, denn er hatte schon oft beim Entladen und Beladen von Schiffen als Handlanger geholfen. Aber dann überlegte er es sich anders. Kapitän Sheldon verstand unter »Dienst tun« sicherlich mehr. Deshalb schüttelte Francis den Kopf. »Nein, Sir.«
»So, so«, knurrte Henry Sheldon unfreundlich. »Dein Vater ist ein Gentleman. Wenn es mehr Männer von seiner Sorte gäbe, wäre es um England besser bestellt. Meine Mannschaft ist eigentlich komplett, aber ich wollte deinem Vater einen Gefallen tun.«
Zornesröte schoss Francis ins Gesicht, und er schob das Kinn angriffslustig vor. »Ich will keine Gefälligkeit, Sir!« Zum Teufel mit Frankreich und der Trinity. Er hatte auch seinen Stolz. »Entweder brauchen Sie einen Decksjungen, oder Sie brauchen keinen. Ich tue meine Arbeit genauso gut wie jeder andere, Sir!«
Verdutzt sah Henry Sheldon den Jungen an und runzelte die Stirn. Dann huschte ein amüsiertes Lächeln über das von Wind und Sonne gegerbte Gesicht des Kapitäns. »Du verstehst dich zu wehren, mein Junge. Das gefällt mir. Und wenn du nur halb so fix mit den Händen wie mit dem Mund bist, stehen die Chancen gar nicht so übel, dass du mal ein tüchtiger Matrose wirst.« Er drehte sich um und winkte einen jungen Burschen mit einem sommersprossenübersäten Gesicht heran. »Alan, das ist Francis Drake. Zeig ihm, wo er seine Sachen im Vorschiff verstauen kann. Und dann zurück an die Arbeit. Na los, bewegt euch! Oder wollt ihr, dass ich euch mit der Neunschwänzigen Beine mache?!«
»Aye, aye, Sir!«, beeilte sich Alan zu sagen, fuhr auf der Stelle herum und raunte Francis dabei zu: »Komm mit nach vorn!«
Sie hasteten an den Kistenstapeln von Provianttonnen vorbei zum Vorschiff, wo sich die primitiven Unterkünfte der Matrosen befanden.
Als Francis hinter Alan den schmalen Niedergang zum Zwischendeck hinunterstolperte und sich dann auch noch im Zwielicht den Kopf an einem Querbalken stieß, fluchte er laut.
»Hölle und Verdammnis, das fängt ja heiter an. Erst droht mir der Kapitän Prügel mit der neunschwänzigen Peitsche an und dann stoße ich mir auch noch den Kopf blutig!«
Alan lachte, und es klang ein wenig schadenfroh. »Mir ist es nicht anders ergangen, als ich vor vier Monaten an Bord gekommen bin. Mich hat er auch gleich zusammengeschissen.«
»Dann bist du auch Decksjunge?«, fragte Francis hoffnungsvoll.
»Ja, aber du brauchst vor dem Alten keine Angst zu haben«, beruhigte Alan ihn. »Der ist in Ordnung. Er gibt sich nun mal gern knurrig. Hunde, die bellen, beißen nicht. Das trifft auch auf unseren Käpt’n zu.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, murmelte Francis und klemmte sein Kleiderbündel zwischen zwei dicht nebeneinanderstehende Stützbalken.
»Wenn du seine Befehle befolgst und deine Arbeit ordentlich machst, hast du nichts zu befürchten.«
Der neue Decksjunge an Bord der Bark Trinity bekam an diesem Tag keine Gelegenheit mehr, sich den Kopf über Kapitän Sheldon und seine Zukunft zu zerbrechen. Als er mit Alan wieder oben an Deck erschien, schickte ihn James Every, der hünenhafte Bootsmann, hinunter in den stickigen Frachtraum. Dort half er beim Verstauen des Proviants und der Waren, die für französische Händler in St. Martin und Rouen bestimmt waren. Stunde um Stunde verging, und Francis hatte den Eindruck, als würde der Strom der Kisten, Tonnen und Ballen kein Ende nehmen.
Als er kurz nach Einbruch der Dunkelheit erschöpft aus dem Bauch der Bark taumelte und sich im Vorschiff neben Alan in eine Decke rollte, schlief er auf der Stelle ein. Die Nacht schien nur wenige Minuten gedauert zu haben. Jedenfalls hatte Francis das Gefühl, als ihn die schrille Pfeife des Bootsmannes jäh aus dem Schlaf holte. Mit schmerzenden Knochen stürmte er an Deck.
Kurze Kommandos zerrissen die friedliche Stille des Morgens. Die Seeleute sprangen in die Wanten und enterten zu den Rahen auf. Die Segel schlugen donnernd im Wind. Der Anker wurde gelichtet und die Leinen an der Pier losgeworfen. Der Wind fiel in die Segel, und die Bark glitt aus dem Hafen. Als die Trinity wenig später mit prall stehenden Segeln an dem verrottenden Wrack vorbeizog, blickte Francis Drake erwartungsvoll in die Zukunft und war dem Schicksal dankbar, das ihn auf die Bark geführt hatte.
Zur selben Zeit, da Francis Drake im Jahre 1554 seine Lehrzeit als Seemann an Bord der Trinity begann und schnell feststellte, dass er sich keinen besseren Lehrer als Kapitän Henry Sheldon hätte wünschen können, zur selben Zeit plante Sir Thomas Wyatt der Jüngere, der Anführer der protestantischen Rebellen, einen gewaltsamen Aufstand gegen Königin Maria I.
Besonders von den Schiffen am Medway erhielt der Rebellenführer Unterstützung in Form von Waffen und Munition. Und während Francis Drake zum ersten Mal in seinem Leben den rauen Ärmelkanal überquerte, unternahm Sir Thomas Wyatt von seinem Hauptquartier in Rochester aus einen Angriff auf London.
Der Aufstand schlug fehl. Die Truppen der Königinfügten den Rebellen eine vernichtende Niederlage zu. Sir Thomas Wyatt geriet in Gefangenschaft und wurde hingerichtet. Königin Maria rächte sich für den versuchten Umsturz mit grausamer Härte. Auf ihren Befehl hin wurden Hunderte von protestantischen Rebellen in den Straßen Londons und an den Ufern des Medway aufgehängt. Die blutigen Ketzerverfolgungen verbreiteten Angst und Schrecken im Land – und trugen der Königin den Namen »Blutige Mary« ein.
Als Francis Drake Wochen später an Bord der Trinity nach England und zum Medway zurückkehrte, suchte er vergeblich nach seinen Eltern und Geschwistern. Er erfuhr, dass sie hatten flüchten müssen, nachdem der Angriff der protestantischen Rebellenarmee fehlgeschlagen war.
Da jedermann am Medway wusste, dass Henry Sheldon ein überzeugter Protestant war, zog es der Kapitän vor, die Liegezeit im Hafen so kurz wie möglich zu halten. Schon wenige Tage nach ihrer Rückkehr ließ er wieder die Segel setzen. Und diesmal gehörte auch Francis Drake zu den Seeleuten, die blitzschnell zu den Rahen auf enterten und die schweren Segel losmachten. Er war stolz darauf, Seemann und Protestant zu sein. Sein Hass auf die Katholiken hatte neue Nahrung gefunden.
3.
Chris Mitchell stieß sich von der Reling ab, ging über das schwankende Achterdeck der Bark und spuckte in Lee über Bord. Einen Augenblick starrte er schweigend nach Nordwesten. »Da braut sich ja ganz schön was zusammen«, knurrte er schließlich. »Weißt du, wonach das aussieht, Francis?«
»Nach Sturm«, antwortete Francis Drake, der Ruderwache hatte. Vor ein paar Minuten war der Horizont im Nordwesten noch klar und hell gewesen. Jetzt aber ballten sich dort dunkle, fast schwarze Wolken. Und wie eine tiefhängende schiefergraue Wand überzog die Gewitterfront den nordwestlichen Horizont.
»Vielleicht haben wir Glück und erwischen nur die Ausläufer des Sturms«, hoffte Chris Mitchell und fuhr sich mit der gespreizten Hand durch das flammenrote Haar. »Dann könnten wir …«
»Schlag dir das aus dem Kopf«, fiel Francis Drake ihm mit spöttischem Unterton ins Wort. »Aus der Tour durch die Wirtshäuser von Plymouth heute Abend wird nichts. Das Unwetter hält direkt auf uns zu, Chris. Wir schaffen es heute nicht mehr bis in den Hafen.«
Chris Mitchell schlug mit der geballten Faust auf die Reling. »So ein Mist!«, fluchte er. »Während der ganzen Reise von Bordeaux bis hierher haben wir gutes Wetter gehabt, sogar in der Biscaya. Und jetzt zieht ein handfester Sturm auf, wo wir es bloß noch ein paar lausige Seemeilen bis nach Plymouth haben. Himmelherrgott, ich könnte verrückt werden vor Wut!«
Francis Drake verzog das Gesicht zu einem Lächeln. Er wusste, dass Chris darauf brannte, seine Heuer in den Wirtshäusern zu vertrinken und zu verspielen.
»Du kriegst noch früh genug Würfel in die Hand«, tröstete er ihn, wurde dann aber schnell wieder ernst. »Besser, du sparst dir den Atem für später, wenn du ihn oben in den Wanten beim Reffen der Segel brauchst, Chris. Wir werden bald alle Hände voll zu tun bekommen.«
Chris Mitchell seufzte schwer und machte ein grimmiges Gesicht. »Das befürchte ich auch«, murmelte er.
»Halte dich nicht mit Wehklagen auf, sondern beweg dich und mach dem Kapitän Meldung!«, trug Francis ihm auf.
»Der Alte wird sich freuen«, sagte Chris Mitchell und verschwand im Niedergang.
Francis Drake packte das Ruder fester, korrigierte leicht den Kurs der Bark und blickte sorgenvoll nach Nordwesten. Er fuhr nun schon seit acht Jahren zur See. Während dieser Zeit hatte er als Decksjunge, dann als Leichtmatrose und nun auch als Steuermann der Trinity so manchen Sturm erlebt. Doch noch nie hatte er solche dunklen, unheilvollen Wolken gesehen, die sich in Windeseile am Horizont zu einem wahren Wolkengebirge auftürmten.
Kapitän Sheldon kam halb angekleidet an Deck. Er hatte geschlafen. Seine Augen blickten jedoch klar und wachsam. »Das hat uns gerade noch gefehlt!«, stieß er knurrig hervor und raufte sich das schüttere Haar. Dann wandte er sich Francis Drake zu.
»Sie bleiben hier am Ruder, Francis!«, befahl der Kapitän mit herrischem, scheinbar unfreundlichem Tonfall. »Ganz gleich, was auch passiert. Haben Sie mich verstanden?«
Francis Drake unterdrückte ein Lächeln und erwiderte den grimmigen Blick des Kapitäns mit ausdruckslosem Gesicht. »Aye, aye, Sir!«, bestätigte er den Befehl, der wie eine Zurechtweisung oder Strafe klang, in Wirklichkeit jedoch die höchste Auszeichnung darstellte, die Henry Sheldon aussprechen konnte.
Bis vor etwa einem Jahr hatte der Kapitän und Schiffseigner bei jedem schweren Sturm das Ruder selbst in die Hand genommen. In letzter Zeit trat er jedoch mehr und mehr Verantwortung an Francis Drake ab, der überdurchschnittliche seemännische Fähigkeiten zeigte.
»Kurs?«, fragte der Kapitän knapp.
»Genau Nord«, kam Francis Drakes Antwort ohne zu zögern. »Voll und bei.«
Henry Sheldon nickte. »Versuchen Sie den Kurs so lange wie möglich zu halten.«
»Jawohl, Sir!«
Henry Sheldon wandte sich ruckartig um. »Die erste Bö wird gleich einfallen«, brummte er und blickte zum Großmast hoch. »Mister Mitchell, jagen Sie die Leute in die Wanten und lassen Sie reffen. Es hat keinen Sinn, sich die Segel von den Rahen reißen zu lassen.«
Die Seeleute brandeten in die Wanten und refften in fieberhafter Eile die Segel. Der Wind nahm zu und wühlte das Meer auf. Hohe schaumgekrönte Wellen warfen sich der Trinity entgegen, die schwer gegen die Brecher ankämpfte. Obwohl es erst früher Nachmittag war, lag schon bald ein unnatürliches Dämmerlicht über der aufgewühlten See. Es war so düster, als wäre die Sonne schon untergegangen.
Nach einer knappen Stunde war der Wind zu Sturmstärke angewachsen und heulte in der Takelage. Rund um die Bark begann das Meer zu brodeln. Gewaltige Brecher trafen das Schiff und schienen es unter die Wasseroberfläche zu drücken. Die Bark ächzte und zitterte unter jedem Wellenschlag.
Francis Drake umklammerte das Ruder und versuchte den Kurs so gut es ging zu halten. Das Schiff lief jetzt nur noch unter Sturmsegeln. Mühsam kletterte es die Wellenberge, die über ihm zusammenzubrechen drohten, bis zum Kamm hoch und stürzte dann mit rasender Fahrt ins Wellental hinunter, um im nächsten Augenblick an der nächsten Woge hochzusteigen.
»Der Sturm nimmt noch zu!«, schrie Francis Drake zum Kapitän hinüber, der sich am geschnitzten Geländer festhielt und dem jaulenden Wind mit vorgerecktem Kinn Trotz bot.
Der Wind zerrte bald mit Orkanstärke an den Masten. Das Sturmsegel hielt der ungeheuren Belastung nicht stand und riss. Die Fetzen knatterten wie Musketenschüsse im Wind. Haushohe Sturzbrecher schlugen über dem Bug zusammen und verwandelten das Deck in einen Hexenkessel brodelnder Gischt.
Nass bis auf die Haut und den peitschenden Windböen schutzlos ausgesetzt stand Francis Drake am Ruder. Er versuchte das Schlimmste zu verhindern. Diesen Sturm konnte man nicht unter einem Segel abreiten. Es war auch nicht möglich, den Kurs zu halten. Es kam jetzt einzig und allein darauf an, die Bark vor dem Leckschlagen und Entmasten zu bewahren.
»Wir ziehen Wasser!«, meldete Chris Mitchell und formte dabei die Hände zu einem Trichter, um das Brüllen des Orkans zu übertönen. Noch wurden die Pumpen jedoch mit dem eindringenden Wasser fertig.
Francis verlor völlig das Gefühl für die Zeit. Minuten wurden zu Stunden, wenn die Brecher sich wie riesenhafte Berge auf das Schiff stürzten und es unter sich zu begraben drohten. Mit Entsetzen beobachtete er, wie eine mindestens neun Yards hohe Woge die Bark querab an Steuerbord traf. Die tonnenschweren Wassermassen stürzten auf das Oberdeck. Die Matrosen, die sich am Schanzkleid oder an den Wanten verzweifelt festgeklammert hatten, wurden wie wehrlose Puppen fortgerissen und über Bord gespült. Ihre Köpfe tauchten noch einmal für ein, zwei Sekunden aus der tobenden See auf und verschwanden dann in der Tiefe.
Francis Drake kämpfte mit jeder Welle. Chris Mitchell war ihm zu Hilfe geeilt. Die Kraft, die auf das Ruder einwirkte, war so stark, dass zwei Männer nötig waren, um es unter Kontrolle zu halten.
»Ich habe das Gefühl, wir segeln geradewegs in die Hölle!«, schrie Chris Mitchell und suchte auf dem glitschigen Achterdeck Halt.
»Noch ist nichts verloren«, brüllte Francis Drake zurück und zog den Kopf zwischen die Schultern, als eine heftige Böe Gischt über das Deck wehte.
»Wo ist der Kapitän?«
»Unter Deck!«, antwortete Francis Drake und schrie dabei so laut er konnte. Der Wind quälte Wanten und Rigg des Schiffes. Das Tauwerk war bis an die Grenze der Belastbarkeit gespannt und sang wie die Saiten eines Instrumentes. »Die Fracht hat sich losgerissen und droht das Schiff leckzuschlagen!«
»Zum Teufel mit der Fracht!«, brüllte Chris Mitchell. »Das besorgen schon die verdammten Sturzbrecher.«