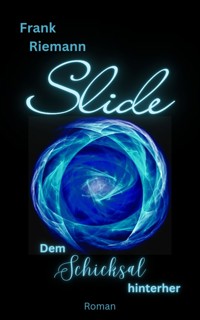
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich werde sterben", sagte John zu Annie, "und du auch." Durch einen Zufall lernen sich John und Annie kennen und stellen fest, es gibt wichtigeres als ihre Arbeit. Doch dann geschieht ein schreckliches Verbrechen. Nun muss John das größte Abenteuer der Menschheit wagen, um die Liebe seines Lebens zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Riemann
Slide
Dem Schicksal hinterher
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Titel / 2
»Ich werde sterben«, sagte John zu Annie, »und du auch.«
»Es ist da!«
»Ich freue mich«, antwortete John.
»Süß und scharf.«
»Es ist passiert.«
»Die Antwort ist: Etwa ein Jahr.«
»Was mochte ihnen noch dazwischen kommen?«
»Bitte sag, dass das nicht wahr ist.«
»Das wollte ich Ihnen unbedingt erzählen.«
»Ich bin wieder da.«
»Mach es kleiner!«
»Ok«, dachte er. »Ich bin bereit.«
»Oh Annie«, entwich es John.
»Was ich dir jetzt erzähle, darf deine Wohnung nicht verlassen.«
»Wir sind alle noch immer zutiefst erschüttert.«
»Ich wollte nur helfen.«
»Bitte tun Sie mir nichts.«
»Manchmal ist die Welt ein Dorf.«
»In Ordnung am Arsch.«
»Ihr solltet miteinander reden!«
»Ach Scheiße, John, ich liebe dich doch.«
»Es tut mir so leid.«
Nachwort
Danksagung
Impressum neobooks
Titel / 2
Frank Riemann
S L I D E
»Ich werde sterben«, sagte John zu Annie, »und du auch.«
September 2028
Es war ein angenehmer Spätsommertag gewesen in Boston.
Annie kam von einer anstrengenden 36 Stunden Schicht in der Unfallchirurgie des Massachusetts General Hospitals nach einer viertelstündigen Fahrt nach Hause. Die Gore Street lag im Stadtteil Cambridge, nördlich des Charles Rivers. Überraschenderweise fand sie sofort einen freien Parkplatz direkt vor ihrer Tür. Er musste gerade erst frei geworden sein, so viel Glück hatte sie sonst selten. Besonders im Sommer nutzten viele Familien die warmen Abende, um im gegenüber liegenden Gore Park den Tag ausklingen zu lassen. Auch Pärchen fanden sich dort zum Picknick ein, oder man sah den Kindern auf dem Baseballfeld zu. Je belebter der Park war, umso schwerer fand man üblicherweise einen Parkplatz in der näheren Umgebung. Heute jedoch kam Annie ausnahmsweise genau im richtigen Moment nach Hause. Das Schicksal schien es wohl gut mit ihr zu meinen.
Sie parkte ihren Toyota, ging noch ein kleines Stück die 5th Street hinunter zu "Le´s Restaurant" und betrat dann wenige Minuten später, mit einer Tüte voll mit ihrem Lieblingssushi, ihre kleine gemütliche Wohnung.
Annie zog noch direkt hinter der Tür Schuhe und Jeans aus, ließ alles liegen, wo es war und schritt an dem offenen Durchgang zu ihrem Wohnzimmer vorbei in die Küche. Dort packte sie die Schalen mit ihrem Essen aus, nahm sich Essstäbchen aus einer Schublade und ging zum Wohnzimmer. Sie wollte jetzt nur noch auf die Couch, ihr Sushi essen, danach eine Dusche nehmen und dann ins Bett. Am liebsten hätte sie eine ganze Woche durchgeschlafen, so erledigt fühlte sie sich.
Nur mit Slip und T-Shirt bekleidet bog sie in das Wohnzimmer ein und erstarrte auf der Stelle. Da saß ein Mann auf ihrer Couch.
Die Schalen mit dem Essen fielen ihr aus den Händen und zerplatzten auf dem Holzboden. Ihr Sushi rollte umher und auch die Essstäbchen klackerten geräuschvoll hinterher.
»Hallo Annie«, sagte der Mann mit sanfter Stimme.
»J…John?«, stammelte Annie erschöpft, aber auf einmal doch hellwach. Sie stand stocksteif da. Dann versuchte sie einen Schritt zu machen und patschte mit ihrem Fuß in das Sushi. Müde von einer langen Schicht versuchte sie, drei Dinge gleichzeitig zu verarbeiten: Den Reis und den Fisch zwischen ihren Zehen, John auf der Couch und wie sie so halbnackt vor ihm stand. Dann gewann sie ihre Sicherheit zurück, stemmte die Hände in die Hüften und fragte energisch: »Was machen Sie in meiner Wohnung? Wie sind Sie überhaupt hier rein gekommen? Sind Sie bei mir eingebrochen? Was soll das? Sind Sie ein Irrer? Ein Mörder? Ich rufe die Polizei.«
Ihr Smartphone steckte noch immer in ihrer Jeans und die lag vor der Wohnungstür. Also griff Annie nach dem nächstbesten Gegenstand auf der kleinen hölzernen Kommode neben ihr und erhob die Hand mit einem massiven Kerzenleuchter. »Bleiben Sie mir vom Leib. Ich warne Sie. Was wollen Sie hier?«, fragte sie zornig, bereit, jeden Moment zuzuschlagen.
John blieb sitzen, wo er war und hob abwehrend beide Hände, um zu signalisieren, von ihm ginge keinerlei Gefahr aus. Ruhig erklärte er: »Ich bin nicht bei dir eingebrochen. Ich habe einen Schlüssel.«
»Woher haben Sie einen Schlüssel?«, fragte Annie skeptisch. In Ihrem Kopf wirbelten die Gedanken wild durcheinander. Sie und John hatten sich gerade erst vor ein paar Tagen kennengelernt und waren auch nur einmal zusammen Kaffee trinken. Es war noch nicht einmal ein richtiges Date gewesen. Ja, sie hatte ihn auf Anhieb gemocht. Er war sympathisch. Aber das hier hatte kriminelle Züge. Stalkte er sie?
War er irgendwie an ihren Schlüssel gelangt und hatte eine Kopie erstellt? Wie in den Filmen, in denen ein Schlüssel in eine Art Knetmasse gedrückt und diese anschließend mit flüssigem Metall aufgefüllt wurde.
»Los, antworten Sie! Wie sind Sie an meinen Schlüssel gekommen?«
Mit seiner tiefen Stimme antwortete John langsam, damit Annie die Worte auch aufnehmen konnte: »Du hast ihn mir gegeben. Beziehungsweise, du wirst ihn mir noch geben.«
»Ich werde was?«, reagierte Annie brüsk. »Sind Sie noch bei klarem Verstand? Stehen Sie unter Drogen?«
Das glaubte sie allerdings nicht wirklich. Sie hatte John als ruhigen beherrschten, fast in sich gekehrten Mann kennen gelernt. Er hatte ihr gesagt, er wäre Wissenschaftler, ohne darauf einzugehen, was genau er eigentlich tat. Ihrem ersten Urteil nach, war er Lichtjahre von Drogenkonsum entfernt. Dennoch hatte die ganze Situation etwas Unwirkliches an sich und Annie fragte sich, ob sie selber nicht vielleicht auf irgendeinem Trip war. Das war bestimmt die Müdigkeit. Ja, das musste es sein. Sie war übermüdet und ihre medizinisch analytische Denkweise sagte ihr, sie halluzinierte. Lediglich die weiche Masse, die unter ihrem Fuß klebte, signalisierte ihr, dies alles hier passierte grad tatsächlich.
»Nein«, antwortete John ruhig. »Keine Drogen, kein Alkohol und keinerlei andere Substanzen.« Wenn er sich nicht bereits vor langer Zeit in Annie verliebt hätte, wäre es spätesten jetzt um ihn geschehen gewesen. Erneut. Wie sie, schlank und hübsch mit nackten Beinen, vor ihm stand, ließ ihn wieder einmal dahin schmelzen. Wie die Spitzen ihrer langen braunen Haare hin und her wippten, wenn sie sich echauffierte oder leidenschaftlich zu einem Thema äußerte, gefiel ihm jedes Mal aufs Neue. Ihr immer noch erhobener Arm mit dem schweren Kerzenleuchter beunruhigte ihn nicht im Geringsten. Er wusste, es war eine reine Drohgebärde. Er war sich sicher, seine Annie, die Unfallchirurgin, war gar nicht fähig zur Gewalt. Sie heilte, sie verletzte nicht. Da er nicht vorhatte, ihr etwas anzutun, musste er nicht damit rechnen, dass sie sich plötzlich mit diesem Leuchter auf ihn stürzen würde. Er kannte sie nun bereits ein Jahr und wusste sie mittlerweile gut einzuschätzen.
»Nein, Annie«, wiederholte John, um sie zu beruhigen, »keine Drogen, kein Einbruch, keine Gefahr. Zumindest jetzt nicht.«
Irgendetwas in Annie ließ sie ihren Arm senken. Den Leuchter hielt sie dennoch weiterhin fest umklammert. Die Knöchel ihrer Hand traten hell hervor.
Was meinte er mit "zumindest jetzt nicht"? Sie konnte die komplette Situation nicht richtig einordnen. John, den sie so gut wie gar nicht kannte, saß in ihrem Wohnzimmer, obwohl sie ihm gar nicht gesagt hatte, wo sie wohnte. Dieser ganze Moment flößte ihr Angst ein. Ihr Herz raste und das Shirt klebte ihr am Rücken. Obgleich von John selber keinerlei Gefahr auszugehen schien. Er saß nahezu bewegungslos auf ihrer wuchtigen blau-weiß gestreiften Couch mit den großen Kissen, auf der sie so manche Nacht verbracht hatte, wenn ihr nach einer harten Schicht im Hospital selbst der kurze Weg ins Bett zu anstrengend gewesen war. Er sprach ruhig und bedacht, so wie sie ihn kennen gelernt hatte. Nur seine schwarze Lederjacke, die neben ihm lag und nicht recht zur Jahreszeit passte, wirkte an seiner Erscheinung deplatziert. Was sie jedoch am meisten verstörte, war das, was er von sich gab. Das ergab für sie überhaupt keinen Sinn. Sie begriff nicht ein Wort, von dem, was er sagte.
»Annie«, versicherte John bedächtig, »bitte glaube mir. Dir droht keine Gefahr von mir. Ich würde dir niemals etwas antun. Und das habe ich auch nie.«
»Was soll das? Wieso sagen Sie so etwas?«, entgegnete sie bereits eine Spur milder, aber immer noch auf der Hut. Vielleicht spielte er ihr den besonnenen Typen nur vor, um sie einzulullen. »Wir kennen uns doch im Grunde so gut wie gar nicht.«
John erhob seine schlanke, groß gewachsene Gestalt langsam aus dem Sofa, versuchte ein Lächeln zustande zu bringen und meinte: »Vielleicht ziehst du dir besser etwas über.« Er deutete auf das zermatschte Sushi am Boden und fuhr fort: »Dann beseitigen wir das da, bestellen uns eine Pizza und ich erkläre dir alles in Ruhe. Es wird eine lange Nacht werden. Du nimmst sicherlich eine Pizza Hawaii.«
Annies Haut begann am ganzen Körper zu kribbeln. Ihre Nackenhaare richteten sich auf. In ihrem Schädel setzte ein Brausen und Tosen wie bei einem Wirbelsturm ein und ihre Gedanken huschten ungeordnet umher. Das konnte doch nicht sein. Woher kannte er ihre Lieblingspizza?
John fügte hinzu: »Bestimmt mit Peperoni. Wie immer.«
In Annies Kopf drehte sich alles. Ihr wurde schwarz vor Augen und sie fiel in Ohnmacht.
Als sie erwachte, lag sie auf der Couch und noch bevor sie irgendetwas anderes wahrnahm, spürte sie das dumpfe Dröhnen ihres Schädels. »W…Was?«, brachte sie flüsternd zustande. Annie öffnete die Augen und sah ein Gesicht über sich. »John?«
»Ja, Annie. Ich bin hier.«
»Was ist passiert?«, fragte sie leise. Das Letzte, an das sie sich erinnern konnte, war John in ihrer Wohnung.
»Du bist gestürzt und hast dir den Kopf angeschlagen. Oder meinst du alles, vor meinem Auftauchen?«
Diese Bemerkung brachte ihr Hirn wieder in Schwung. John war völlig unerwartet in ihrer Wohnung aufgetaucht und hatte zusammenhangloses Zeug von sich gegeben, das sie nicht begriffen hatte.
»Warum liege ich auf der Couch?«, wollte sie wissen.
»Du hast dir beim Aufprall den Kopf angeschlagen und bist bewusstlos geworden. Oder bist es erst und hast dich daraufhin verletzt. Wie auch immer, ich habe dich auf die Couch gelegt, dich mit einer Decke zugedeckt und einen feuchten kalten Lappen auf deine Beule gelegt. So richtig groß ist sie nicht, du hast Glück gehabt.«
Glück? Annie gab ein spöttisches schnaubendes Geräusch von sich. Erst jetzt spürte sie die Kühle an ihrem Kopf. Sie griff mit ihren Fingern danach und zuckte zusammen, als sie ein stechender Schmerz durchfuhr.
»Das solltest du lassen«, kam Johns Rat zu spät. »Dann habe ich den Boden hier sauber gemacht. Ich weiß ja, wo alles bei dir ist: Decken, Lappen, Putzmittel.«
Annies Unbehagen darüber, nicht zu wissen, wovon der Typ eigentlich redete, kroch wieder in ihr empor. Mühsam richtete sie sich langsam etwas auf und nahm eine halb liegende, halb sitzende Position ein. Ihr Kopf dröhnte zwar noch immer, aber vor John zu liegen gab ihr ein Gefühl der Verletzlichkeit. Auf dem niedrigen Couchtisch stand ein Glas Wasser. Daneben lag eine Tablette für sie bereit.
»Gegen die Kopfschmerzen«, sagte John, als er ihrem Blick folgte.
»Wo ich meine Medikamente aufbewahre, wissen Sie also auch«, meinte Annie, ohne darauf eine Antwort zu erwarten. »Wie lange war ich weg?« Ihre Stimme hatte ihre Klarheit zurück gewonnen.
»Nur ein paar Minuten«, sagte John. Behutsam half er ihr noch ein Stück auf und packte ihr ein Kissen in den Rücken. Dann setzte er sich ihr in dem alten Sessel, den sie noch von ihrer Großmutter hatte und der überhaupt nicht zum Rest der Einrichtung passte, schräg gegenüber und sah sie an. Seine Lederjacke lag neben ihm auf dem Boden.
»Also, John, oder wie immer Sie auch heißen mögen, was ist hier los?«
Annie wollte jetzt Gewissheit haben. Trotz Kopfschmerzen drängte es sie danach, endlich zu erfahren, was sein Auftauchen und seine Anspielungen zu bedeuten hatten.
»Ich werde sterben«, sagte John zu Annie, »und du auch.«
»Es ist da!«
August 2028
Als Dr. John Mathews zusammen mit Professor Pavel Kozlowski den Aufzug verließ, empfing sie eine angenehme klimatisierte Kühle in den weitläufigen Laboren des geheimen Untergeschosses unter dem Nuclear Reactor Laboratory in der Albany Street. Es war ein willkommener Komfort, im Gegensatz zu der bereits am Morgen über Boston lastenden Wärme. Diese sollte sich im Laufe des Tages zu einer kaum erträglichen Hitze steigern, und würde die Stadt wie eine riesige Glocke einhüllen.
Sie durchquerten den Sozialtrakt der Anlage, der ihren eigentlichen Arbeitsräumen vorgelagert war. Das "Klack Klack" von Professor Kozlowskis Gehstock begleitete sie auf ihrem Weg, als der alte Wissenschaftler, wie jeden Morgen in den letzten Wochen, fragte: »Na, John, fünf Dollar, dass unser Seňor Hermoza nicht zu Hause war und wieder hier geschlafen hat?«
Wie jeden Morgen war Johns Antwort ablehnend. »Nein, Professor, die Wette würden Sie ja gewinnen.«
Als Student im letzten Master Jahr arbeitete Esteban Hermoza den Sommer über durch und ging seit Wochen nicht nach Hause. Nicht, seit sie auf die Ankunft des Teilchens warteten.
»Und wenn er überhaupt geschlafen hat, dann wieder einmal nicht viel«, fügte John hinzu. »Er könnte den großen Moment ja verpassen.«
Der Professor kicherte leise mit schnarrender Stimme. »Wenn wir etwas verpasst hätten, hätte er uns bestimmt schon informiert.«
Sie kamen am geräumigen Aufenthaltsraum mit einer voll funktionsfähigen Küche und einer großzügigen Wohnlandschaft vorbei, entdeckten Hermoza aber nicht.
»Bildschirm, oder Ruheraum?«, fragte der Professor.
»Bildschirm«, antwortete John.
Sie gingen an den vier Ruheräumen vorbei, ohne in Hermozas hinein zu schauen und fanden ihn, nach dem Passieren einer weiteren Sicherheitsschleuse, an seinem Computerarbeitsplatz vor. Dort verglich er abwechselnd Zahlenkolonnen auf einem schier endlosen Ausdruck und starrte auf einen dunklen Bildschirm. Seit Wochen jeden Morgen der gleiche Ablauf.
»Und?«, fragte der Professor, »gibt es etwas Neues?«
Esteban antwortete wie immer in letzter Zeit. Dabei sah John den Professor an und sprach tonlos mit seinen Lippen mit: »Nein. Nichts. Es ist zum verrückt werden. Wir können uns nicht geirrt haben.« Dann meinte er an John gerichtet: »Und das habe ich gesehen, Dr. Mathews, wie jeden Morgen.« Dann fuhr er sachlich fort: »Ich glaube nicht, dass wir uns geirrt haben. Wir haben es wieder und wieder durchgerechnet, unzählige Simulationen laufen lassen, Gegenproben berechnet und alles immer mit dem gleichen Ergebnis. Es hätte eigentlich funktionieren müssen. Es müsste längst da sein. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, oder was wir noch tun könnten.« Hermoza war niedergeschlagen. Es fehlte nur noch, wie er vor Enttäuschung in sich zusammengefallen wäre. »Ich habe so sehr gehofft, es würde funktionieren.«
»Das haben wir alle«, erklang die helle Stimme von Dr. Helen Bertelli, die unbemerkt hinzugetreten war. »Vielleicht wollten wir auch nur, dass es funktioniert. Vielleicht wollten wir nur diese uralte Sehnsucht stillen, wollten das Unmögliche schaffen. Vielleicht wollten wir es zu sehr. Ein Misserfolg stand für uns doch außer Frage. Und nun, auf dem Boden der Tatsachen angekommen, sind wir enttäuscht.«
»Ah, Helen, schön, dann sind wir ja komplett«, sagte Prof. Kozlowski. »Also wieder von vorne. Wir lassen die Geräte noch an und jeder rechnet seinen Part ein weiteres Mal durch. Verändern Sie die Variablen ein wenig und überprüfen Sie alles immer wieder mit abweichenden Parametern.«
»Aber…«, begann John seinen Einwand, doch der Professor hob eine Hand und schnitt ihm das Wort ab: »Ich weiß, John, ich weiß. Wir haben es so viele Male berechnet und durchgespielt, in all den Jahren.« Er rückte seine Brille in seinem hageren Gesicht zurecht und nahm einen beinahe feierlichen Ton an: »Ich muss mich bei Ihnen allen für die großartige Arbeit in der Vergangenheit bedanken. Auch ich bin, ehrlich gesagt, niedergeschlagen. Genau wie Sie, hatte ich mir mehr erhofft. Aber, meine Herren, und meine Dame, entschuldigen Sie, Helen«, und er zwinkerte ihr schelmisch zu, »wir sind Wissenschaftler und wir halten uns an Fakten. Etwas funktioniert, oder aber es funktioniert nicht. Da ist für hoffen, glauben oder gar wünschen kein Platz.«
Die Drei wussten, er hatte Recht. Es war nur so niederschmetternd. So endgültig. Die jahrelange Arbeit sollte vergebens gewesen sein?
Der Professor fuhr fort und verfiel in eine seiner erschöpfenden Erklärungen: »Meine Lieben, Sie alle wissen um das Hick Hack bei der Erfindung des Telefons. Ob Philipp Reis der Erfinder war, oder doch Antonio Meucci? Wie wichtig waren die Vorarbeiten von Manzetti und Bourseul gewesen? Oder war es doch Alexander Graham Bell, der schließlich das erste Patent erhielt? Egal, was ich sagen will, ist folgendes: Viele Erfindungen konnten erst zu einer bestimmten Zeit erfolgen und nicht früher. Die entscheidende Komponente war damals der Strom. Ohne Strom konnte es auch noch kein Telefon geben. Wer weiß, meine Lieben, welche wichtige Komponente uns noch fehlt? Vielleicht kann es im Moment noch gar nicht funktionieren. Aber vielleicht wird es in der Zukunft funktionieren, wenn die fehlende Komponente entdeckt wurde. Und wer weiß, welche wichtige Vorarbeit wir dann bereits geleistet haben und ob man sich dann nicht auf unsere Arbeiten beruft. In der Theorie funktioniert es ja, uns fehlt nur der Beweis.«
»Oder es wird nie funktionieren«, sagte Helen. »Niemals. Und vielleicht soll es das auch gar nicht. Wer weiß, welches Unglück man damit heraufbeschwört? Als man die Atome entdeckte, hatte man auch nichts Besseres zu tun, als eine gewaltige Bombe zu erschaffen. Manche Dinge bleiben vielleicht besser unentdeckt. Ich gehe mal die Kaffeemaschine entdecken.« Sie drehte sich um und verließ den Arbeitsbereich durch die Schleuse und ging in den Aufenthaltsraum.
»Also, meine Herren«, meinte der Professor, »heute rechnen wir noch einmal alles durch, schauen, ob wir irgendwo eine Schwäche in unseren Formeln finden und wenn es nur der Hauch eines Zweifels ist. Esteban, Sie lassen eine weitere Simulation laufen. Wenn dann alles der abermaligen Überprüfung standhält, dann müssen wir der Realität wohl oder übel ins Gesicht sehen. Dann sind Zeitreisen vielleicht einfach nicht möglich.«
»Oder noch nicht«, fügte John hinzu.
»Oder noch nicht«, wiederholte Prof. Kozlowski zustimmend, wobei er mit seinem Gehstock an Johns Brust tippte. Dann klackerten er und sein Stock durch die Sicherheitsschleuse aus dem Arbeitsbereich hinaus.
Den ganzen Tag über wurde in der Anlage fieberhaft gearbeitet und Unmengen an Kaffee getrunken, als hätte es nie einen Rückschlag gegeben. Alle waren in ihre Aufgaben vertieft, nur unterbrochen von kurzen Gängen in die Küche oder ins Bad. Sie merkten gar nicht, wie die Stunden vergingen. Die ganze Zeit über begleitete sie das "Klack Klack" von Prof. Kozlowskis Gehstock, der unruhig in der Anlage umherwanderte. Allerdings nahmen sie es kaum richtig wahr in ihrer Versunkenheit. Sie füllten unzählige Blätter Papier, zerrissen sie und begannen von vorne. Sie beschrieben Whiteboards, wischten sie wieder sauber und stellten Formeln um. Sie tippten unaufhörlich auf Computertastaturen, starteten Simulationen, beobachteten und verglichen Bildschirme, besprachen Ergebnisse miteinander und rauften sich die Haare.
Der Professor ging herum, grübelte für sich im Stillen und hin und wieder schaute er bei einem seiner Mitarbeiter vorbei und sah eine Weile zu, ohne zu stören.
Am späten Nachmittag verspürte John einen stärker werdenden Hunger. Helen lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und massierte sich ihren verspannten Nacken. Esteban stützte seine Ellenbogen auf die Tischplatte und rieb sich mit den Handballen seine von der Computerarbeit müden Augen.
Plötzlich hörte er ein "Pling". Es war nur ein einzelner heller Ton und Esteban erstarrte. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Er traute sich nicht, seine Hände von seinen Augen zu nehmen oder sich irgendwie zu bewegen. Hatte er es wirklich wahrgenommen? Was wäre, wenn ihm seine übermüdeten Sinne einen Streich spielten? Aber was wäre, wenn nicht und er es tatsächlich gehört hatte?
Eine Sekunde später begann ein Drucker zu rattern. Esteban riss seine Hände herunter, stand von seinem Stuhl auf und stützte sich auf seinen Tisch. Er beugte sich vor, blickte auf den seit Wochen dunklen Bildschirm und suchte nach etwas, das nicht da war. Er schaute zum Drucker, der einen nicht enden wollenden Papierstreifen ausspuckte und zurück auf den Bildschirm. »Oh. Mein. Gott.«, keuchte er. Er trat zum Drucker, ließ das Papier durch seine Hände gleiten und besah sich die relevantesten Stellen. »Ich habe es gewusst«, flüsterte er aufgeregt. Seine Hände waren augenblicklich schweißnass. »Ich habe es immer gewusst.«
Er ging zurück an den Bildschirm und schaute ganz genau hin. In der Mitte war ein winziger blasser Punkt so gerade noch vor dem schwarzen Hintergrund zu erkennen. Man könnte ihn glatt übersehen, wenn man nicht explizit danach suchte. »Oh mein Gott«, flüsterte er erneut. »Jetzt habe ich wochenlang auf diesen Bildschirm gestarrt, bin fast wahnsinnig davon geworden und genau im entscheidenden Moment hatte ich meine Augen geschlossen. Dieser Augenblick kommt nie wieder.«
Beinahe hätte man annehmen können, Esteban wäre betrübt, aber das war er ganz und gar nicht. Sein Herz raste. Die Adern an seinen Schläfen pulsierten. Dann brüllte er, so laut er konnte, durch die Anlage: »Es ist da!«
Helens Hände blieben regungslos an ihrem Nacken liegen. John spürte, von einer Sekunde auf die andere, seinen Hunger nicht mehr. Das "Klack Klack" des umhertigernden Professors verstummte. Alle hielten den Atem an. Dann stürzten die drei, so schnell es ihnen möglich war, zu Estebans Arbeitsplatz und fanden ihn völlig aufgelöst vor.
»Es ist da. Ich habe es immer gewusst. Ich habe nur einen Moment weggesehen und plötzlich war es da. Wir haben uns nicht geirrt. Es musste alles seine Richtigkeit haben«, plapperte er, ohne Luft zu holen. »Wir haben es wieder und wieder durchgespielt und auf einmal war es da. Aus dem Nichts. Ganz plötzlich.« Er zeigte mit einem Finger auf einen kaum zu erkennenden diffusen Punkt auf dem Bildschirm.
»John«, bat der Professor ruhig, »reichen Sie mir doch bitte einmal die Ausdrucke.«
John sammelte so viel Papier zusammen, wie er greifen konnte und reichte sie Prof. Kozlowski. Dieser versuchte, sie in eine sinngebende Reihenfolge zu bekommen und sah sich dann zusammen mit Helen die Ergebnisse an, während John sich bemühte, den schwachen Punkt auf dem Bildschirm am Ende von Estebans Finger zu erkennen.
»Meine Herren, und meine Dame, entschuldigen Sie, Helen«, begann der Professor mit einer festen Stimme, die sie so schon lange nicht mehr gehört hatten, ernst, »wir sind Wissenschaftler und wollten uns an Fakten halten. Fakt ist, wir haben es geschafft. Das ist der Beweis, auf den wir so lange gewartet haben. Es ist hier.«
Nach diesen Worten brach ein unbeschreiblicher Jubel aus, viel lauter, als man es vier Personen zugetraut hätte. Der Lärm erfüllte den gesamten Laborkomplex. Das Team schrie, jauchzte und lachte. Alle umarmten sich immer wieder und sprangen umher wie kleine Kinder. Als es dem Professor zu viel wurde, da er das ein oder andere Mal drohte, umgestoßen zu werden, erhob er seine Stimme gegen den Jubel: »Meine Lieben! Meine Lieben!« Nachdem sich der Tumult gelegt hatte, fuhr er mit fester Stimme fort: »Meine Lieben, ich bin genauso aus dem Häuschen wie Sie. Dieser Durchbruch ist fantastisch. Aber unsere Arbeit ist noch nicht getan, noch lange nicht. Wir müssen das Ergebnis noch verifizieren.«
»Aber«, keuchte der noch atemlose Esteban und deutete auf den Bildschirm, »das haben wir soeben. Es ist da.«
»Mein lieber Seňor Hermoza«, entgegnete Prof. Kozlowski beschwichtigend, »eines fernen Tages wird man Ihren Ausruf "Es ist da!" vielleicht in einem Atemzug mit "Heureka, ich habe es!" und Neil Armstrongs berühmten Worten beim Betreten des Mondes nennen. Aber bis dahin, bleibt uns noch einiges zu tun.
Meine Herren, und meine Dame, entschuldigen Sie, Helen, jetzt werden wir alles noch einmal durchrechnen, wieder und wieder. Nur suchen wir diesmal nicht nach Gründen, warum es nicht funktioniert hat, nun suchen wir nach den Gründen, warum es funktioniert hat. Morgen früh will ich von Ihnen hören, es hat alles seine Richtigkeit und war nicht nur ein Zufallstreffer. Alles muss absolut wasserdicht sein. Also bitte, an die Arbeit.«
Wie oft hatte der Professor die drei in den letzten Jahren die Nächte durcharbeiten lassen? Wie oft hatten sie innerlich laut aufgestöhnt und den alten Mann heimlich verflucht? Diesmal nicht. Sie grinsten sich an. Nackenschmerzen, Hunger, Frust und Müdigkeit waren vergessen. Sie verschwanden an ihre Arbeitsplätze und machten sich an ihre Aufgaben.
Die Besprechung am nächsten Morgen war erstaunlich kurz. Sie alle waren müde, jedoch spürten sie es kaum. Sie waren in einer Hochstimmung, die nichts erschüttern konnte und der allgemeine, oft wiederholte, Tenor war: "Wir haben es geschafft!" Sie klatschten sich ab und gratulierten sich gegenseitig zu ihrem Erfolg. Nicht so ausufernd, wie am Abend zuvor, aber mit einem äußerst befriedigenden Gefühl tief in ihrem Innern. Sie hatten Geschichte geschrieben.
Der Professor stand von seinem Stuhl am Konferenztisch auf. »Meine Dame, meine Herren«, begann er mit ungewohnter Anrede, aber von nun an war die Welt nicht mehr dieselbe. Die Zukunft würde nun anders verlaufen, die Vergangenheit vielleicht auch. »Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was ich fühle. Mein ganzes Leben habe ich der Wissenschaft gewidmet. Als unsere Forschung vor einigen Jahren eine ungewohnte Richtung einnahm, hätte ich niemals damit gerechnet, es so weit zu bringen. Nicht im Traum hätte ich damals gedacht, es wäre überhaupt möglich, Materie durch die Zeit zu schicken. Aber hier sind wir. Ja, wir haben es geschafft.« Er nahm seine Brille ab, um sich müde den Nasenrücken zu reiben, aber die anderen sahen, wie er sich verstohlen eine Träne fortwischte.
»Ist alles in Ordnung, Professor?«, fragte John, aber noch ehe er es ausgesprochen hatte, wusste er: Ja, es war alles in Ordnung.
Prof. Kozlowski überging die Frage und fuhr fort: »Ich bin so stolz auf dieses Team, auf jeden einzelnen von Ihnen, dass das Herz eines alten Mannes darüber beinahe birst.«
Jetzt traten auch den anderen Tränen in die Augen obwohl sie glücklich dabei lächelten. Es war etwas Besonderes, wenn Prof. Kozlowski so persönlich wurde. Sentimental war er sonst nie, sondern immer ganz der Wissenschaftler.
Als wenn der Professor ihre Gedanken erraten hätte, zog er geräuschvoll die Nase hoch, setzte seine Brille wieder auf, stampfte mit seinem Stock auf den Boden und hatte sich augenblicklich wieder im Griff. »Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Mitarbeit«, sagte er nun wieder gefasst. »Das Frühstück geht auf mich.«
»"Tatte"?«, fragte John und alle erhoben sich.
»Natürlich«, antwortete der Professor.
Wenige Minuten später stiegen sie aus Johns grauem, zehn Jahre alten Buick Regal in der Nähe von "Tatte Bakery & Cafe". John parkte in der 3rd Street und sie gingen die letzten Schritte zu Fuß. Das Lokal lag unweit ihres Labors und sie erreichten es immer schnell mit dem Auto, wenn sie kurzfristig Kaffee oder etwas Gebäck benötigten, oder nach einem Spaziergang zu Fuß, wenn sie sich ihr Hirn nach einer durchgearbeiteten Nacht mit frischer Luft durchpusten lassen wollten. Heute jedoch stand ihnen der Sinn nach einer zügigen Ankunft.
In guter Stimmung traten sie durch das Glasportal in die weite helle Halle, die ihnen schon manches Mal die Müdigkeit vertrieben hatte.
»Ich darf mich setzen?«, fragte Prof. Kozlowski und war bereits auf dem Weg zu einem der großen schweren Holztische, an dem sie alle Platz hatten. »Für mich wie immer, John.«
»Selbstverständlich«, antwortete dieser, unsicher, ob der Professor ihn überhaupt noch gehört hatte. Der alte Wissenschaftler hatte ihm bereits vor Betreten des Lokals einen 50 Dollar Schein zugesteckt und war nun wie immer der Erste, der saß. Durch den Stock beeinträchtigt, wollten es ihm die anderen nicht auch noch zumuten, ein Tablett zu balancieren.
Als sie alle mit ihren Bestellungen am Tisch saßen, Kaffee tranken und Gebäck aßen, fiel die Anspannung der letzten Tage von ihnen ab und sie plauderten gelöst miteinander. Sie beobachteten die anderen Kunden, die kamen und gingen, sich an Nebentische setzten, oder das Lokal mit ihren Speisen verließen, um ihren Tag zu beginnen. Sie redeten und lachten und waren durch den Schlafmangel und ihren Erfolg eher aufgedreht als müde. Schließlich, als alle mit essen und trinken fertig waren, wurde der Professor wieder ernst.
»Meine Lieben«, begann er, »die letzte Zeit, ja, die letzten Jahre waren nicht leicht für uns. Einen richtigen Urlaub hatte schon lange keiner mehr, mancher noch nicht einmal ein freies Wochenende.« Dabei sah er Esteban an und Helen klopfte dem Studenten anerkennend auf die Schulter. »Wir machen jetzt folgendes, und ich möchte keine Widerworte hören. Auch von Ihnen nicht, Seňor Hermoza. Wir werden jetzt zurück ins Labor fahren, unsere Dateien sichern, unsere Notizen zuklappen, alles abschließen und dann machen wir ein paar Tage frei. Das haben wir nötig und wir haben es uns verdient. Heute ist Mittwoch und wir sehen uns am nächsten Montag wieder im Labor. Dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Wir müssen weitere Tests machen, die Forschung voran treiben und uns darüber klar werden, was wir nun mit unserem Erfolg anfangen wollen.«
»In fünf Tagen erst!«, keuchte Esteban erschrocken.
»Warum machen wir nicht jetzt weiter, da wir das große Problem gelöst haben?«, fragte Helen. Sie alle sahen ihren Professor drängend an.
»Meine lieben Freunde«, antwortete Prof. Kozlowski milde, »haben Sie denn aus der vergangenen Nacht nichts gelernt? Wir haben nun alle Zeit der Welt. Und wenn Sie es schon nicht ganz ohne Arbeit aushalten können, kommen Sie ja vielleicht am Montag direkt mit ein paar Ideen zurück, wie wir nun unser neu gewonnenes Wissen einsetzen wollen.«
»Alle Zeit der Welt«, brummte Esteban.
Die Vier erhoben sich, um das Lokal zu verlassen. Sie gaben ihre Tabletts zurück und als John sich zum Gehen umwandte, stieß er unvermittelt heftig mit jemandem zusammen. Ein Becher wurde zusammengepresst, der Kunststoffdeckel löste sich und ein Schwall heißen Kaffees ergoss sich urplötzlich auf die beiden. John sprang erschrocken einen Schritt zurück. Die Person blieb wie angewurzelt reglos stehen und John sah sich einer Frau in einem gelben Sommerkleid gegenüber, die entsetzt auf den dunklen Fleck auf dem hellen Stoff starrte.
»Mist. Was…«, begann sie stammelnd und versuchte, ihr mit heißem Kaffee getränktes Kleid, so gut es ging, mit den Fingern vom Körper fern zu halten. »Was stimmt nicht mit Ihnen? Haben Sie keine Augen im Kopf? Das ist eins meiner Lieblingskleider, oder besser, war es. Sehen Sie sich an, was Sie angerichtet haben. Das geht nie wieder raus«, fuhr sie John direkt an.
John stand stocksteif da, spürte weder das heiße Getränk auf seinem Hemd, noch wie es auf seine Schuhe tröpfelte, bekam keinen Ton heraus und konnte die Frau nur anstarren. Wie sie im Morgenlicht, das durch die hohen Fenster fiel, dastand, schlank, hübsch, mit langen braunen Haaren und versuchte, durch Wedeln ihr Kleid und ihre Haut zu kühlen, war das Schönste, was er je in seinem Leben gesehen hatte.
»Was ist denn los mit Ihnen?«, fuhr sie fort. »Warum sagen Sie denn nichts? Eine Entschuldigung wäre doch das Mindeste.«
»Alle Zeit der Welt«, brachte John nur leise murmelnd hervor.
»Was?«, fragte die Frau.
»Äh, nichts. Oh Gott, das tut mir schrecklich leid«, sagte John endlich, als die Starre von ihm abfiel. Er griff sich einige Papierservietten von der Theke, ging einen Schritt auf die Frau zu und machte Anstalten, den Fleck von ihrem Kleid zu wischen.
Die Frau trat sofort einen Schritt zurück, ließ ihr Kleid los und streckte die Arme abwehrend aus. »Bleiben Sie mir bloß vom Leib. Sie machen es nur noch schlimmer«, schimpfte sie verärgert.
Johns Kollegen hatten sich umgedreht und standen nun um ihn herum und betrachteten die Szene. Esteban verdrehte die Augen.
Helen meinte amüsiert: »Im Ernst, John? Ist das deine Masche?«
Prof. Kozlowski erklärte: »Junge Dame, zu so einem Zusammenprall gehören immer zwei. Sie hätten ja auch einen Bogen um John machen können. Er konnte Sie ja gar nicht hinter sich sehen.«
Die Frau starrte die Vier mit weit geöffneten Augen an. »Ja, im Ernst, John? Was seid Ihr für eine Truppe?«
»Wir sind…«, begann John, wurde aber vom Professor unterbrochen, der ihm seine Hand auf den Arm legte.
»Wir sind Kollegen«, meinte der alte Mann lediglich.
»Aha«, entgegnete die Frau, als würde das alles erklären. Dann sah sie wieder an sich hinab und zeigte mit beiden Händen auf den großen Fleck. »Und was machen wir jetzt hiermit?«
»Das bringe ich selbstverständlich wieder in Ordnung«, antwortete John schuldbewusst.
»Wie? Wie wollen Sie das wieder in Ordnung bringen?«, fragte die Frau resignierend.
Erst war sie wütend, jetzt war sie traurig. John fand sie wundervoll. »Sie lassen es reinigen. Ich bezahle natürlich dafür.«
»Ich glaube nicht, dass das jemals wieder gut wird«, widersprach sie.
»Das werden wir sehen«, meinte John beschwichtigend. »Jetzt lassen Sie es erst mal reinigen und wenn es tatsächlich nicht mehr hinzubekommen ist, sehen wir weiter. Zur Not kaufe ich Ihnen ein neues Kleid.«
»Tatsächlich?«, fragte die Frau etwas milder gestimmt. »Das würden Sie tun?«
»Ja, das würde ich. Natürlich hätten Sie ja fairerweise auch etwas besser aufpassen können,…«
»Mach es jetzt nicht kaputt«, raunte Helen.
»…aber ich fühle mich für diesen Schlamassel verantwortlich.«
»Ja, ok, wenn das so ist. Und was ist mit meinem Kaffee?«
John musste lächeln. »Den gibt es natürlich auch neu. Direkt jetzt. Wie mögen Sie ihn?«
Sie sagte es ihm, John bestellte, bezahlte und gab ihn ihr.
»Und wie regeln wir das jetzt? Ich meine den Ablauf«, fragte die Frau.
»Sind Sie öfter hier?«, wollte John wissen.
Esteban verdrehte wieder die Augen. Dieser Spruch war so vorsintflutlich.
»Ja«, erwiderte sie. »Fast immer vor meinem Dienst hole ich mir hier einen Kaffee.«
»Und ich arbeite ganz in der Nähe«, meinte John lächelnd. »Dann haben wir schon mal eine Anlaufstelle, die wir als Treffpunkt nutzen können. Ich schlage vor, wir tauschen unsere Telefonnummern aus, Sie lassen Ihr Kleid reinigen und anschließend regeln wir hier das Finanzielle.«
»Einverstanden«, sagte die Frau knapp. »Ich muss jetzt auch mal langsam los. Und zur Toilette sollte ich besser auch noch kurz, vielleicht kann ich noch etwas retten.«
Die beiden holten ihre Smartphones heraus und tauschten ihre Nummern aus.
»In Ordnung, John«, sagte der Professor. »Können wir dann jetzt?« Er drehte sich um, klackerte mit seinem Stock in Richtung Ausgang und Helen und Esteban folgten ihm.
Die Frau gab noch seinen Namen zu der Telefonnummer in ihr Gerät





























