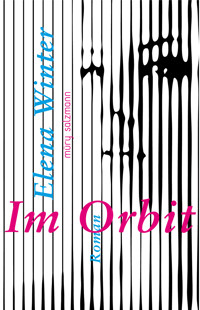Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müry Salzmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Tage. Und ausgerechnet Hamburg, wegen einer Fortbildung. Der Vater schüttelt verächtlich den Kopf. Noch nie war sein Sohn länger weg, bis auf eine Fahrt in die Normandie mit der Schule. Jetzt ist Stephan Mitte fünfzig und lebt bei seinem Vater auf dem Hühnerhof. Die Dorfgemeinschaft hat dieses seltsame Duo längst in ihren Alltag integriert: Schon nach dem Tod der Mutter, als Stephan noch ein Kind war, hat der Vater alles daran gesetzt, seinen Sohn für sich zu vereinnahmen. Die Suche nach einer Partnerin hat Stephan irgendwann aufgegeben – allein die Vorstellung, dass eine Frau zu ihm nach Hause käme und der Vater, wie jeden Tag, gerade über seinen drei Spiegeleiern säße ...! Dann passieren Dinge im Dorf: Ein Wolf geht um und bringt das örtliche Gefüge durcheinander. Und Stephan macht eine Entdeckung, die die Weichen für sein Leben neu stellen könnte ... In Elena Winters zweitem Roman haben die vielfach literarisierten Mütter einmal Pause: Mit sprachlicher wie psychologischer Treffsicherheit serviert uns die Autorin das Kammerspiel einer toxischen Vater-Sohn-Beziehung unter der Glasglocke eines Dorfes – mit den bildhaften Schilderungen seiner Bewohner:innen eine entdeckenswerte Welt für sich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Vier Tage. Und ausgerechnet Hamburg, wegen einer Fortbildung. Der Vater schüttelt verächtlich den Kopf. Noch nie war sein Sohn länger weg, bis auf eine Fahrt in die Normandie mit der Schule. Jetzt ist Stephan Mitte fünfzig und lebt bei seinem Vater auf dem Hühnerhof. Die Dorfgemeinschaft hat dieses seltsame Duo längst in ihren Alltag integriert: Schon nach dem Tod der Mutter, als Stephan noch ein Kind war, hat der Vater alles daran gesetzt, seinen Sohn für sich zu vereinnahmen. Die Suche nach einer Partnerin hat Stephan irgendwann aufgegeben – allein die Vorstellung, dass eine Frau zu ihm nach Hause käme und der Vater, wie jeden Tag, gerade über seinen drei Spiegeleiern säße ...! Dann passieren Dinge im Dorf: Ein Wolf geht um und bringt das örtliche Gefüge durcheinander. Und Stephan macht eine Entdeckung, die die Weichen für sein Leben neu stellen könnte ... In Elena Winters zweitem Roman haben die vielfach literarisierten Mütter einmal Pause: Mit sprachlicher wie psychologischer Treffsicherheit serviert uns die Autorin das Kammerspiel einer toxischen Vater-Sohn-Beziehung unter der Glasglocke eines Dorfes – mit den bildhaften Schilderungen seiner Bewohner:innen eine entdeckenswerte Welt für sich!
Die Autorin
Elena Winter wurde 1980 in Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, geboren. Sie arbeitet als freie Journalistin, Texterin und Redakteurin und lebt in Berlin. Nach ihrem Studium der Germanistik, Medienwissenschaft und Linguistik in Düsseldorf promovierte sie 2009 mit einer Arbeit über Improvisationsformate im Fernsehen. Neben Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien ist Im Orbit ihr erster Roman.
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern’,
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.
Friedrich Hölderlin, Lebenslauf
EINS
Draußen vor dem Fenster liegt ein Riese auf dem Rücken und schläft. Ich schaue hinaus auf die Hügelkette in der Ferne und erkenne seinen Brustkorb und den runden Schädel. Der Donnerberg ist die Nase, der Wasserturm auf seiner Spitze eine lästige Fliege. Der Riese hat sich zurechtgemacht. Ein frisches, hellgrünes Hemd hat er angezogen.
Ich sollte mir ein Beispiel daran nehmen. Stattdessen trage ich den ausgewaschenen Schlafanzug. Den, der an den Bündchen schon ausleiert. Den von Vater. Er trägt ihn nicht mehr. Das Blau ist längst verwaschen, die dünnen Querstreifen kaum noch zu erkennen. Ich schaue auf den morschen Stoff an meinem rechten Handgelenk. Mit der anderen Hand zerre ich daran, immer fester. Es ist der erste Handgriff des Tages. Dabei war ich noch gar nicht richtig wach. Der Ärmel zerfällt und hängt mir nun wie ein nasser Vogelflügel von der Schulter. Ich richte mich auf und schäle mich im Sitzen aus dem Rest des Schlafanzugoberteils. Dann bugsiere ich meine Beine aus dem Bett und stehe auf.
Unten im Hof höre ich Vater pfeifen. Es ist die Melodie des Schrottsammlers, wenn er am Abend durch die Straßen unseres Dorfes fährt. Ein monotones Dudeln vom Band, das meist einsetzt, wenn ich gerade von der Arbeit heimkomme und den Wagen vor dem Scheunentor parke. Ich habe Schwierigkeiten, bei dieser Melodie den Tag zu beginnen. Meine Willenskraft wird mit jedem Ton eine Stufe zurückgestellt. Die Bewegungen bleiben langsam. Der Griff zur Zahnbürste, das Ankleiden. Minutenlang hantiere ich mit dem Oberhemd und der Krawatte herum. Als ich das Schildchen hinten im Halsausschnitt meines T-Shirts zu fassen kriege, reibe ich es eine Weile zwischen den Fingern hin und her und lausche dem leisen Knistern.
Irgendwann stehe ich fertig in der Küche. Der Kaffee in der Kanne ist lauwarm. Vater ist im Stall bei den Hühnern. Wie so oft hat er mir einen Klecks Rührei übriggelassen. Ich belege damit eine Scheibe Schwarzbrot, und während ich kaue und dabei die Maserung des Küchentischs betrachte, gehe ich den Tag durch. Versicherungsscheine ausstellen, Anträge prüfen, Telefonate führen mit zwei, drei Kunden und mit meinem Chef in der Hauptniederlassung, den Wasserkocher entkalken. Um 14 Uhr müsste alles erledigt sein. Vielleicht hole ich mir an der Bude nebenan einen Döner und verbringe den Rest des Nachmittags auf einer Bank im Ort oder im Supermarkt. Wir brauchen Orangensaft, getrocknete Pflaumen, Toilettenpapier und einiges mehr. Vater braucht Rasierwasser. Ich kriege die Zeit schon um.
Draußen wieder Vaters Pfeifen. Jetzt klingt es wie die ersten Takte von Yellow Submarine, das gestern im Radio lief. Ich weiß genau, wie Vater aussieht, wenn er pfeift. Wie er die Lippen schürzt. Wie sich seine geröteten Wangen sachte aufblähen. Die dicke Ader an seiner Schläfe zieht sich dabei für einen Moment zurück. Der Blick, eine Mischung aus Konzentration und Gleichmut, ist ganz den Hühnern gewidmet. Vater beruhigt die Hühner mit seinem Pfeifen, aber auch schon mit seiner bloßen Anwesenheit. Sie werden friedlicher, wenn er in den Stall kommt. Ich habe es schon oft erlebt, wenn ich ihm beim Füttern zugesehen habe. Es ist, als würde sich durch ihn ein tiefer Friede auf die Tiere legen. Ganz anders bei mir. Wenn ich frühmorgens allein das Füttern übernehme, weil Vater zum Beispiel bei Doktor Blomenkamp im Ort ist oder bei der Physio, fühle ich mich auch nach über fünfzig Jahren noch wie ein Lehrling. Da kann ich tun, was ich will. Ich kann pfeifen, mit ihnen sprechen oder einfach still meine Arbeit tun. Es ändert nichts. In meiner Gegenwart flattern die Tiere wild durcheinander, und immer wieder bleibt eines an den Flügeln eines anderen hängen. Ich weiß nicht, was es ist, was Vater mit den Hühnern macht. Welche Kraft von ihm auf sie übergeht. Es ist ein Geheimnis, das ihn und die Tiere von mir trennt.
*
Die Hühner! Kümmere dich um die Hühner! Es ist ein blasses Bild, eine Erinnerung aus Kinderzeiten. Es ist noch nicht Frühling, ich bin sechs. Vater und Mutter auf dem Weg in die Stadt. Mutter hatte wieder einen Schwächeanfall, so erklärten sie es mir. Ich stehe reglos in der Einfahrt des Hofes, ich sehe unserem alten Peugeot hinterher und überlege, was Kümmern heißt. Ob es reicht, einfach da zu sein. Am Abend öffne ich die morsche Holztür und betrete den Stall. Hallo, ich bin da, flüstere ich und starre in die Finsternis. Ein Rascheln und Scharren in den Holzspänen ist die Antwort. Als meine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben, sehe ich einige Tiere auf der Stange sitzen. Andere picken vor meinen Füßen ziellos herum. Ich versuche, jedem Huhn über den Kopf zu streichen. Die meisten schrecken auf und laufen davon, Berührungen sind sie nicht gewohnt. Ich habe schon mehrmals das Füttern übernommen, aber immer gemeinsam mit Vater. Jetzt fühlt es sich anders an. Wichtiger, dringlicher. Und es kommt allein auf mich an, ich darf nicht fehlen. Was mir aufgetragen wurde, duldet keinen Widerspruch und keinen Aufschub. Ich nehme zwei Schaufeln voll Futter und fülle sie in den Trog. Die Hühner werden hysterisch, so habe ich sie noch nie erlebt. Sie laufen aufgeregt umher und picken und schubsen einander zur Seite. Nur ein einziges bewegt sich nicht. Es liegt unter der Stange. Merkwürdig steif sieht sein Körper aus, wie er da auf der Seite liegt. Die Füße mit den gespreizten Krallen weit nach vorne gestreckt. Das weiße Gefieder wirkt wie ein Mantel, der ihm nicht mehr passen will. Ich nehme das Tier hoch und betrachte es von allen Seiten. Ganz leicht liegt es auf meinem Arm, als hätte sich seine schwere Seele schon davongemacht. Es atmet nicht mehr. Aber anders als die anderen lässt es sich berühren. Ich stehe eine Weile so da, dann trage ich das Huhn hinaus. In der Garage suche ich eine Schaufel und grabe unter einem der Apfelbäume hinter dem Stall ein Loch in die harte Erde. Das Tier passt genau hinein. Ich schütte das Loch wieder zu und bete drei Vaterunser, weil mir das richtig erscheint. Dann erst merke ich, wie sich mein Bauch zusammenzieht, als wollte er mich auspressen. Die Übelkeit greift nach mir, der Stamm des Apfelbaums dreht sich vor meinen Augen wie eine Spindel. Ich fange an zu würgen und fördere die halb verdaute Erbsensuppe vom Mittagessen wieder zutage. Sie landet als blassgrüner Fladen direkt auf dem Grab. Die Gewissheit kommt wie die Nacht nach dem Tag. Ich habe mich nicht gekümmert, ich habe versagt.
Vater und Mutter kamen an dem Abend nicht wieder. Das war ungewöhnlich, ich kannte es nicht, allein auf dem Hof zu sein. Ich verbrachte die Nacht ohne Schlaf. Draußen ging ein scharfer Wind, er pfiff durch die Kronen der kahlen Bäume. Auf meiner Zimmerdecke tanzten die Schatten. Immer wilder bewegten sie sich. Wie Greifarme streckten sie sich nach mir aus und versuchten mich zu packen. Ich starrte sie an und redete mir ein, dass sie von mir ließen, wenn ich nur still genug liegenbliebe.
Ich dachte an meine Mutter. Ich fragte mich, was ich getan hatte, dass es ihr in den letzten Monaten immer wieder schlecht ging. Ich erinnerte mich daran, dass sie oft, wenn sie in der Küche stand und am Herd hantierte, für einen Moment innegehalten hatte. Wie sie dann kurz die Augen schloss, Atem holte. Wenn sie wieder aufblickte und ihr bewusst wurde, dass ich sie beobachtet hatte, bekam ihr Blick etwas Mildes und Erschöpftes. Was hast du, fragte ich einmal. Sie blinzelte dann nur und lächelte mich an, und es kam mir vor, als wäre sie soeben aus einer anderen Zeit zurückgekehrt oder von einem anderen Ort.
ZWEI
Mein Opel muss in die Werkstatt. Der Motor knurrt seit Tagen. Vielleicht die Zylinderkopfdichtung oder eine defekte Zündkerze. Ich schalte das Radio ein, damit ich das Geräusch nicht höre. Die Boxen knarzen, und zwischendurch spucken sie Teile eines Popsongs aus. Knowing … Love … For ever … Uuuuh. In unserer Gegend hat man schlechten Empfang. Auch Internet gibt es erst seit kurzem. Bis dahin musste man noch auf den Hügel hinter dem Haus der Schöllermanns steigen und das Handy in die Luft halten. Bernd Schöllermann hat das eine Zeit lang gemacht und sich irgendwann beim alten Jürgens, dem Bürgermeister, beschwert. Die digitale Infrastruktur, der Tourismus, die Wettbewerbsfähigkeit. Wie überreifes Obst hatte er ihm die Worte auf offener Straße an den Kopf geworfen. Ihn gefragt, ob er als Bürgermeister sein Dorf denn gar nicht zukunftsfähig machen wolle. Ihn angebrüllt, dass er froh sei, als Architekt nicht in dieser Pampa zu arbeiten, sondern nur zu wohnen (dabei ist bekannt, dass Bernd längst in Rente ist). Der alte Jürgens hatte geduldig auf seine Schuhe geblickt. Bist du jetzt fertig, hatte er dann gefragt und war weitergegangen. Ein paar Monate später haben Bagger die Straßen aufgerissen und allerhand Kabel verlegt. Und Bernd veröffentlichte kurz darauf einen Artikel in der Morgenpost: Unser Dorf ist in der Neuzeit angekommen.
Die Straße hat einen silbrigen Glanz. Heute Nacht muss es geregnet haben. Je näher ich dem Ort komme, desto deutlicher werden die Stimmen im Radio. Die Staumeldungen, ein Bericht über Zwangsarbeit in Rumänien, Love is a stranger von Eurythmics in der Langversion. Ich lasse alles durch meine Ohren rauschen, es erreicht mich nicht. Mein Auto schluckt den glänzenden Asphalt. Rechts und links ziehen die Rapsfelder, die Bäume, die ersten Häuser des Ortes vorbei. Sie fliegen der Reihe nach aus meinem Gesichtsfeld und sind verschwunden.
*
Im Herbst sollte die Schule für mich anfangen. Mutter hatte mir versprochen, mich in den ersten Monaten hinzubringen, und ich fürchtete, dass das nicht mehr geschehen würde, nachdem sie an dem Abend mit dem toten Huhn gemeinsam mit Vater weggefahren war. Dass ich nun allein den Weg ins Nachbardorf gehen müsste. Wenn ich im Bett lag und die Schatten der Bäume an meiner Zimmerdecke beobachtete, malte ich mir aus, wie ich auf den Straßen und Feldwegen verloren gehen und verschluckt werden würde von etwas Schrecklichem. Der dichte Fichtenwald machte mir Angst. Wie überhaupt alle Bäume es taten und bisweilen immer noch tun. Mit ihren Ästen und Stämmen bedrohen sie mich. Der Wald am Ausgang unseres Dorfes hatte dünne langgestreckte Arme, die von irgendwo hoch oben kamen und senkrecht in die Tiefe griffen und mich eines Tages packen würden. Hier müsste ich im Herbst vorbeigehen, wenn ich zur Schule wollte. Allein. Der Gedanke daran fing in meinem Bauch an und breitete sich dann überall im Körper aus. Es war ein Stechen und Zerren, ich fing an zu schwitzen, und im nächsten Moment fröstelte es mich unter meinem dicken Federbett. Der Wind draußen hatte nachgelassen, und ich starrte weiter an die Zimmerdecke und versuchte mich nicht zu bewegen. Ich dachte an Mutters Stimme, die mir zum Einschlafen oft Geschichten von einem lila Grashüpfer erzählt hatte. Toni hieß er. In diesem Moment merkte ich, wie mir der Klang von Mutters Stimme nicht mehr einfallen wollte. Wie ein Lied, das man sehr mag und dessen Melodie man vergessen hat. Ich hatte auch später nicht mehr viele Gelegenheiten, ihre Stimme zu hören, und bald darauf war sie stumm.
In einem viel zu heißen Mai starb sie. Ich sehe Vater aus dem Schlafzimmer treten, in dem meine Mutter seit Wochen gelegen und schwer geatmet hatte. Nur kurz begegne ich seinem leeren Blick. Vater geht geradewegs in den Hühnerstall. Was er da tut, weiß ich nicht. Ich wage nicht, die Schlafzimmertür zu öffnen. Stattdessen stehe ich lange Minuten im Flur, dann setze ich mich auf die Stufen und zähle die Gitterstäbe des Treppengeländers. Ich schaue erst hoch, als Doktor Blomenkamp senior an mir vorbei ins Schlafzimmer geht. Er streicht mir über den Kopf und sagt irgendetwas mit seiner knarzigen Stimme, die mich immer an dieses Kinderspielzeug erinnert. An diesen Stab aus buntem Holz, dessen Aufsatz beim Drehen ein Knattern erzeugt. Ich lasse mir die Berührung des Doktors gefallen, der dunkle Flur verschluckt seine Worte, als seien sie nie gesagt worden.
Mehr weiß ich nicht von diesem Nachmittag im viel zu heißen Mai. Das Leben ging weiter. Das war früher immer Vaters Spruch gewesen. Das Leben geht weiter. Dabei sah er mich an, als sei ich selbst damit gemeint. Als sei ich es, der das Leben anschubsen müsse wie ein altes Karussell vom Jahrmarkt. Ein Karussell, auf dem Vater in der glitzernden Kutsche oder auf dem Elefanten sitzt. Ich habe es oft geträumt. Wie ich im Kreis laufe, die Hände um eine rot-gelb-gestreifte Stange geklammert, und die Karosserie mit all ihren Tieren und Fahrzeugen in Schwung bringe. Vater sieht mich an und lächelt und ist zufrieden.
Ein paar Monate, nachdem Mutter gestorben war, kam ich in die Schule. Ich war jetzt sieben und einer der ältesten unter den Erstklässlern. Ich glaube, Mutter hatte es sich so gewünscht. Sie wollte mich möglichst lange zu Hause bei sich haben, als sie erfahren hatte, dass sie krank war.
Vater hatte mir für die Schule einen roten Ranzen gekauft, der mit Pferdeköpfen bedruckt war. Zwei Mädchen aus meiner Klasse besaßen den gleichen und zogen mich auf, und anfangs verstand ich nicht warum.
Meine Schule lag im Nachbarort und war zu Fuß etwa eine halbe Stunde von unserem Hof entfernt. Vater erklärte mir mehrmals den Weg. Die Dorfstraße entlang, bei der Gabelung nach links abbiegen, dann wieder nach links und vorbei an Bauer Scheuren und den Schöllermanns, vorbei am Wald. Hast du verstanden, Stephan?
Ja, sagte ich.
Dann guck auch so!, sagte Vater, und seine Stimme bekam etwas Hartes.
Es fiel mir schwer, zu gucken, wie Vater es wollte. Ich dachte an den Wald. In den ersten Tagen schaffte ich es, die Bedrohlichkeit, die von ihm ausging, auszublenden, indem ich mich auf das Rasseln der wenigen Stifte in meinem Ranzen konzentrierte. Aber schon nach den ersten Schultagen war er mit Büchern gefüllt und rasselte nicht mehr beim Gehen. Ich hatte nichts mehr, was mich ablenken konnte von den Greifarmen und dem beharrlichen Knacken und Knistern, das aus der Tiefe des Waldes zu kommen schien. Sobald ich das dunkle Gitterwerk vor mir sah, sobald ich auch nur in die Nähe der dürren Stämme kam, die sich am Waldrand wie Fingerknochen aus dem Erdreich streckten, fing ich an zu zittern. Ich fürchtete, meine Beine würden versagen und mich zu Boden zwingen. Oft sah ich mich, wie ich durch eine schwammige, schwarze Gestalt in das Finstere des Waldes gezogen wurde, die Füße voran. Dennoch schaffte ich es anfangs, meinen Schulweg fortzusetzen. Aber meine Angst steigerte sich immer mehr. Sie nahm Fahrt auf wie auf einer Sprungschanze.
Eines Morgens beschloss ich, statt von der Dorfstraße nach links abzubiegen und den direkten Schulweg zu nehmen, nach rechts zu gehen. Eigentlich war es mehr ein Ziehen von irgendwoher als ein fester Entschluss. Ich musste den Wald umgehen. Also lief ich stattdessen durchs ganze Dorf, vorbei an dem ehemaligen Schulgebäude, das seit Jahren leer stand, und von dort über die Felder. Der Weg zog sich, die Landschaft wurde immer weiter, baute sich immer größer vor mir auf. Es war, als liefe ich auf einem Spielbrett, und jemand würde kleine Holzbausteine vor meine Füße legen. Einen nach dem anderen und immer mehr. Auf sie musste ich treten, wenn ich weiterkommen wollte. Ein Zurück gab es nicht. Mit dem wackelnden Schulranzen auf dem Rücken fing ich an zu rennen. Ich durfte nicht zu spät kommen. Und tat es auch nicht. Verschwitzt und außer Atem kam ich pünktlich um kurz vor acht an der Schule an. Ich lehnte mich vor die dicke Tür des Schulportals, stieß sie mit der Schwere meines erschöpften Körpers auf und ging in meine Klasse.
Vater durfte von meiner Waldangst nichts wissen. Er hätte mich für einen Feigling gehalten. Ich überlegte, was zu tun wäre. Wie ich den Wald auch in Zukunft umgehen könnte und gleichzeitig Vater nichts davon erzählen müsste. Die Lösung wäre gewesen, früher das Haus zu verlassen, um den Weg über die Felder ins Nachbardorf zu nehmen. Aber was hätte ich Vater gegenüber sagen sollen? Außerdem musste ich ihm in der Frühe mit den Hühnern helfen. Vor Viertel nach sieben konnte ich den Hof nicht verlassen. In meinem kleinen Kopf arbeitete es, aber er kam zu keinem Ergebnis. Und so machte ich jeden Morgen einen Dauerlauf. Dabei spürte ich, wie mein Rücken unter den breiten Riemen von Vaters Ranzen weiter und weiter nach unten gezogen wurde. Aber ich lief. Durchs Dorf und entlang der Felder, über lehmigen Boden und harten Asphalt. Jeden Morgen, viele Jahre lang.
*
Am späten Nachmittag laufe ich über den Marktplatz, an dessen Rand die ersten Häuser schon ihre Schatten abgelegt haben. Ich lasse mir Zeit. Die Aktentasche mit den Versicherungspolicen und den Bankunterlagen habe ich wie ein riesiges Fieberthermometer unter den Arm geklemmt. Mein Chef will, dass ich sie täglich nach Feierabend mit nach Hause nehme. Dabei ist in unserer Zwei-Mann-Niederlassung noch nie eingebrochen worden. Versicherungen sind für die Leute zu abstrakt. Für Kleinkriminelle erst recht. Was gibt es da schon zu holen. Eher wird man bei einer Versicherung sein Geld los, als dass man welches bekommt. Das ist die weitläufige Meinung. Und trotzdem schließen die Leute Verträge ab, um ihrem Lebensglück auf die Sprünge zu helfen. Oder um zumindest das Pech nicht herauszufordern. Haftpflichtzusatzversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen, Tierkrankenversicherungen. Unser Portfolio ist groß. Und unsere Bilanzen stimmen. Schon seit Jahrzehnten. Ich bilde mir darauf nichts ein, ich bin nur ein kleines Licht in einem großen Konzern. Wenn ich ausgehe, leuchtet die Firma weiter. Aber ans Aufhören ist nicht zu denken, was soll ich auch sonst tun. Ich habe nichts anderes gelernt. Die volle Wahrheit ist, ich habe nicht mal Versicherungskaufmann gelernt. Manchmal falle ich wie Badeschaum in mich zusammen, wenn ich mir das bewusst mache. Vater hat mir die Stelle vor über dreißig Jahren verschafft, als mein Vorgänger in Rente ging. Er war ein guter Kunde. Möglicherweise hat Vater ihm das Eier-Abo – Hühnerglück von Pankratz – kostenlos zur Verfügung gestellt, als Dank für das gute Wort, das er beim Chef eingelegt hat. Für Vater jedenfalls war es gut, dass ich die Stelle angenommen habe. Und dass ich nicht wie andere aus meiner Klasse damals in die Stadt auf die Berufsschule oder gar zum Studieren gegangen bin. Als Studierter vergrault man die Leute, war immer Vaters Ansicht. Die Leute ziehen sich zurück, und man hat keine Freunde mehr im Dorf. Und man wird hochnäsig. Mein Stephan, sagte er oft, hat es auch so zu etwas gebracht. Ich habe nie etwas erwidert.
Es ist Markt. Ich gehe vorbei an den wenigen Ständen. Die letzten Erdbeeren der Saison – jetzt zugreifen. Kartoffeln, fest und mehlig, das Kilo nur zwei Euro dreißig. Einige Bauern grüße ich. Höflich, aber nicht zu höflich. Nicht so, dass es als Einladung zum Gespräch verstanden werden könnte. Die meisten kennen mich. Ich bin für sie der Sohn vom alten Pankratz. Vater hat eine Zeit lang seine Eier hier auf dem Markt verkauft. Bis er sich einen so guten Namen gemacht hatte, dass die Kunden zu uns auf den Hof kamen. Bis heute. Für Vater ist es bequem. So wollte er es immer haben, scheint mir. Nicht groß vor die Tür gehen. Er hat ja alles, was er braucht bei uns auf dem Hof. Seine Hühner, das Auskommen, mich. Einmal, an irgendeinem runden Geburtstag, habe ich ihm ein Abendessen im Singenden Wirt geschenkt. Was soll ich da, hat er mich gefragt, als hätte ich ihm einen Platz in einem Ameisenhaufen angeboten. Da habe ich es begriffen. Seitdem schenke ich Vater nichts mehr. Weil es das größte Geschenk für ihn ist, wenn alles bleiben kann, wie es ist, und wenn er bleiben kann, wo er ist.
Ich stehe vor dem Kartoffelstand, die Aktentasche jetzt zwischen die Beine geklemmt, und zähle mein Kleingeld zusammen. Heute Abend werde ich uns Reibekuchen machen. Das Apfelmus hole ich nachher bei Edeka. Ich fummle in dem viel zu kleinen Fach meiner Geldbörse herum und jage einem Zehn-Cent-Stück hinterher, das sich irgendwo versteckt hat. Als ich kurz hochsehe, steht Jule neben mir, in der Hand einen Sack Kartoffeln, den sie gerade bezahlen will.
Mach du mal zuerst, sagt sie und zeigt mit ihrem Kinn auf meine Geldbörse. Ich gebe die Suche im Innenfutter meiner Geldbörse auf und reiche dem Verkäufer einen Fünf-Euro-Schein.