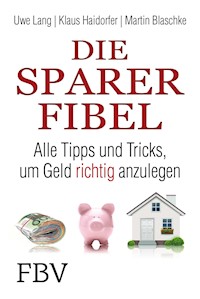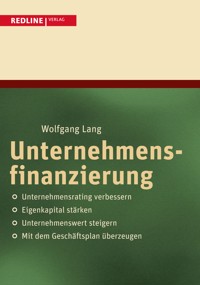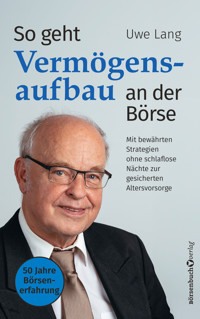
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Börsenbuchverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Uwe Lang, der "Börsenpfarrer", präsentiert in diesem Werk seine Expertise zur Geldanlage mit Fokus auf die Altersvorsorge. Der erfahrene Finanzexperte nutzt seine jahrzehntelanger Börsenerfahrung, um Lesern einen fundierten Leitfaden für ihre finanzielle Zukunft zu bieten. Lang enthüllt bewährte Strategien und Anlagegrundsätze, die er im Laufe seiner Karriere entwickelt hat. Er beleuchtet kritisch gängige Anlageformen und zeigt Wege für eine solide Altersvorsorge. Er erklärt, wie Leser ihr Portfolio diversifizieren und langfristig aufbauen können. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen – von Börsenneulingen bis zu erfahrenen Anlegern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
So geht Vermögensaufbau an der Börse
Uwe Lang
Uwe Lang
So geht Vermögensaufbau an der Börse
Copyright 2025:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Gestaltung Cover: Maja Hempfling
Gestaltung, Satz und Herstellung: Anna Lena Schramm
Vorlektorat: Elke Sabat
Korrektorat: Sabine Runge
Druck: CPI books GmbH, Leck, Germany
ISBN 978-3-68932-030-0
eISBN 978-3-68932-031-7
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
www.instagram.com/plassen_buchverlage
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1:
Vorsorgemöglichkeiten und Zukunftsängste
Kapitel 2:
Mögliche Anlageinstrumente
Kapitel 3:
Der Umgang mit Aktien
Kapitel 4:
Börsenpsychologie
Kapitel 5:
Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse
Kapitel 6:
Mögliche Strategien zum generellen Ein- und Ausstieg
Kapitel 7:
Mein vereinfachter Vorschlag zum Ein- und Ausstieg
Kapitel 8:
Die richtige Aktienauswahl
Kapitel 9:
Strategien mit der Anlage Gold
Kapitel 10:
Haben politische Börsen kurze Beine?
Schlusswort
Einleitung
Wie dringend der Bedarf an einer Beratung für die finanzielle Altersvorsorge ist, wurde mir bewusst, als DER SPIEGEL im Juni 2024 dem Thema gleich eine ganze Titelgeschichte widmete. Ich war überrascht. Denn obwohl ich im selben Jahr an meinem Wohnort mehrmals kostenlose Informationsveranstaltungen über eine effektive Altersvorsorge und bei Bedarf auch Einzelberatungen angeboten hatte, schien das Interesse nicht besonders groß. Vermutlich scheuen sich die meisten Menschen, in einer kleinen Gemeinde andere wissen zu lassen, dass sie in dieser Hinsicht Beratungsbedarf haben. Vor allem Männer haben häufig den Ehrgeiz, zu zeigen, dass sie auf diesem Gebiet schon alles wissen, was nötig ist. Hinzu kam wohl auch noch, dass die meisten Menschen glauben, was nichts koste, sei auch nichts wert.
Dabei hat sich herausgestellt, dass in der Tat für immer mehr Menschen die gesetzliche Rente für die Altersvorsorge nicht reicht. Ergänzungen wie Riester- und Rürup-Rente beziehungsweise private Lebensversicherungen sind aber für die meisten Menschen nicht geeignet, weil sie zu wenig Rendite abwerfen.
Ein neuer Vorschlag ist nun die „Aktienrente“, nachdem bekanntlich der Aktienmarkt meistens sehr gute Renditen erzielt. Und das sollte doch den künftigen Rentnern zugutekommen. In Schweden hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Die Beiträge der Arbeitnehmer werden dort am internationalen Aktienmarkt angelegt – und zwar, ohne dass die Versicherungen und Banken damit Profit machen können, wie es bei Lebensversicherungen, Riester- und Rürup-Renten der Fall ist. Dennoch wird sich die Aktienrente in Deutschland nicht so schnell durchsetzen. Sie wird kritisiert, weil dies mithilfe eines großen Kapitalstocks geschehen soll, der bis zum Jahr 2035 aufgebaut wird. Dafür muss sich der Bund verschulden und Geld am Kapitalmarkt aufnehmen.
Egal, wie es mit der gesetzlichen Rente und deren Ausgestaltung weitergehen wird: Die Idee der Aktienrente ist grundsätzlich gut. Allerdings muss sich im Moment noch jeder Bürger selbst darum kümmern, wie das persönlich gestaltet sein soll. Wir müssen selbst Aktien kaufen! Und wir müssen dabei unabhängig werden von „Beratern“ aus der Finanzwelt, die bei ihren Hinweisen großenteils Eigeninteressen verfolgen. Aber dazu bedarf es einiger Informationen, die dieses Buch liefern soll.
Die verwendeten Abbildungen in diesem Buch beruhen vor allem bei den Aktiencharts auf dem Programm „TAI-PAN 21“ des Verlagshauses Lenz + Partner, dem ich hiermit herzlichen Dank sage.
Kapitel 1
Vorsorgemöglichkeiten und Zukunftsängste
Fehler bei der Altersvorsorge
Gerade bei der Altersvorsorge werden zahlreiche Fehler gemacht, die sich nur noch schwer korrigieren lassen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, das sich in meinem Bekanntenkreis tatsächlich so zugetragen hat. Eine Pensionärin, 75 Jahre alt, wohnt jetzt in einem Seniorenheim und hatte durch den Verkauf ihres Hauses rund 300.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich zu ihrer Rente benötigt sie monatlich noch rund 1.000 Euro, um ihren bisherigen Lebensstandard zu halten. Sie überlegte nun, ob sie 200.000 Euro ihres Kapitals entweder am Aktienmarkt anlegen oder lieber in eine lebenslange monatliche Festrente von 726 Euro investieren sollte, die ihr eine Versicherung anbot. Die restlichen 100.000 Euro wollte sie zur Sicherheit auf ein Sparbuch legen, um flexibel zu bleiben.
Die Versicherung rechnet so: Eine 75-jährige Frau hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 13,11 Jahren. Bei einer monatlichen Auszahlung von 726 Euro kostet das die Versicherung 114.214 Euro. Aber sie kann mit den 200.000 Euro in diesen Jahren gut wirtschaften. In sicheren Aktien angelegt (fünf Prozent Dividendenrendite im Durchschnitt), werden aus den 200.000 Euro in 13 Jahren 377.000 Euro.
Abb.
1.1
Entwicklung von 200.000 Euro in 13 Jahren
Wie sich 200.000 Euro bei fünf Prozent Dividendenrendite in 13 Jahren entwickeln.
Abzüglich der ausbezahlten 114.214 Euro verbleiben dann 262.786 Euro Gewinn. Selbst wenn die Pensionärin 105 Jahre alt wird, kostet das die Versicherung nur 261.360 Euro. Die Versicherungsgesellschaft hat dann aber in 30 Jahren aus 200.000 Euro allein mit fünf Prozent Dividendenrendite 864.380 Euro gemacht, ganz abgesehen davon, dass sich die Aktien bis dahin mit ziemlicher Sicherheit im Kurs mehr als verdoppelt haben werden.
Abb.
1.2
Entwicklung von 200.000 Euro in 30 Jahren
In 30 Jahren werden bei fünf Prozent Dividendenrendite aus 200.000 Euro fast 900.000 Euro.
Ein großartiges Geschäft für die Versicherung! Und für die Pensionärin? Ihre 200.000 Euro sind für immer weg! Käme es zum Beispiel zu einer höheren Geldentwertung, sodass sich innerhalb von zehn Jahren die Heimkosten verdoppeln und sich auch die Preise für Lebensmittel und Reisen stark verteuern, bliebe sie immer auf den monatlichen 726 Euro sitzen.
Ja, leider hat sie das so gemacht! Sie gab die 200.000 Euro der Versicherung, legte aber auf meinen Rat hin wenigstens die restlichen 100.000 Euro in Aktien an und nicht aufs Sparbuch, wo es so gut wie keine Zinsen gibt.
Vernünftiger wäre es gewesen, wenn sie selbst die 200.000 Euro in Aktien zu fünf Prozent Dividendenrendite angelegt hätte und 100.000 Euro zur Sicherheit auf ein Sparbuch. Ihren monatlichen Bedarf von 1.000 Euro hätte sie sogar durch 100.000 Euro auf dem Sparbuch acht Jahre lang abdecken können. Mit ihren Aktien hätte sie in diesen acht Jahren zusätzlich 95.400 Euro erwirtschaftet, und zwar allein mithilfe der fünf Prozent Dividendenrendite. Die Schwankungen am Aktienmarkt konnten ihr gleichgültig sein. Für Anleger mit geringem Einkommen entfällt ja auch die Quellensteuer. Und für Notfälle besäße sie immer noch ihr Aktienpaket, das vermutlich langfristig im Wert steigt, wie es bisher fast immer der Fall war.
Kurzum: Die beste Geldanlage sind im Prinzip Aktien. Es hat seine Gründe, wenn ich gerade als Pfarrer und Seelsorger in einer Zeit, in der so viele über die „Aktienbesitzer“ lästern, darauf hinweise und erkläre, wann Aktienkäufe genau richtig sind und wann man es lieber bleiben lassen sollte. Es gibt so viele Ratschläge. Manche sind brauchbar, andere weniger. Nach der Lektüre dieses Buchs wissen auch Sie, was davon zu halten ist.
Zwar können Dividenden in schweren Wirtschaftskrisen auch mal ausfallen. Aber selbst wenn das passieren sollte: Im Laufe der Zeit passen sie sich bei besseren Konjunkturaussichten auch wieder den Gegebenheiten an. Man darf als Anleger nur nicht den Fehler machen, stur an „Pleite-Aktien“ festzuhalten. Die wichtigste Kennzahl für die Qualität von Aktien ist die „Relative Stärke“. In diesem Buch wird gezeigt, wie wichtig es ist, stets nur Aktien zu halten, die von ihrer Relativen Stärke her zumindest „guter Durchschnitt“ sind.
Wenn jetzt häufig von manchen Börsenbeobachtern davon gesprochen wird, dass die „fetten Jahre“ endgültig vorbei seien und wir unseren Lebensstandard aus diesem Grund im kommenden Jahrzehnt stark einschränken müssten, dann ist das Unsinn. Natürlich gibt es gute Gründe, weniger umweltschädlich zu reisen oder weniger Fleisch zu essen. Dies aber aus Vernunftgründen und nicht, weil man sich einschränken müsste. Negative Stimmungslagen gab es auch 1975, 1982, 1998, 2003 und 2009, und alle diese Krisen hat der Aktienmarkt überwunden. Und das wird auch künftig so sein.
Neben Aktien sind auch Anleihen und Gold gute Möglichkeiten, in Krisenjahren sein Vermögen abzusichern. Die Zeit der Negativzinsen ist vorbei und Gold hat seinen Wert seit Jahrtausenden beibehalten. Aber auch hier gibt es wichtige Regeln, die zu beachten sind und die in diesem Buch erklärt werden.
Riester-Renten, Rürup-Renten, Kapitallebensversicherungen
Die Bundesregierungen haben sich ja so manches einfallen lassen, um die Rente aufzubessern. Da gibt es zum Beispiel die Riester- oder die Rürup-Rente. Diese waren zwar gut gemeint, aber die Ergebnisse sind sehr mager. Und das liegt einfach daran, dass der Staat die nähere Ausgestaltung den Banken und Versicherungen überlassen hat, die daran kräftig mitverdienen wollen. Es gibt zum Beispiel 22 Varianten der Riester-Rente. Sie erzielen jedoch im Durchschnitt nur eine Rendite von 0,8 Prozent, die Rürup-Renten (89 verschiedene Angebote) erreichen im Durchschnitt zumindest ein Prozent. Über zwei Prozent schafften es gerade zwei Angebote der Rürup-Rente, von den Riester-Renten schafft es keine. Der Hauptfehler: Die Versicherer, die die Produkte konstruiert haben, haben (vielleicht absichtlich) mit zu hohen Lebenserwartungen gerechnet. Das hat die Rendite gedrückt. Und die Förderregeln, die sich nach der Zahl der Kinder und nach dem Einkommen richten, sind viel zu kompliziert. Typisch deutsche Bürokratie!
Dass sich auch Kapitallebensversicherungen nicht rechnen, hat sich inzwischen wohl herumgesprochen. In jährliche Rendite umgerechnet sind sie die schlechteste Geldanlage überhaupt! Wenn Sie Ihre Familie im Todesfall absichern wollen, dann tun Sie es, aber vermengen Sie nicht Risikoabsicherung mit Geldanlage!
Sind Immobilien eine Alternative zum Aktienmarkt?
Anleger, denen die Schwankungen des Aktienmarktes zu heftig sind, fragen sich, ob es nicht ratsam sei, am Immobilienmarkt einzusteigen.
Wenn Sie die Absicht haben, in einer selbst genutzten Immobilie zu wohnen, ist das immer sinnvoll, zumal bei den im historischen Vergleich noch niedrigen Zinsen. Sie haben hoffentlich aber nicht vor, eine Immobilie zu kaufen und dann nur zu vermieten? Dazu müssen Sie sich gut auskennen, denn es macht Arbeit, Unkosten und vielleicht auch noch Ärger.
Von offenen und geschlossenen Immobilienfonds rate ich ebenfalls ab. In der Finanzkrise 2007/08 kamen die offenen Immobilienfonds in Bedrängnis, weil zu viele Anleger gleichzeitig ihr Geld abzogen. In der Folge wurden die meisten Fonds jahrelang geschlossen. Und geschlossene Immobilienfonds sind völlig unflexibel. Ihr Geld ist jahrzehntelang gebunden und Sie zahlen hohe Gebühren.
Einfacher hätten Sie es da mit Immobilienaktien. Diese können Sie täglich kaufen und verkaufen. Schauen Sie sich aber genau an, wie diese Unternehmen mit ihren Mietern umgehen! Die Unterschiede sind beachtlich. Einige der Unternehmen sind auch hoch verschuldet. Außerdem sind die Immobilienpreise vor einiger Zeit so stark gestiegen, dass momentan kaum Spielraum nach oben besteht. Die zunehmende Verbreitung von Homeoffice und Versandhandel haben zudem Gewerbeimmobilien unattraktiver gemacht.
Die Argumente der Crash-Propheten
Es ist noch gar nicht so lange her, dass es einige Unheilspropheten geschafft haben, Tausende Anleger mit Crash-Theorien zu verunsichern und es sogar zu einer Besprechung im SPIEGEL (Nr. 48/2019, Seite 59 ff.) zu bringen. Besonders Marc Friedrich und Matthias Weik haben schon seit dem Jahr 2012, vier Jahre nach der letzten Finanzkrise, permanent mit Büchern und Vorträgen vor einem Crash gewarnt, der um ein Vielfaches verheerender sein würde als der Kurssturz im Jahr 2008. Hinzugesellt hat sich dann auch Max Otte mit dem Buch „Weltsystemcrash“, wobei er sich nicht mehr so genau festlegen mochte wie noch Anfang 2018, als er behauptete, die Börse werde noch in Donald Trumps erster Amtszeit (also bis Dezember 2020) zusammenbrechen. Friedrich und Weik legten sich fest, dass das Unheil bis spätestens 2023 die gesamte Gesellschaft erreichen werde. Alle diese Befürchtungen haben sich nunmehr in Luft aufgelöst.
Viele Anrufer in meinen Sprechstunden waren der Meinung, man müsse sich doch mit den Argumenten der Crash-Propheten auseinandersetzen. Nun, wenn es denn wirklich „Argumente“ wären! Aber im Grunde handelt es sich vor allem um wirre Verschwörungstheorien, mit denen die Crash-Propheten ihre Anhänger ködern. Da heißt es zum Beispiel, Komiker regierten das Land. Oder die Europäische Zentralbank wolle das Bargeld abschaffen. Dazu sei aber doch der Hinweis gestattet, dass ähnliche Untergangspropheten bereits seit Beginn der 1970er-Jahre ihr Unwesen treiben. Sie prophezeien seither immer wieder neu den völligen Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems. Vor 16 Jahren bekam ich angesichts der damaligen Finanzkrise folgendes Schreiben:
„Glauben Sie wirklich und immer noch, dass dieses charakterlose, korrupte, kriminelle und von Gier zerfressene Finanzsystem mittelfristig überleben kann? Jetzt werden die Staaten wohl in den Staatsbankrott und schließlich in die Währungsreform getrieben werden und wir werden den Zusammenbruch der größten Industrienationen erleben. Wünschen wir uns Gottes Schutz und Bewahrung; wir werden es dringend brauchen!“
Ich kann diese Äußerung nicht nur angesichts der damaligen Ereignisse gut nachvollziehen. Auch der Cum-Ex-Skandal, als Anleger mithilfe gewiefter Geldexperten Staat und Steuerzahler um viele Milliarden Euro betrogen haben, zeigt ja die Richtigkeit dieser Kritik an unserem Wirtschaftssystem. Trotzdem teile ich nicht die Ansicht, dass es am Ende ist und wir vor einem finanziellen Zusammenbruch stehen. Wir müssen jedoch immer wieder neu dazulernen und Missstände beseitigen, anders geht es nicht.
Übertreibungen werden von der Börse immer wieder korrigiert, aber von abstrusen Verschwörungstheorien lässt sie sich nicht beeindrucken. Schon die letzten 200 Jahre haben gezeigt: Unternehmensbeteiligungen blieben insgesamt als Sachwerte langfristig immer im Aufwärtstrend!
Abb.
1.3
Weltindex seit 1970 in Punkten
Trotz erheblicher Schwankungen stiegen die Aktienkurse in 50 Jahren kräftig.
Bedroht die weltweite Verschuldung die Börse?
Ein Argument der Crash-Propheten beruht auf der Annahme, dass die Staatsschulden immer uneinbringlicher werden und daher zwangsläufig zu Währungsreformen führen. Diese Meinung ist zwar populär, lässt aber volkswirtschaftlichen Sachverstand vermissen. Staaten und Unternehmen können und müssen immer dann Fremdkapital aufnehmen, wenn die Kosten des Fremdkapitals geringer sind als die daraus resultierenden Gewinne. Wir werden darauf noch näher eingehen. Zunächst nur so viel: Unternehmen sind derzeit eher zögerlich mit Investitionen, trotz niedrigerer Zinsen als vor 50 Jahren. Für das, was sie im Moment vorhaben, reicht ihnen großenteils ihr Eigenkapital.
Staaten müssen ebenfalls mit Fremdkapital arbeiten, wenn das Wirtschaftswachstum angekurbelt werden muss, damit entsprechend neue Arbeitsplätze entstehen. Außerdem wird den Anlegern Gelegenheit gegeben, ihr Kapital verzinslich anzulegen, statt es zu horten. Es ist ja genügend Kapital vorhanden, nur will es niemand haben. Inflationär wirkt Staatsverschuldung nur dann, wenn sie schneller ansteigt als das Kapitalvermögen der Staatsbürger insgesamt. Das ist jedenfalls momentan nicht der Fall. Die Inflation ist im Vergleich zu den 1970er-Jahren mit rund zwei Prozent noch niedrig, die Investitionsbereitschaft der Staaten auch. Man ist stolz auf eine „schwarze Null“, statt in die Infrastruktur zu investieren.
Sind die Banken „Krisengewinner“ und halten „Zombiefirmen“ künstlich am Leben?
Ein Vorwurf der Crash-Propheten lautet, die Banken und Versicherungen würden durch staatliche Geldvermehrung immer wieder vor der Pleite gerettet. Die Vorgänge während der Finanzkrise 2007/08 legen diese Auffassung nahe. Doch gerade diese Krise hat gezeigt, dass auch gefährlich scheinende Krisen durch internationale Zusammenarbeit bewältigt werden können. Nicht die Banken sind damals gerettet worden, sondern die Sparer, die ihr Geld den Banken anvertraut hatten. Ja, manche Banken waren zum Teil arglos mit den ihnen anvertrauten Geldern umgegangen und hatten teils windige US-Hypotheken und hoch verschuldete Staaten unterstützt. Es stimmt, dass die Zentralbanken durch Garantien die Liquidität der Banken aufrechterhielten und damit die Sparer und den Wert ihrer Anlagen gerettet haben. Wäre das nicht geschehen, wären tatsächlich viele mittelständische Firmen pleitegegangen. Die Behauptung, die Rettung hätte den Steuerzahler viel Geld gekostet, ist jedoch falsch. Wenn sich Staaten an Banken vorübergehend beteiligt hatten – der deutsche Staat zum Beispiel an der Commerzbank –, dann zu Minipreisen. Mit Gewinn konnten und können diese Beteiligungen wieder veräußert werden. Bei der Rettung Griechenlands in den Jahren 2012 bis 2015 hat zum Beispiel der deutsche Staat sogar Gewinn gemacht.
Wie wenig hingegen die Banken zu „Krisengewinnern“ wurden, mag man an den Kursen der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Schweizer UBS von 2007 bis 2019 ablesen. Sie waren „Krisenverlierer“!
Abb.
1.4
Deutsche Bank in Euro | WKN 514000
Von 2007 bis 2019 fiel der Kurs der Deutschen Bank von 90 auf 6,50 Euro. ©Tai-Pan
Abb.
1.5
Commerzbank in Euro | WKN CBK100
Von 2007 bis 2019 fiel der Kurs der Commerzbank von 200 auf 5 Euro. ©Tai-Pan
Abb.
1.6
UBS Group in Schweizer Franken | WKN A12DFH
Von 2007 bis 2019 fiel der Kurs der UBS von 75 auf 12 Schweizer Franken. ©Tai-Pan
Seit 2007 sind die Anforderungen an die Banken unter anderem durch die Einführung von „Stresstests“ stetig gestiegen, um bei künftigen Krisen auch ohne staatliche Hilfe und ohne Hilfe der Zentralbanken überleben zu können. Riskante Engagements wie das Investmentbanking wurden kräftig beschnitten. Deutsche Bank, Commerzbank und UBS mussten sich völlig neu ausrichten!
Nun wird immer wieder behauptet, Banken und vor allem sogenannte „Zombiefirmen“ seien nur durch die Negativzinsen am Leben erhalten worden. In Wirklichkeit seien sie pleite. Das ist völliger Unsinn! Unrentable Unternehmen bekommen von Banken zu diesen niedrigen Zinsen gar kein Geld. Die Banken sind sehr vorsichtig geworden, nicht zuletzt aufgrund der „Stresstests“, mit denen geprüft wird, ob die Banken über genügend Eigenkapital verfügen.
Ja, die Niedrigzinsen der Zentralbanken haben manchen Unternehmen und auch Banken Zeit zur Konsolidierung gegeben, was ihnen auch geholfen hat. Aber die Hauptursache der Niedrigzinsen war nicht die Politik der Zentralbanken, sondern die mangelnde Investitionsbereitschaft von Unternehmen und Staaten, die neue Schulden mieden und ihr Geld zusammenhielten.
Seit 50 Jahren empfehlen die Crash-Propheten den Anlegern, in Gold, Silber, Grundstücke, Wald und Streuobstwiesen zu investieren. Dabei lassen sie Aktiengesellschaften als Sachwerte wohl deshalb nicht gelten, weil diese ihrer Meinung nach zum großen Teil pleitegehen werden und daher als Anlagewert zu unsicher seien. Sie sprechen gern von einem „Kollaps der Systeme, der alles mit sich reißt“. Aber das ist völlig aus der Luft gegriffen. Im Übrigen widersprechen sich die Crash-Propheten ständig, wenn sie einerseits eine tiefe Deflation wie 1930 bis 1932 mit 20 Prozent Arbeitslosen heraufbeschwören, andererseits gleichzeitig eine Hyperinflation wie in Deutschland 1923 erwarten, dazu eine neue Flüchtlingskrise, schlimmer als 2015, und einen Zusammenbruch der Banken, was angeblich nur eine Frage der Zeit sei. Ja, was nun eigentlich?
Offenbar geht es den Crash-Propheten gar nicht mehr um eine logische Erklärung der Abfolge, sondern nur um Panikmache, wozu jedes Ereignis der Vergangenheit zur Illustration recht ist, und das ohne jeden Zusammenhang.
Wird die Eurowährung auseinanderbrechen?
Die Gemeinschaftswährung Euro hat sich marktwirtschaftlich glänzend bewährt und verhindert, dass europäische Länder wie Italien nicht konkurrenzfähige Unternehmen durch Abwertung ihrer Währung künstlich am Leben erhalten. Die Gemeinschaftswährung in einem großen Teil Europas erleichtert Importe und Exporte und beseitigt viele bürokratische Hürden. Die Einführung des Euro war dringend nötig, um mit Amerika und Asien mithalten zu können. Eine Abkehr vom Euro und der erneute Rückfall in wirtschaftliche Kleinstaaterei hätte schlimme Auswirkungen.
Abb.
1.7
Euro in US-Dollar | WKN 965642
Der Euro hat sich seit seiner Einführung zum Dollar gut behauptet.
In der obigen Grafik sehen Sie die Entwicklung des Euro zum Dollar seit 1998. In der Hightech-Krise 1999 bis 2002 ging es abwärts. Dann war er bis zum Jahr 2008 überbewertet, kam danach wegen der Kapitalknappheit in Südeuropa ins Gerede und notiert im Moment wohl bei seiner tatsächlichen Kaufkraft. Freilich ist der Kurs des Euro zum Dollar auch immer von politischen Gegebenheiten und von der Einigkeit der Europäer abhängig.
Dem Euro droht vor allem dann Gefahr, wenn einige europäische Länder Eigeninteressen über das große Ganze stellen und Europa sich damit gegenseitig aller Chancen beraubt.
Angst vor dem finanziellen Abstieg
Wenn derzeit so viele Anleger den Crash-Propheten zustimmen, dann aus Angst vor dem finanziellen Abstieg. Warum wollte eine Mehrheit der Briten die EU verlassen, obwohl es ihnen schadete? Warum wählte die Hälfte der US-Amerikaner 2016 einen offensichtlich unfähigen Präsidenten, der ihnen keinerlei Vorteile brachte? Und warum tat sie es 2024 wieder? Warum gingen in Frankreich „Gelbwesten“ auf die Straße, destabilisierten die Regierung und brachten das Wirtschaftswachstum auf null? Warum wählten in Ostdeutschland über 30 Prozent der Wahlberechtigten eine rechtspopulistische Partei, die ihnen keinerlei Besserstellung bringt?
Eine wesentliche Ursache ist einfach Ärger. Der Kapitalismus, der 100 Jahre Wohlstand für alle brachte, ist „entgleist“, sagen Fachleute. Man hört von Stellenabbau, von Standortschließungen. Man bekommt mit, dass die Vermögensschere zwischen einigen wenigen und den Normalverdienern immer weiter aufgeht, was vor allem daran liegt, dass sich die Topmanager in ihren Aufsichtsräten weltweit gegenseitig irrsinnig hohe Gehälter und Boni genehmigen und niemand dagegen einschreitet – und dies auf Kosten der Aktionäre, denen ja schließlich die Unternehmen gehören, und auf Kosten der „normalen“ Mitarbeiter in den Unternehmen, die nur 0,5 Prozent von dem erhalten, was ihre obersten Chefs bekommen. Das weckt die Wut der Machtlosen und gleichzeitig die Überzeugung, dass das ganze „System“ korrupt und damit zum Untergang verurteilt sei. Kein Wunder, dass sich viele einfach abgehängt und unbeachtet fühlen. Sie suchen nach Ursachen und „Schuldigen“! Und sie wollen es „denen da oben“ einfach mal zeigen. Sie wollen mit ihrem Verhalten irgendetwas verändern, wobei es ihnen zunächst egal ist, was dabei herauskommt.
Hier stellt sich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit – und diese muss politisch gelöst werden. Aber bitte nicht dadurch, dass man nun rechtsgerichteten Populisten hinterherrennt!
Kapitel 2
Mögliche Anlageinstrumente
Anleihen
Doch kommen wir nun zur Frage, wie Sie sich finanziell aufstellen können, ja sollten, um – unabhängig von echten oder vermeintlichen Krisen – Ihren Lebensabend erfreulich gestalten zu können. Beginnen wir mit Anleihen. Sie werden von Staaten, Banken oder Unternehmen ausgegeben. Wenn ich eine Anleihe kaufe, bin ich der Gläubiger und der Ausgeber der Anleihe ist mein Schuldner. Er verspricht mir, bis zum Ende der Laufzeit der Anleihe jährlich einen vereinbarten Zins zu zahlen und am Ende die volle Summe zurückzuerstatten. Da Anleihen einen festen Zins bieten, spricht man dabei auch von „festverzinslichen Wertpapieren“. Früher nannte man sie auch „Rentenpapiere“, weil sie sozusagen als zusätzliche Rente dienten.
Der Vorteil von Anleihen ist, dass sie an der Börse täglich gehandelt werden. Damit kann man sie dort jederzeit zu einem „Kurswert“ kaufen und verkaufen. Die Börsenumsätze sind groß genug, man findet auch für sechsstellige Beträge immer einen Käufer oder Verkäufer.
Wie hoch der Kurswert der Anleihe ist, hängt von der Restlaufzeit und den momentanen Zinsbewegungen ab.
Ein Beispiel: Im Februar 2016 wurde unter anderem eine neue Bundesanleihe (WKN 110239) zum Kurs 100 und mit einem Zinssatz von 0,5 Prozent für die folgenden zehn Jahre herausgegeben. Damals waren die Zinsen für deutsche Bundesanleihen wegen mangelnder Nachfrage sehr weit gefallen. Wer trotzdem noch unbedingt Bundesanleihen kaufen wollte, musste sich mit so einem geringen jährlichen Zins zufriedengeben. Mittlerweile sind die Zinsen gestiegen, daher ist der Kurs der Anleihe entsprechend gefallen, weil die Rendite 0,5 Prozent ja festgeschrieben ist. Läuft so eine Anleihe noch mehrere Jahre und steigen die Zinsen für neue Anleihen weiter, dann können die Kursverluste schon erheblich sein. Die Auszahlung erfolgt aber pünktlich zum Laufzeitende zum vollen Nennwert (bei der genannten Anleihe im Februar 2026 zum Kurs 100).
Die Ausschüttung ist etwas anders geregelt als bei Aktien. Bei Aktien gibt es an einem bestimmten Tag nach der Hauptversammlung eine Dividende, danach fällt der Kurs der Aktie etwa um die Höhe des Dividendenbetrags. Die Aktie wird nun „ex Dividende“ notiert, das heißt, neue Käufer erhalten diese Dividende nicht mehr.
Bei Anleihen gilt aber eine andere Regelung: Der Käufer bezahlt beim Kauf der Anleihe die Zinsen für die Zeit mit, die seit der letzten Ausschüttung vergangen ist. Diese Zinsen nennt man Stückzinsen. Dafür erhält er aber am Tag der Ausschüttung den vollen Zinssatz für zwölf Monate, auch wenn er die Anleihe erst vor kurzer Zeit gekauft hat. Die Ausschüttung verändert den Kurswert der Anleihe also nicht. Wenn er die Anleihe vorzeitig verkauft, bekommt er auch die Stückzinsen gutgeschrieben, die seit der letzten Ausschüttung angefallen sind.
Der Zins darf nicht mit der „Rendite“ der Anleihe verwechselt werden. Wenn Sie zum Beispiel drei Prozent Zinsen auf Ihre Anleihe jährlich garantiert bekommen, aber der Kurswert der Anleihe 105 beträgt, dann liegt die Rendite nicht bei drei Prozent, sondern weniger, weil die Rückzahlung zum Laufzeitende ja nur zum Kurs 100 erfolgt.
Beim Kauf einer Anleihe geben Sie nicht die Stückzahl an, die Sie kaufen wollen, sondern den Gesamtbetrag im „Nennwert“, der dann bei Fälligkeit ausbezahlt wird, also zum Beispiel 40.000 Euro, die Sie anlegen wollen.
Aktien, Anleihen oder Festgeld?
Aktien sind riskanter als Anleihen, weil sie von der Ertragskraft der betreffenden Unternehmen abhängig sind. Läuft es für ein Unternehmen gut, winken aber auch Kursgewinne, die mit Anleihen nicht zu erreichen sind. Vorsichtige Anleger werden daher in der Regel zum Teil in Aktien, zum Teil in Anleihen engagiert sein.
Für einen 77-jährigen Rentner kann dies zum Beispiel bedeuten, dass er 30 Prozent Aktien in seinem Depot als Höchstanteil ansieht. Es darf aber auch mehr sein. Für ihn wären 80 Prozent auch noch möglich, wenn er den Markt gut beobachtet.
Im Grunde müssen alle, die Geld anlegen, selbst wissen, wie hoch sie den Aktienanteil in ihrem Depot setzen. Dabei kommt es auf das Lebensalter und die Risikobereitschaft an. Wenn Sie sich zum Beispiel entschieden haben, 80 Prozent Aktien im Depot zu halten und nur 20 Prozent Liquidität, dann bleiben Sie im Prinzip auch dabei, solange es keine Verkaufssignale für Aktien gibt. Wir werden Verkaufssignale noch besprechen.
Die Frage, ob der Aktienanteil im Depot zu hoch ist, lässt sich mit einer simplen Faustregel beantworten: Solange man gut schlafen kann und nicht die ganze Woche über vor dem Fernseher die Börsennachrichten verfolgt, ist der Aktienanteil nicht zu hoch.
Wenn die Aktien schon ein bis zwei Jahre kräftig gestiegen sind, sind jederzeit Kurskorrekturen möglich. Dann sollten Sie grundsätzlich nur solide, unterbewertete Aktien kaufen. Meiden Sie hingegen Aktien mit sehr hoher Bewertung, selbst wenn man ihnen noch so hohes Wachstum nachsagt. Woran Sie hoch bewertete Aktien erkennen? Auch dazu später mehr.
Was den Aktienmarkt beflügelt, ist vor allem das Streben der Anleger nach Rendite. Diese können sichere Anleihen nicht immer bieten. Dafür sind die Zinsen noch zu niedrig. Sie liegen bei deutschen Bundesanleihen derzeit nur bei rund zwei bis drei Prozent. Festgeld bringt oft etwas mehr. Aber für Anleger mit mehr als 100.000 Euro ist es doch ein gewisses Risiko, das Geldvermögen nur einer einzigen Bank anzuvertrauen. Bis zu 100.000 Euro können Sie gut und gern bei Ihrer Hausbank als Tagesgeld parken, wenn die Rendite stimmt. Das ist natürlich bequemer und zudem gebührenfrei.
Für Anleihebesitzer ist die Inflation das größte Risiko. Ist sie sehr hoch, bekommt man zwar am Laufzeitende den Betrag im „Nennwert“ zurück, aber das Geld ist dann nicht mehr so viel wert wie zum Zeitpunkt des Kaufs. Außerdem sinkt bei Zinssteigerungen der Kurswert der Anleihe, die man bereits besitzt, und man muss beim vorzeitigen Verkauf an der Börse mit Kursverlusten leben.
Auch Unternehmensanleihen bieten sehr oft eine höhere Rendite. Aber was ist, wenn das Unternehmen in Konkurs geht? Man kauft doch Anleihen statt Aktien, um solche Risiken zu vermeiden! Wenn ich Anleihen kaufe, dann in der Regel nur Bundesanleihen, bei denen der Staat selbst die Rückzahlung garantiert.