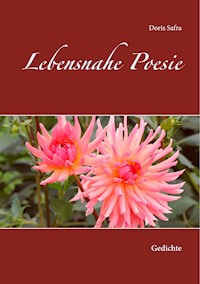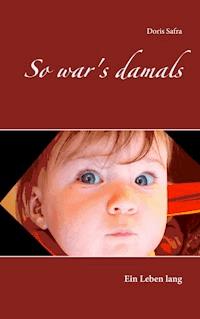
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Lebensbericht der Augenärztin Doris Safra ist in einer pointenreichen, bildhaften Sprache geschrieben, die den Leser fasziniert und ihm auch einen Einblick verschafft in die Verhältnisse im jungen Israel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Eine kleine Einleitung
Ein Leben lang
Im Weltkrieg
Werdegang einer Augenärztin
Leben im jungen Israel
Eine kleine Einleitung
Vor etwa 20 Jahren begann ich meine Erinnerungen aufzuschreiben. Irgendwie fühlte ich mich gedrängt dazu, sogar verpflichtet, Längstvergessenes wieder heraufzuholen, um es nicht verloren gehen zu lassen. Zwar beschrieb ich mein persönliches Erleben, aber gleichzeitig informieren meine Aufzeichnungen über die damaligen Ereignisse und gewähren Einblick in die Lebensweise und Mentalität dieser Zeit.
Als erstes schrieb ich über den Krieg, den ich als heranwachsendes Mädchen sozusagen als Zeitzeugin erlebte.
Später erzählte ich von meiner Jugend vom Moment meiner Geburt an, (Ein Leben lang) zu einem grossen Teil den Erzählungen meiner Mutter und Tanten folgend. Ein weiterer Bericht (Werdegang einer Augenärztin) wurde im Opthalmologischen Monatsmagazin Ophta veröffentlicht. Schliesslich beschrieb ich die Jahre in Israel, (Leben im jungen Israel), wo ich, beginnend kurz nach der Staatsgründung, über 20 Jahre lebte.
Zum Teil überschneiden sich die Berichte, vor allem Werdegang einer Augenärztin und Leben im jungen Israel. Ich habe es so belassen, denn die sich überschneidenden Berichte erscheinen in einem verschiedenen Kontext.
Ein Leben lang
Sechsunddreissig
Das Licht der Welt, das ich zuerst erblickte, waren die Glühlampen des Gebärsaals im Frauenspital in Bern.
Es war an einem Freitag vor Sabbath-Eingang, bei Neumond, am ersten Tag des jüdischen Monats Elul, und ich erhielt die Nummer Sechsunddreissig um das Handgelenk gebunden. All das deutete Mama als günstige Vorzeichen für mein Leben.
Elul ist der Monat vor dem Neujahr, da nach dem jüdischen Glauben im Himmel über das Schicksal des Menschen im kommenden Jahr entschieden und ins himmlische Buch eingeschrieben wird. Dabei bereitet sich der Mensch auf den Versöhnungstag nach Neujahr vor, da er Gott und seine Mitmenschen um Verzeihung bittet und selber verzeihen will.
An der Zahl sechsunddreissig haftete für Mama etwas Mystisches an. Es war eine Art heilige Zahl für sie. Sechsunddreissig ist zwei Mal achtzehn und achtzehn in hebräischen Lettern geschrieben bedeutet „lebend“. Also stand mir ein langes Leben bevor. Ausserdem stehe die Welt auf sechsunddreissig Gerechten, heisst es in den talmudischen Schriften; auch wenn die ganze Welt voller Sünder ist, wird sie Gott erretten, wenn noch sechsunddreissig Gerechte übrig geblieben sind. 36 heisst auf hebräisch Lamedwaw, ein Gerechter wird im Volksmund Lamedwawnik genannt.
Mama starb nach einem Verkehrsunfall in ihrem einundsiebzigsten Lebensjahr. Sie wurde in Jerusalem auf dem Friedhofabteil Lamedwaw begraben.
Erste Bekanntschaften
Mama musste sich vor der Geburt gefürchtet haben, so dass sie in der teuren Privatabteilung gebären wollte, obschon meine Eltern arm waren und es sich schlecht leisten konnten. Geburtshelfer war Prof.Guggisberg, was mir fünfundzwanzig Jahre später eine Vier in Geburtshilfe beim Staatsexamen einbrachte. Die Note war ungerecht und verunzierte mein sonst mit Fünfern und Sechsern ausgestattetes Zeugnis. Bis heute verstehe ich nicht, warum er mich nach der ersten Prüfung, bei welcher er mir eine Sechs gegeben hatte, fragte, wo ich geboren sei und warum sich sein Gesicht verdüsterte, als ich in reinem Berndeutsch prompt antwortete:“ Bei Ihnen, Herr Professor. Hatte er etwas gegen Frauen, die Medizin studieren und im dritten Schwangerschaftsmonat Staatsexamen ablegen? Und hätte er mir verziehen, wenn ich irgendwo anders, etwa in Italien oder in einem Land des Nahen Ostens geboren wäre? Er war auch im Alter noch ein gut aussehender Mann, mit seinem schlohweissen Haar auf dem typischen runden Berner Schädel und der fein geschnittenen Nase Er hatte etwas von einem Grandseigneur des 19. Jahrhunderts an sich, wenn er in der Tracht der Chirurgen seiner Zeit, dem schneeweissen Anzug und den schwarzen Pumpsschuhen, gefolgt von einem ehrfürchtigen Schwanz von Oberarzt und Assistenten den Hörsaal betrat.
Es war sein letztes Lehrsemester, das letzte Examen, das er abnahm, und ich eine seiner letzten Studentinnen - und er meine erste Bekanntschaft.
Meine zweite Bekanntschaft war Mamas Freundin Ida, mit zwei oder drei Monaten. Die Hebamme hatte mich in ihre Arme gelegt. Die Neugier war angeboren. Kaum hatte sie mich aus der Wärme ihres Bauches herausgepresst, so erzählte Mama, öffnete ich die Augen und sah mich neugierig im Gebärsaal um, anstatt Idas verzückte „Schätzeli, Mutzeli, Butzeli“ zu würdigen und ignorierte sie arrogant.. Was mir Ida scheinbar nie verzieh.
Während meiner ganzen Kindheit bedachte sie mich mit höhnischen Bemerkungen und Kritteleien. Eigentlich war das gar nichts Aussergewöhnliches in der damaligen Zeit. Viele Erwachsene zeigten ihre Sympathie für Kinder, indem sie sich über sie lustig machten. Kinder durften nicht beleidigt sein, und wenn schon, dann war es eben gut für die Erziehung. Vor allem Männer manifestierten ihre Kinderliebe gerne mit einem kräftigen Kniff in die Backe. Noch heute bedaure ich, dass mein kleiner Fuss so einem Kneifer nicht kräftig ins Schienbein getreten hat. Aber man wurde eben gelehrt, dass alles was Erwachsene tun, gut und heilig und von Gott abgesegnet sei und ein Kind zu schweigen hatte, auch wenn die Backe ordentlich weh tat.
An Ida erinnere ich mich als eine hübsche, schwarzhaarige Frau von gedrungener Gestalt mit einem mächtigen, zu einem ansehnlichen Hochplateau zusammengeschnürten Busen. Ihre einzige grosse Liebe im Leben hatte sie mit „Holde Aida.!“ besungen: Doch war nichts daraus geworden, weil sich angeblich mein Onkel Josef, über den romantischen Liebhaber lustig gemacht hatte. Kein Wunder, dass Ida ihn dafür ihr Lebtag lang hasste. Ida führte eine kleine Pension mit Mittagstisch. Sie kochte vorzüglich, ihre Hühnersuppe war eine Legende. Doch als Ida einmal ironisch bemerkte. “Doris liebt Idas Suppe, aber Ida selbst hat sie nicht gerne“, weigerte ich mich fortan davon zu essen.
In jüngeren Jahren war Ida Gouvernante bei einer englischen Familie gewesen. Gerne zitierte sie Aussprüche ihrer früheren Arbeitgeber auf Englisch. Mama, ein aussergewöhnliches Sprachtalent, das deutsch und französisch perfekt und akzentfrei und italienisch recht gut sprach, wollte von Ida auch englisch lernen. Sie sprach ihr englische Wörter nach und versuchte ihren Akzent nachzuahmen. Mich erinnerte dieses Englisch ein wenig an das Miauen einer Katze, und bis ich nicht selber im Gymnasium englisch lernte, war ich überzeugt, dass das Wort „yes“. etwa wie „jeeaahs“ gesungen werden musste.
Mit Mama und Papa ca. 4jährig. Die Kleidermode kehrt immer nach einigen Jahren zurück.
Geburtstag
An meinem dritten Geburtstag erhielt ich drei Geschenke. Offenbar konnte ich damals auf drei zählen, denn ich nahm an, dass die Anzahl der Geschenke mit den Geburtstagsjahren übereinstimme.
Die drei Geschenke bestanden aus einem Paar brauner Halbschuhe mit Schnürsenkeln, einem Springseil und einer Ente aus Zelluloid. An den Schuhen fesselten mich die Schnürsenkel und ich machte mich gleich an ihnen zu schaffen, sonst waren sie nicht nach meinem Geschmack. Mit dem Springseil konnte ich nicht viel anfangen, es war viel zu lang und passte für Mama, die mir vormachte, wie man damit springt. Aber was soll’s! Es waren Geschenke und Geschenke waren etwas ganz Wunderbares, Gegenstände, die mir und nur mir gehörten – mindestens solange, bis sie auf unerklärliche Weise verschwanden.
Die Zelluloidente sah genau so aus wie die kleine Ente im Bilderbuch, aus welchem mir Papa vorlas. Sie war weiss, sie hatte einen grün-blauen Kopf und einen gelben Schnabel und wurde wohl zum liebsten Spielzeug, das ich je besass. Ich identifizierte mich mit ihr, ihre Farben wurden meine Lieblingsfarben. Eine kleine Ente wurde mein Signet, mit welchem ich bis zum Erwachsenenalter meine
privaten Briefe unterschrieb.
Karoline Gygax und andere Puppen
Meine erste Puppe hatte kein Gesicht und keine Kleider. Sie war aus einem gräulichen Stoff gefertigt und schlenkerte die angenähten Arme und Beine, wenn man sie bewegte. Ich wickelte eine Schnur um ihren schmuddeligen Leib. Man fragte mich, warum ich die Puppe fessle. „Ich fessle sie nicht, das ist ein Verband, weil sie krank ist.“, erklärte ich.
Meine zweite Puppe schenkte mir Onkel Fritz und gab ihr gleich einen Namen: Karoline Gygax. Onkel Fritz hatte eine Vorliebe für besondere Namen und Zahlen. So nannte er seinen Foxterrier „Gabelfrühstück“, die Hausnummer seiner Villa in Tetschen – Bodenbach musste die Nummer 1003 tragen, wie die Anzahl der Liebesabenteuer des Don Giovanni. Karoline Gygax hatte ein hübsches buntes Kleidchen und Schuhe aus schwarzem glänzenden Wachstuch. Irgendwie hatte ich keine besonders warme Beziehung zu dieser Puppe. Vielmehr liebte ich das Zelluloidbaby, das mir unsere Zimmeruntermieterin, Frau Paratte, an Weihnachten schenkte. Es erweckte meine ersten mütterlichen Instinkte. Ich wickelte es in ein Tuch, wärmte es unter der Bettdecke, wiegte es in den Armen und redete zärtlich mit ihm.
Onkel Fritz
Onkel Fritz war ein Glücksfall in meinem Leben. Mamas Schwester, Rosi, hatte ihn auf einem Zionistenkongress in Zürich kennen gelernt, wo er als Kongressrichter amtierte. Nach ein paar Tagen hatten sie sich verlobt, und er hatte darauf bestanden, gleich zu heiraten, um seine junge Frau mit nach Hause in die Tschechoslowakei mitzunehmen. Die Hochzeit wurde eiligst vorbereitet und fand bei uns im Wohnzimmer statt. Tante Rosi, die Braut, nähte ein Festkleidchen für mich. Das war rosa mit einem oberen Teil aus Georgette, mit einem girlandenförmigen Saum und einem unteren Teil aus Satin. Der Prediger der jüdischen Kultusgemeinde in Bern, Herr Messinger, vollzog die Trauung und gab Mama, die am Klavier sass, stumme Anweisungen mit seinem Kopf, wann sie spielen sollte.
Grossmutter war überglücklich mit diesem Schwiegersohn. Deborah, wie sie von nun an mit ihrem richtigen Namen genannt wurde, war die hübscheste ihrer vier Töchter und ihr Liebling. Dr.jur. Friedrich Eckstein, wie auf seiner Visitenkarte stand, war ganz nach ihrem Geschmack. Er war zwar achtzehn Jahre älter als ihre Tochter, aber weltmännisch und hoch gebildet und sprach sieben Sprachen. Aus Briefen, die ich fand und Fotografien im Familienalbum weiss ich, dass er mit einigen Schriftstellern der damaligen Zeit befreundet war, wie Ilja Ehrenburg und Josef Kastein. Ein Schulfreund von ihm, dessen Namen ich vergessen habe, schrieb unter anderen ein Buch mit Tiergeschichten, das mir Onkel Fritz schenkte. Da Fritz in Wien und Prag studiert hatte, müsste er eigentlich auch Franz Kafka gekannt haben.
Mein allererstes Kinderbuch hatte ich von Papa erhalten, aber alle andern Bücher schenkte mir Onkel Fritz. Eines handelte von einem Hund mit Namen „Bonzo“. Grossmutter Frieda musste mir immer wieder daraus vorlesen, bis ich alle Kapitel auswendig konnte. Dann suchte ich mir die Wörter zusammen und brachte mir auf diese Weise das Lesen bei.
Onkel Fritz und Tante Deborah kamen nun Jahr für Jahr zu den zionistischen Kongressen. Einmal wurde ich an einen Kongress mitgenommen, ich glaube er fand in Zürich statt. Ich war etwa sechs oder sieben Jahre alt Fritz sagte zu mir: „Du wirst jetzt berühmte Leute kennen lernen, an die du dich dein ganzes Leben lang erinnern wirst.“
Links, ca. 6jährig mit einem Nachbarskind
Was mich an der Sache am meisten interessierte, war die Fahrt mit dem Zug. Den Kongress fand ich langweilig und vor allem anstrengend, es fiel mir schwer, so lange ruhig dazusitzen. Man hatte mich genau hinter den Redner Chaim Weizmann, den Präsidenten des jüdischen Weltkongresses, gesetzt. Ich sah seinen Rücken und seine Bewegungen und verstand natürlich kein Wort, von dem er sprach. Ich erinnere mich, dass er einen blauen Anzug trug, in meiner Lieblingsfarbe und an seinen Kopf mit dem Haarkranz um seine Glatze. Am Ende wurde ich ihm und andern berühmten Leuten von Onkel Fritz vorgestellt. Ich erinnere mich an die Namen Ussischkin, Sokolow, Gronemann.
Grossmutters Meinung über Onkel Fritz, von dem sie so begeistert gewesen war, änderte sich vollkommen, als er l938 mit nur einem Wäschesack, das einzige, das er aus seiner grossen Villa mitgenommen hatte, aus der Tschechoslowakei zu uns in die Schweiz flüchtete. Er wurde für sie zum lebensuntüchtigen Versager, seine lustigen Einfälle, die sie vorher so charmant gefunden hatte, zu kindischer Spielerei. Fortan hassten sie einander gegenseitig.
Im Wäschesack befand sich unter anderem eine ganze Literatur über Nostradamus. Fritz war damals mit einer Studie über diesen Seher des Mittelalters beschäftigt, und so schienen ihm diese Bücher vielleicht das Wertvollste, das er aus seiner riesigen Bibliothek auswählte um es zu retten.
Während der Flucht starb sein und Deborahs einziges Kind, Gideon, ein aussergewöhnlich schöner und gescheiter Junge. Ich sah wie Fritz weinte und ich hörte ihn klagen: „Du böser Gott! Was hat dir dieses Kind getan? Was haben wir getan, dass Du uns dieses Kind nehmen musstest?“ Deborah und er wanderten nach Palästina aus. Der Name Eckstein wurde zum Andenken an den verstorbenen Sohn in Gideoni geändert. 1940 wurde ihnen Michael geboren. Ussischkin war der Gevatter bei der Beschneidung.
Der erste Schultag, ein zurückgebliebenes Kind
Am ersten Schultag bat Mama die Lehrerin, Frau Leist, um ein Gespräch, nachdem die andern Kinder nach der Begrüssung mit ihren Müttern nach Hause gegangen waren. Während ich mich am Fenster mit dem langen Stock, mit welchem man die Oberlichter öffnete, beschäftigte und ihn prompt herunterwarf, bat Mama Frau Leist, Geduld mit mir zu haben. „Andere Kinder in ihrem Alter können Gedichtlein aufsagen, Liedchen singen. Aber Doris kann so was gar nicht. Sie ist in dieser Beziehung halt ein wenig zurückgeblieben“, hörte ich sie sagen. Frau Leist versprach Mama, Geduld mit mir zu haben. Allerdings wunderte sie sich, dass ich als Zurückgebliebenes bereits fliessend lesen konnte.
Die erste Schulreise und die zerstörte Illusion
Auf der ersten Schulreise erlebte ich eine herbe Demütigung und eine zerstörte Illusion. Es war ein strahlend schöner Sommertag und alle Kinder waren gutgelaunt und fröhlich. Verzückt schaute ich zum blauen Himmel empor, wo ich einen kleinen Vogelschwarm entdeckte. „Seht doch die herzigen Schwälbeli!“, rief ich begeistert. „Ja, was ächt“, wies mich Frau Leist zurecht. “Das sind doch Krähen!“ Ich fühlte mich gedemütigt und schwieg beschämt.
Frau Leist führte uns durch den Wald nach Köniz. „So, jetzt sind wir nicht mehr in Bern!“, verkündete sie. Nicht mehr in Bern? Also hatten wir die grosse Welt betreten? Ich war begeistert. „Kommt, wir gehen immer weiter“, sagte ich zu den andern Kindern. „Wenn wir immer weiter gehen, da kommen wir nach Afrika!“ Ich hatte das Buch von „Doktor Doolittle und seine Tiere„ gelesen und wünschte mir so sehr, dem Doktor und seinen Affen in Afrika zu begegnen.
Frau Leist machte meinem Traum ein Ende, als wir den Heimweg antreten mussten.
Die Lüge
Zwei Dinge wurden mir von klein auf eingebläut: Man muss sich zusammen nehmen und man darf nicht lügen. Was die Lüge betraf, wurde auch Ungenauigkeit beim Erzählen dazu gezählt. Die erste Lüge, wofür ich bestraft wurde, gab mir als Erwachsene – wir leben im Zeitalter, da Psychologie zur populären Wissenschaft geworden ist - oft zu denken.
In unserer Klasse war ein Kind namens Henni, ein blondgelocktes, hübsches und von allen bewundertes Mädchen, da um sie eine Art Aura von Reichtum und Vornehmheit schwebte. Ihr Vater war Oberst als Berufsoffizier, sie wohnte mit ihren Eltern in einer vornehmen Villa, sie war schöner gekleidet als die andern Kinder, die meistens aus armen Verhältnissen stammten, und ihre Mutter kam von zeit zu zeit mit einem Sack voll Süssigkeiten in die Klasse, die sie Bank für Bank austeilte.
An einem Samstag Nachmittag wurde ich zu Henni eingeladen. Als ich nach Hause kam, wurde ich ausgefragt, wie es so aussehe in der schönen Villa. Alles sei herrlich, grossartig, wunderbar! Und wie war das Badezimmer? Herrlich, grossartig, wunderbar! Warst du im Badezimmer? Nachdenken…Nein, im Badezimmer war ich nicht…Eine saftige Ohrfeige von Papa. „Du hast also gelogen! Hast behauptet, das Badezimmer sei schön gewesen und hast es gar nicht gesehen!