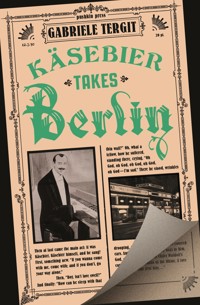22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Noch einmal einen großen Roman schreiben - das war, nach den "Effingers", Gabriele Tergits größter Wunsch.Dieser Roman "So war"s eben", der jetzt erstmals aus dem Nachlass der Autorin erscheint, erzählt das Durchschnittsleben von reichen und bescheidenen Familien in der Zeit von 1898 bis in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Während die Geschicke der Familien ihren Lauf nehmen, tobt der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik mit ihren Wirrnissen und Kämpfen zwischen Rechten und Linken findet ihren Widerhall in den Zeitungsredaktionen, dem Milieu von Gabriele Tergits Zeit als Journalistin. Nach einer Familienfeier am 30. Januar 1933, die fast alle Figuren des Romans versammelt, beginnt die Emigration nach Prag und Paris, später nach London und in die USA; erzählt wird von den immer größeren Problemen der Emigranten und der zurückgebliebenen Juden, den Selbstmorden, Deportationen und der Vernichtung einer Mischehe.Gabriele Tergit wollte das Leben ihrer Generation, mit allen Hoffnungen, Enttäuschungen und Lebensbrüchen schildern, "unsere ganze blödsinnige Welt von 1932" wollte sie einfangen, die Generationen von Vertriebenen, bis hin zu den jüdischen Flüchtlingen in New York, die Grete, Tergits Alter Ego, Anfang der fünfziger Jahre besucht."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 828
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
ERSTER TEIL: KAISERREICH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
ZWEITER TEIL: KRIEG
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
DRITTER TEIL: WEIMARER REPUBLIK
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
VIERTER TEIL: DRITTES REICH
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
FÜNFTER TEIL: NACHKRIEG
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Nicole Henneberg
DRAMATIS PERSONAE I
DRAMATIS PERSONAE II
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
So war’s eben
ERSTER TEIL KAISERREICH
1. Kapitel
Damentee in den neunziger Jahren
Stern, kugelig, im hellen Gehrock mit breiten Seidenrevers, Krawatte, die den Rockausschnitt füllte, Rose im Knopfloch, Zylinder nach hinten, stürmte ins Wohnzimmer, ließ die Tür offen, rief: »Eine runde halbe Million verdient!«
Franziska schloß rasch die Tür, das fehlte noch, das mit der halben Million vor den Dienstmädchen.
»Dein lieber Bruder, seine Hochwürden Rechtsanwalt Kollmann, fand jede Anlage unsicher. ›Industrie?‹ ›Schon schlecht‹. ›Elektrizität?‹ ›Haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wir kaufen für unsere Klienten nur preußische Konsols.‹«
»Du kannst mir nicht die Solidität meiner Familie vorwerfen.«
»Festverzinsliche Werte! Der geförderte Rückschritt und der verhinderte Fortschritt. Ein ganz ordinärer übelbeleumdeter Winkelbankier hat mir die Aktien besorgt.«
»Bitte setze deinen Hut im Zimmer ab!«
»Nicht fein genug? Mit ’ner halben Million werde ich allen fein genug sein. Wir bauen ein Palais in der Tiergartenstraße.«
Franziska, die geborene Kollmann, kannte sich in Geschäften aus: »Ein Palais in der Tiergartenstraße kostet mindestens 300000 Mark, da bleibt uns nicht genug zum Leben.« Ein Phantast war ihr Mann. Ihr Vater und Bruder hatten recht.
»Diese schäbige Wohnung wird auf alle Fälle gekündigt!«
Franziska saß in der neuen Wohnung – Füße auf einer gestickten Fußbank, Fußbank auf einem Tigerfell, Tigerfell auf einem Perser – auf einem Sofa mit Umbau, auf dem Vasen, ein bronzener Schmied, der Dornauszieher, ein radschlagender ausgestopfter Pfau und die Türme des Kölner Doms in Alabaster standen. Die Bibel mit Illustrationen von Doré, ›Unser Bismarck‹ und ›Unser Rhein‹ lagen auf der Samtdecke.
Im Esszimmer war für Franziskas ersten Damentee gedeckt, gekreuzte Silberbestecke auf Servietten mit Fransen, Teegläser in kupfernen Haltern mit Löffeln darin, um sie vor dem Platzen zu bewahren, Platten kunstvoll belegter Brötchen, Sahnebaisertorte.
Franziska klingelte, wies das Hausmädchen an, die braunen Samtgardinen vorzuziehen und die Petroleumlampen anzuzünden. Dieser Damentee war wichtig, sollte ihr und ihrem Mann das Markussche Haus öffnen.
Tatsächlich kam Adelina Markus als Erste, ein Modebild im weißbekurbelten grünen Kleid mit dreifacher Pelerine, jede mit Nerz eingefaßt, dazu ein Brüsseler Spitzenjabot, eine blonde zierliche Schönheit mit strahlend blauen Augen und Gemmenprofil. Der Hofphotograph stellte ihr vergrößertes und angemaltes Photo seit Jahren in seinem Schaukasten in der Leipzigerstraße aus – das Photo einer Wiener Komtesse, dachten die Betrachter –, darunter hing das aquarellierte Photo ihrer drei Kinder, der Junge in der Uniform der neuen kaiserlichen Marine und die zwei engelhaften kleinen Mädchen. Adelina Markus hatte die Jüngere Friedericke genannt, obwohl ihr Ideal Frau von Stein und nicht Friederike von Sesenheim war, die sich womöglich mit Goethe eingelassen hatte, und die Ältere Leonore, obwohl ihr Wagner näherstand als Beethoven. Aber man konnte ein Mädchen nicht Brunhilde oder Sieglinde nennen.
Dann trat Marie Kollmann, Franziskas Schwägerin, ein, mausig und missvergnügt in einem schlecht sitzenden Kleid: »Ich wäre fast nicht gekommen. Meine Köchin ist krank, jetzt in der Saison, eine Katastrophe.«
»Kann ich dir etwas besorgen?« sagte Franziska.
Das neue Hausmädchen, schwarzes Kleid, weißes Häubchen, servierte schlecht.
»Schwer, gute Mädchen zu bekommen«, seufzte Marie Kollmann.
»Diese Berliner Hängeböden für die Mädeln sind aber auch a Schand! Eine Leiter müssens aufstellen wie für an Heuboden«, sagte Adelina.
»Sie vergessen, was man für ein Gesindel ins Haus bekommen kann«, sagte Marie Kollmann.
»Neben uns wohnt eine adelige Offiziersfamilie. Die Mädchen schlafen auf dem Hängeboden, bekommen nicht satt zu essen und sind stolz, daß sie bei einem adeligen Offizier dienen«, sagte Franziska.
»Es ist schon ein Problem«, sagte Adelina, »ich hab ein ganz reizendes Kindermädl, und als ich eines Abends nach Haus komm, sind die Kinder nicht da, sind mein Mann und ich suchen gegangen, und stellen Sie sich den Zufall vor, am Potsdamerplatz kommens ausm Häusl, und die Toilettenfrau hat uns gestanden, daß die Kinder sechs Wochen lang jeden Tag für ein paar Pfennig bei ihr abgegeben wurden …«
»Haben Sie sie gleich rausgeschmissen?« fragte Marie Kollmann.
»Nein, es ist ein ordentliches Mädchen. Die Kinder sind wie aus dem Ei gepellt. Nur läßt sie halt dem Buberl jeden Willen, räumt ihm jedes Stück nach: ›Reicher Kind braucht nicht aufräumen‹, sagt sie. Sie ist eine Polin, findet es fein, wenn man keine Hand rührt.«
Inzwischen war auch Roserl Mayer, Frau eines Amtsrichters aus Kragsheim, gekommen, ihr Gretel blieb im Kinderzimmer.
Die vier Damen langten zu. »Nehmen Sie noch ein Stück Torte«, sagte Franziska zu Adelina.
»Ich sollt wirklich. Mein Mann möcht, daß ich dies Jahr wieder eine Mastkur mach, aber es ist halt so fad beim Beringer. Ich könnts schließlich zu Haus machen. Man soll halt drei Liter Milch im Tag trinken.«
Marie sagte bitter: »Ja, eine wirklich üppige Frau ist etwas Schönes. Ich wiege auch zu wenig …«
»Fett unter die Häut’ macht schöne Leut’«, sagte Adelina und dachte, das wüschte dürre Gstell.
Roserl Mayer sagte bewundernd zu Adelina: »Ich hab fei noch nie so eine phantastische Promenadentoilette gesehen. Ich bin aus Gunzenhausen.«
»Ach dieser alte Schlafuzel. Er war von Paquin, aber die Ärmel sind halt viel zu klein für die heutige Mode.«
»Paquin? Paris?« stammelte Roserl Mayer.
Ein Pariser Modell kommt ihr ja wirklich nicht zu, dachte Marie. Diese Äußerlichkeit, die jetzt einriß, empörte sie: »Mir genügt meine Hausschneiderin. Sie sind aus Wien?«
»Aus München. Hausschneiderinnen sind oft Pfuscherinnen, zerschneiden einem das gute Material. Das ist eine falsch angebrachte Sparsamkeit.«
»Paquin«, sagte Roserl träumerisch, »ich würde mich gar nicht trauen, in so ein Geschäft zu gehen.«
»Ich lasse im Modesalon Winkler arbeiten«, sagte Franziska.
»Modesalon? Frau Winkler ist eine gute Schneiderin«, sagte Marie Kollmann.
»Man nennt das jetzt Modesalon«, entschuldigte sich Franziska.
»Sie sollten ein Pariser Haus versuchen, halt eine andere Façon«, sagte Adelina.
»Halten Sie es für eleganter, Spitzen auf ein Abendkleid zu applizieren oder zu inkrustieren, mit Perlmutterpailletten bestickt?« fragte Franziska.
»Applizieren wirkt grob«, sagte Adelina.
»Wir sind hier für das Schlichte. Wir mögen das Aufgetakelte nicht«, sagte Marie.
Der preußische Snobismus der Schlichtheit, dachte Adelina.
Roserl verstand nichts. Ich bin halt ein Landskonfekt, dachte sie.
»Was macht die Musik?« fragte Franziska
»Ich spiel’ die Woch für die Ferienkolonien«, sagte Adelina.
»Man muß schon etwas für die armen Würmerln tun.«
»Würden Sie uns etwas vorspielen?« bat Franziska.
Dieses »vor« ging zwar Adelina auf die Nerven, aber sie ging an den Flügel, der voll Photographien stand. »Gestimmt?« fragte sie mißtrauisch.
»Natürlich«, sagte Franziska. Die Damen räumten den Flügel ab. Adelina warf den Rock um den Klavierstuhl, so daß man den Jupon sah. Ein Volant bestand aus grünem plissiertem Chiffon, in den schwarze Spitzenvierecke eingesetzt waren, von schwarzen Samtbändchen umgeben, der nächste Volant aus schwarzem plissiertem Chiffon mit grünen Spitzenvierecken, von grünen Samtbändchen umgeben. Sie spielte den »Feuerzauber«.
»Was für eine Ehre, solch gottbegnadete Künstlerin in unserm Kreis zu haben«, sagte Franziska.
Marie Kollmann dachte: Extravagant und aufgeputzt, dieser Jupon gehört sich ja wohl nicht.
Franziska kamen Bedenken. Sie hätte Adelina Markus nicht mit ihrer Schwägerin einladen sollen. Dieser wichtige Damentee schien zu verunglücken.
Adelina hielt den Rock hoch, so daß man wieder die schwarz-grüne Spirale sah.
Rudolf, Franziskas kleiner Sohn, schlank und ein wunderbares Mittelmeergesicht, stand in der Tür und wurde hereingerufen, um allen die Hand zu geben. »Was für ein schönes Buberl!« sagte Adelina.
Rudolf stürzte ins Kinderzimmer, zog die Tischdecke herunter, schwang sie um sich, hielt sie wie Adelinas Spirale. Der ältere Werner schüttelte den Kopf über diesen Quatsch, aber Grete Mayer versuchte das auch mit der Decke, verwickelte sich und brüllte.
Die Damen waren im Aufbruch, die Kinder quängelten, weil sie ihr Spiel unterbrechen mußten, als Stern eintrudelte: »Wessen prachtvolles Rappengespann habe ich denn da unten gesehn? Wohl Besuch vom Hofe? Ha, unsere liebe Schwägerin Marie, Gattin des Rechtsverdrehers Kollmann und Tochter des Kommerzienrates und Kronenordenbesitzers Kramer!« Er tätschelte Maries Backen und sagte zu Franziska: »So ein Rappengespann werden wir dir auch anschaffen. Was sagen Sie denn zu dem Brilliantring? Prachtvolles Feuer, was? Ein Karat! Wir lassen uns nicht lumpen!« Und hielt Franziskas Hand Adelina unter die Nase.
»Ich muß gehen«, sagte Adelina.
»Es schneit fürchterlich«, sagte Stern, »nicht warm genug bei uns? Warten Sie doch noch etwas!«
»Ich muß zu Hause sein, wenn mein Mann aus der Fabrik kommt«, dachte, ich geh bei den Jacobys vorbei, bissl ratschen.
»Ja, ja, der Herr Fabrikbesitzer Manfred von Markus. Da kann unsereiner nicht mit.«
Franziska war unglücklich. Was noch zu verderben war, hatte ihr Mann verdorben. Trotz dieser herrlichen Wohnung in der feinsten Gegend würden sie nicht eingeladen werden. Sie mußte schon froh sein, wenn es bei dem Nachmittagsverkehr blieb.
2. Kapitel
Amtsrichter Mayer
Die Damen verabschiedeten sich rasch. Die Luft war wie Champagner Der Schnee fiel dünn und hart. Ein ferner Schlitten klingelte. Zerlumpte Männer kehrten Schnee. Roserl bog in die Tiergartenstraße ein, sah durch das Schloßgitter den Renaissancebau tief im Garten mit der Granitschale davor. Licht fiel aus einem Fenster, jetzt wurde die Portiere vorgezogen. Kein Mensch war weit und breit. Die Laternen gaben wenig Licht. Roserl probierte Schleppe tragen, vorn hoch oder Rock ganz eng um sich ziehend ihn rechts zu heben oder Adelinas Spirale. Sie fühlte sich beobachtet, als ein Herr schon den Zylinder lüftete: »Gnädigste?«
Roserl, das Kind an der Hand, lief davon. Der Herr sagte: »Entzückend!« und klingelte an dem Renaissancebau.
Am Potsdamerplatz stieg sie in die Pferdebahn. »Kriegsministerium!« rief der Schaffner und klingelte ab. Roserl sah hinaus: Ehrecke Tee mit dem nickenden Chinesen, Postmuseum, Michelseiden im roten Steinhaus, Warenhaus Tietz, Weltkugel auf dem Dach. Ja, sie war im Mittelpunkt der Welt. »Polizeipräsidium«, rief der Schaffner, »Zentralmarkthalle«. Gericht und Kaiserschloß, Läden für Kaffee und Kohl und Bäckereien und Monatsgarderobe, Lastwagen, Kohlenkeller und Milchkeller.
Das hübsche klassizistische Haus, in dem sie wohnte, schien ihr schäbig. Die Stufen splitterten ab, dabei gab es eine noch schlechtere Hintertreppe. Sie schloß auf. Im Wohnzimmer, am Tisch unter der Hängelampe, las der Amtsrichter Zeitung.
»Ich bring erst s’ Kind ins Bett, Julius, dann komm ich.«
»Ich les hier, laß dir ruhig Zeit.«
Roserl deckte, brachte Brot, Butter, Leber- und Mettwurst: »Das war mal eine wunderbare Abwechslung. Ich habe nicht gewußt, daß die Sterns in solchem Stil leben, ein Perser über dem andern.«
Julius schmunzelte: »Du übertreibst, Roserl.«
»Du kannst es dir nicht vorstellen, die Türme vom Kölner Dom in Alabaster, ein ausgestopfter Pfau, eine künstliche Palme in einem Majolikatopf! Und die Aufwartung! Und wer alles da war! Adelina Markus wie eine junge Königinwitwe …«
»Wieso Witwe?«
»Ich quatsch ein bisserl, ich bin noch aufgeregt, Marie Kollmann, eine graue Maus, ohne Geld hätte die der brillante Rechtsanwalt nie geheiratet, und Adelina Markus spielte den ›Feuerzauber‹, wo sie sonst nur in Wohltätigkeitskonzerten spielt! Rührend, nicht? Und sie war angezogen! Ein völlig anderer Stil, von mir gar nicht zu reden, immer noch mit diesen Ballonärmeln.«
»Bist neidisch?«
»Vielleicht, weil sie schon in Paris war. Ich muß dir ihren Aufzug beschreiben, ein weißbekurbeltes grünes Kleid mit drei pelzbesetzten Pelerinen und ein plissierter Chiffonjupon, grüne Spitzenvierecke in Schwarz und schwarze Spitzenvierecke in Grün und jedes Spitzenviereck mit Samtbanderln eingefaßt; ganz Paris war in diesem Jupon.« Sie nahm Julius graue Baumwollstrümpfe zum Stopfen vor: »Du bist verstimmt?«
»Ich habe mir heute so eine Wohnung angesehen. Ein Handtuch von einem Zimmer für Eltern mit fünf Kindern. Alle hatten Ausschläge, Wasser von einem Ausguß auf der Treppe und der Abort im Hof.«
»Na, unsre Wohnung? Die Toilette lüftet ins Bad und s’ Bad in die Speis’ mit einem Fenster nach einem engen Hof. Glaubst du, daß an dem ›Umsturz‹ was dran ist?«
»Ein Umsturz kann nur zerstören. ›Wehe, wenn sie losgelassen.‹ Die Bauspekulation ist an vielem schuld, aber wie kann eine Näherin von 12 Mark in der Woche – und s’ Garn muß sie liefern – eine vernünftige Miete bezahlen? Dann nimmt sie Schlafburschen. Und dieser Unsinn, daß man nur das Geld der reichen Leute zu verteilen bräuchte! Käme auf jeden hundert Mark und wird in Schnaps angelegt. Und mit höheren Löhnen sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Die Industrie ist das Unglück. Wenn ich an Kragsheim denk!« »Sei doch froh, daß es uns gelungen ist, nach Berlin zu kommen. Was mit einer Tochter in dem Nest?«
»Nest? Es waren halt viel gesündere Verhältnisse, man war der Natur näher. Wie oft bin ich mit der Sabine über die Felder gegangen und habe mich an den blühenden Bäumen gefreut und an den Ebereschen im Herbst, und an den Winterabenden, wenn der Papa aus dem ›Gläsernen Himmel‹ kam, brannte überm Torbogen eine Laterne, jeder hat seine Ölfunzel in der Hand getragen, man hat sie heimgehen hören, und dann kam der Nachtwächter Ungeheuer …«
»Ungeheuer?« lachte Roserl.
»Netter Mann. Eine große Dummheit, nach Berlin zu streben. In Süddeutschland kann es unsereins zum Oberlandesgerichtsrat bringen. Hier kann ich als siebzigjähriger Amtsrichter sterben. Tja, die konservative Partei hat beschlossen, prinzipiell keine Juden mehr aufzunehmen, obwohl man nicht vergessen haben sollte, was der konservative Disraeli für England geleistet hat und daß Kaiser Friedrich den Antisemitismus die Schmach des Jahrhunderts genannt hat. Wir haben an den Fortschritt der Gleichberechtigung geglaubt, statt dessen will man hintenrum die Juden wieder ausschließen. Woran denkst denn, Roserl?«
»Ein Herr hat mich angesprochen, aber ich hab gemacht, daß ich davonkam.«
»Eine Frechheit, was sich die Herren heute erlauben.«
Sie wollte sagen, ein besonders gutaussehender Herr in einem langen Pelz mit Pelzrevers und mit einer langen Zigarre. Er hat ›entzückend‹ zu mir gesagt. Aber sie ließ es. Der Amtsrichter las die Zeitung, sie stopfte die Strümpfe.
3. Kapitel
Wie Julius Mayer Roserl heiratete
Julius hatte als Referendar Roserl auf dem Bahnhof in Gunzenhausen stehen sehen und sich verliebt. Die Eisenbahn hatte einen größeren Glanz als jedes spätere Verkehrsmittel, war man doch vom Pferd direkt auf die Eisenbahn gekommen. Der Bahnhof war Gesellschaft, Theater, Ball, Kino, fremdes Land, das Abenteuer. Jahrzehntelang gingen die Kleinstädterinnen auf den Bahnhof, wenn der tägliche Schnellzug durchkam, zum Beispiel der nach Wien durch Gunzenhausen, Feuchtwangen, Kolmberg und Kragsheim. Die Familientante Jeanette, Schannett, hatte schnell ausspioniert, wer das junge Mädchen auf dem Bahnhof war, und lud sie ein. Julius, seine verheiratete Schwester Sabine Gutmann, ihr Mann Max und sein Bruder David holten Roserl ab. Im Hofgarten war ’s Mon Plaisir, weiße Säulen, unter denen Kaffee zu trinken der großherzige Fürst erlaubt hatte. Sie saßen da, Roserl und Sabine in Musselintaillen, fein gekleidet für Handwerkerskinder, die jungen Männer im besten Anzug mit steifem Kragen. Julius verehrte Roserl, der sechzehnjährige David Gutmann sah in ihr die vollendete Schönheit, Roserl fragte: »Sie haben in München studiert? Ich möcht für mein Leben gern einmal in ein Theater gehen.«
»München ist eine leichtfertige Stadt. Es ist viel angenehmer im soliden Kragsheim«, sagte Julius.
»Das sagst du, aber ich bin bei einem Hopfenhändler in München in der Lehr, da ist viel Abwechslung. Die Leut’ sind alle in einem Verein, der ›Konkordia‹. Ich will sehen, daß sie mich aufnehmen«, sagte der junge David.
»Du machst deinen Weg, mein Max ist halt mit allem zufrieden«, sagte Sabine.
»Ich hab’ nur Näheres vom elektrischen Ball gehört, wenn die Damen auf einen Knopf gedrückt haben, ist ein Licht in ihrem Haar aufgeleuchtet.«
»Geh, was es alles gibt«, sagte Roserl.
»Es kommt im Leben auf andre Sachen als aufs Vergnügen an«, sagte Julius.
»Es wär schön, nach München zu gehen«, sagte Roserl.
Vergnügungssüchtig! Ob das eine Frau für mich ist? dachte Julius.
Der Weltmann David schlug die Aumühle vor. Sie wurden ganz still, als sie in den Wald kamen, der Duft, der weiche Boden, Sonnenflecke durchs Geäst. »Hier könnten wir Dritten abschlagen spielen, grad fünf Bäume«, sagte David.
Max Gutmann fand sich zu alt, ein verheirateter Mann, aber Julius und David überredeten ihn, denn was für eine Gelegenheit, Roserl vielleicht sogar am Arm zu fassen.
Auf dem Rückweg zur Bahn kamen auf dem heißen weiten Platz vor dem Schloß die Schwoleches (Cheveaux legers). »Mein Max hat fei dabei gedient«, sagte Sabine.
Was ich heut alles kennenlern! Julius, Mon Plaisir, die Schwoleches, Dritten Abschlagen im Wald und diese kluge Sabine. »Der schönste Tag meines Lebens«, sagte Roserl. Nächsten Sonntag würde sie zu Mayers kommen.
Aber Julius wollte keine Woche warten. Er wollte nach Gunzenhausen fahren und um Roserl anhalten. Konnte er seine Eltern vor vollendete Tatsachen stellen? Sein Schwager Max Gutmann war den alten Weg gegangen. Max Gutmanns Vater hatte an einen Verwandten geschrieben. Der Verwandte hatte Sabines Vater zu einer Besprechung wegen der Mitgift gebeten. Und Sabines Vater sagte: »Beim Töchterausgeben erlaubt man sich, seine Nächsten in Anspruch zu nehmen.«
Tausend Jahre war so geheiratet worden. Aber Julius lehnte diesen komplizierten Weg ab. Es war sein Stolz, mit Traditionen zu brechen. Er ging nicht mehr morgens und abends in die Synagoge, er dankte Gott nicht mehr für Wein und Brot. Er wollte die Frau heiraten, die er liebte, und keine Mitgift.
4. Kapitel
Jacobys und Markus
Manfred Markus mit sorgfältig geschnittenem braunen Vollbart las beim Frühstück die verhältnismäßig neue »Berliner Rundschau«, obwohl eingesessene Berliner wie er die »Berliner Tageszeitung« lasen, aber er war ein Fabrikgründer, für Fortschritt und Gewerbefreiheit, kein Hausbesitzer, Sanitäts-, Justiz-, oder Geheimrat. Er sagte zu Adelina: »Die Preise steigen wie verrückt. Du bekommst die Perlenkette, damit du nicht immer so frierst.«
Adelina sagte: »Weißt, Schatzerl, es ist doch so, eine Frau kann heutzutag’ nicht mit bloßem Hals auf einer Gesellschaft erscheinen oder gar auf dem Podium. Ich hab halt gar keinen Schmuck außer dem Verlobungsring.«
Markus fuhr bequem mit der Stadtbahn in die Fabrik, sah sie vom gepolsterten grünen Samtsitz an den Fenstern der Hinterhäuser Nähmaschine nähen, Schuhe auf Leisten spannen, sah Lager von Bronzen und Aschenschalen und Lampen, sah freies verschneites Land mit Lauben aus Brettern. Mag mancher dort wohnen, auf zwei Quadratmetern Feuerbohnen und Kartoffeln ziehen. Er ging in die Fabrik, in das Bürogebäude, nur zwei Etagen hoch, aber mit einem künstlerischen Backsteingiebel von 1893, sah die Post durch, Aufträge über Aufträge. Er konnte sie kaum alle annehmen. Es würde ja teurer werden. Eindecken, eindecken, dachte jedermann.
Da ein Knall. Stille. Er rannte auf den Hof. Der Maschinenmeister sagte: »Gebrochen.« »Was?« »Schwungrad der Drahtwalze.« »Wann kann sie wieder in Ordnung sein?« »Bei der Überbeschäftigung können Wochen ins Land gehen.«
»Werden Sie die Fabrik schließen?« fragte ein Arbeiter, hatte vorgestern ein Kind bekommen, nettes Jungchen, würde wohl wieder abkratzen müssen, wenn sie die Fabrik schließen, woher nehmen und nicht stehlen, Milch, Brot, Miete, Kohlen, und Trude so schwach?
»Nein«, sagte Markus zu dem Beängstigten.
Markus diktierte Briefe an Schwungräderlieferanten: »Ziehen Sie sie gleich durch die Kopierpresse!« Werden doch alle auf dem hohen Roß sitzen bei dieser plötzlichen Hochkonjunktur, diese Maschinenfabriken, die einem Neukömmling wie mir sowieso nicht grün sind. Heute morgen dacht ich, ich wär überm Berg. Neues Betriebskapital? Wieder von der Familie? Ich schulde ihnen 237000 Mark, habe sie noch nie auszahlen können. Sie werden kein gutes Geld dem schlechten nachwerfen. Papas Haus am Kurfürstendamm wird immer mehr wert, muß er behalten. Klug, der Alte. Und die Perlenkette? Ich werd sie kaufen. Frauen mit Schmuck überschütten. Das gehörte sich. Dieser Allerweltspuppe Lia habe ich damals ein Brillantarmband gekauft. Aber das war! Donnerwetter! Adelina war gelehrt worden, sich nichts zu vergeben. Sie vergibt sich was, wenn sie mit mir schläft. Feine Frauen. Damen. »Ich kann dir versichern, ich habe mir nichts vergeben.« Sie war unschuldig, ich hätte ja auch keine Bedreckte geheiratet. Aber in der Ehe? War das so? Überall? Am Bankrott – und Perlenkette.
Er zog den Pelz an, setzte die Glocke auf, verließ die kalte Fabrik. Schnee, Stille. Der Portier hielt den Hund fest. »Werden wir schließen müssen, Herr Markus?«
Er wollte mit Siegmund Jacoby reden. So sah er die schleppeübende Roserl vor dem Jacobyschen Haus. Eine so reizende Frau. Markus vergaß Schwungrad und Betriebskapital, ging, noch lächelnd durch das kostbare Tor, durch den Vorgarten mit der Granitschale, sah den jungen Gärtner Stüber Schnee fegen, betrat die Halle, aus der eine Treppe mit schwarzem Marmorgeländer nach oben führte. Am Treppenabsatz, wo sie sich teilte, stand eine Marmorgruppe. »Doch neu?« sagte er zu Emilie, die seinen Pelz an geschnitzte Bären hängte.
»Wollen Sie sie ansehen?«
»Nee, danke, sehe genug von hier.« Auf einem altdeutschen Holzstuhl mit geschnitzter Rückenlehne zog er seine Gummischuhe aus: »Warm.«
»Frau Stüber legt morgens 50 Briketts ein. Gnügt.« Emilie öffnete die hohen Flügeltüren gegenüber der Treppe.
»Wie gerufen!« rief Siegmund Jacoby. »Tee?« fragte seine Frau, wie Tausende von Mädchen 1871 wegen des Friedens Frieda genannt. Sie saß nach neuer englischer Sitte in einem Teagown aus heller glänzender Seide vor einem silbernen Tablett mit dem Wasserkessel über der Spiritusflamme.
Manfred genoß den bequemen grünen Samtsessel unter der hellen Petroleumlampe, die Teezeremonie der noblen Frieda und ging dann mit Siegmund ins Herrenzimmer, ebenfalls nach englischer Sitte »Die Bibliothek« genannt. Sie trugen Gehrock und Perlen in den Krawatten, waren dreißig, sahen aus wie vierzig, würdig und solide. Die Zeit war der Jugend nicht freundlich.
»Bei mir gibts was Wichtiges. Und bei dir?«
»Bißchen pleite«, sagte Markus.
»Kann ich dir aushelfen?« sagte Siegmund erschrocken.
»Guter Siegi, vielleicht. Ich hatte für sechs Monate Rohmaterial gekauft, als die Preise fielen. Aber sie fielen weiter. Ich mußte Fertigware billiger verkaufen, als die Rohstoffe kosteten. Ich habe 587000 Mark verloren, um genau zu sein.«
»Um Gotteswillen, Fred!«
»Jetzt steigt alles wie verrückt, wir sind voll beschäftigt. Ich konnte mir ausrechnen, wann ich schuldenfrei sein würde.«
»Konnte?«
»Heute ist das Schwungrad der Drahtwalze explodiert. Wir liegen still. Die Kunden werden Lieferung verlangen oder Schadensersatz. Oder, wenn die Preise wieder fallen, bei verspäteter Lieferung Annahme verweigern.«
»Wozu hast du dir solche Sorgen aufgehalst?«
»Na, irgend etwas muß der Mensch doch tun, habe ich eben ein Fabrikgeschäft angefangen. Jetzt rächt sich auch eine Liebesheirat ohne Mitgift.«
»Manfred, du hast einen Traum geheiratet«, sagte Siegmund mit leichtem Vorwurf. »Also, wenn du in Verlegenheit bist, stehe ich dir zur Verfügung. Frieda und ich sind so glücklich, daß ich mich von meinen Brüdern habe auszahlen lassen. Ich kann von den Zinsen leben. Ich muß dir in diesem Zusammenhang ein Gedicht vorlesen.
›Bald ist das Marktgelärm des Morgens reg,
Doch meine Ruhe nimmt der Riegel wahr
Breit hingelagert vor der Eichentür.
O Kunst, so fest zu baun, wie dank ich dir!
Taglärm der Welt, du wirst mir draußen bleiben.‹
Wunderbar, nicht wahr? Das Gedicht bezieht sich auf Erasmus. Sich abseits halten, nicht teilnehmen am Geschrei …«
»Erasmus hat sich die Ohren zugestopft, den Riegel vorgelegt, als Luther wie der Elefant im Porzellanladen hauste! Du nennst es sich abseits halten und bewunderst es? Wie hast du dich verändert!«
»Ja, früher wollte ich die soziale Frage lösen. Aber heute bin ich überzeugt, daß die Verteilung des Geldes der reichen Leute sinnlos ist.«
»Du wolltest mir übrigens was Wichtiges erzählen?«
»Breitkopf und Härtel verlegen zwei Lieder von mir.«
»Gratuliere, künftiger Schubert! Großartiger Anfang.«
»Dann wars doch richtig, daß ich nicht bei Papa eingetreten bin? Ich habe übrigens gestern drei Menzels gekauft. Skizzen zu Friedrich des Großen Uniformen. Vielleicht Grundstock einer Sammlung.«
»Ich bin ein Preuße, kennst Du meine Farben … ! Meine Einjährigenzeit bei den Kürassieren war die schönste meines Lebens.«
»Hast du die ›Träumerei‹ im Treppenhaus gesehen? Salbach hat sie mir ganz billig gelassen. Fünftausend Mark.«
»Viel zu viel!«
»Hatte glänzende Kritiken in der großen Kunstausstellung.«
Geld für Löhne, Liefertermine, gebrochenes Schwungrad, Markus vergaß seine Sorgen im bücherumstellten Raum.
Ein Herr trat ein. »Stefan Heye!«
»Was für eine Freude, dich in unserer Heimatstadt zu sehen!« sagte Siegmund.
»Deine Artikel über den Dreyfusprozeß waren bester Heinrich Heine«, sagte Markus.
»Ich lese nur deinetwegen die ›Berliner Rundschau‹«, sagte Siegmund. »Du kommst wegen der ›Weber‹? Wieder dieser überholte Naturalismus und die Ibsenschen Anklagen. Die Kunst kann das Leben nur im Symbol zeigen.«
»Seit vier Jahren läuft der Prozeß in Paris und jetzt dieses trübe Ende, und du überfällst mich mit den ›Webern‹. Ist in Deutschland das Theater immer noch wichtiger als die Politik?«
»Na hör mal, die Aufführung eines neuen Hauptmanns ist wohl für uns aufregender als ein neunzigmal durchgesprochener Prozeß in Paris.«
»S.M. hat seine Loge im Deutschen Theater wegen der Weber gekündigt«, sagte Markus.
»Na, soll der Kaiser nicht mehr ins Deutsche Theater gehen!« sagte Siegmund.
»Und weder Hauptmann noch Ibsen mehr sehen und sich immer weiter vom modernen Leben entfernen«, sagte Heye.
»Wieso nennst du das Ende von Dreyfus trübe? Immerhin begnadigt«, sagte Markus.
»Warum begnadigt, wenn er unschuldig war, warum nicht freigesprochen?«
»Du hast recht. Man wagte keine klare Entscheidung. Diese unbewältigte Vergangenheit wird Frankreich vergiften«, sagte Markus.
»Ich habe meinen intelligenten Pariser Portier gefragt: ›Würden Sie Dreyfus auf der Teufelsinsel lassen, wenn er unschuldig ist?‹ Hat er geantwortet: ›Sind ja alle gekauft, alles Gesindel‹.« Das Volk flüchtet sich in abstrakte Phrasen und Schlagworte.«
»Herr Paty de Clam«, sagte Markus, »verhaftet einen Juden bei einem Verrat in der französichen Armee, dabei wird ein Jude, dem man erlaubt, Hauptmann zu werden, ein Überfranzose und Überhauptmann.«
»Wißt ihr, daß als erster der Nachkomme von unserer Charlotte Kestner, der prächtige Scheurer-Kestner, für Dreyfus eingetreten ist?«
»Von Goethes Dichtersonne umstrahlt«, sagte Siegmund.
»Die französische Luft«, sagte Markus, »und bei uns dieser Tivolivertrag, der die Juden prinzipiell aus der konservativen Partei ausschließt, auch die braven jüdischen Kleinbürger, die konservativste Menschengattung überhaupt. Sollen wir alle zu Rebellen gemacht werden?«
»Antisemitische Wellen kommen und gehen«, sagte Heye beruhigend.
»Richtig«, sagte Siegmund.
»Nimm doch den Ausschluß aus der konservativen Partei nicht so ernst«, sagte Heye, »wir gehören weder zu den klerikalen Reaktionären noch zu den nationalistischen Raufbolden, die ›Auf den Tag des Krieges‹ anstoßen.«
»Und dieser Kaiser, der die Arbeiter eine »Rotte von Menschen« nennt, nicht wert, Deutsche zu heißen?«
»Befinden wir uns doch in guter Gesellschaft«, lachte Siegmund.
»Du bist ja dämlich«, sagte Markus.
»Ich finde, die Hauptsache ist, daß wir uns selber als Deutsche fühlen. Ich habe noch als kleiner Junge das größte Ereignis unsres Lebens gesehen, den Einzug unserer siegreichen Truppen.«
Siegmund sah auf die Bilder seiner Vorfahren im Rokokofrack, mit der hohen schwarzen Binde, mit den Favoris, alles Berliner: »Dreyfus ist schließlich ein Elsässer in Frankreich, aber wir?«
Inzwischen saß Adelina mit Frieda im weiten Wohnzimmer mit den grünen Samtsesseln unter dem gelbseidenen Schirm der Petroleumlampe und erzählte vom Damentee: »Kaviarbrötchen, da feit sie nix, und dann kam der Herr Stern. Hams den scho mal gsehn, so hoch wie breit in Hellgrau, eine Rose im Knopfloch im Januar, der lasst sich net lumpen, und er hat mir den Brillantring seiner Franziska unter die Nasen gehalten: ›Ein Karat!‹ Wie konnt der feine Justizrat Kollmann seine Franziska einem solchen Parvenu geben?« »Er ist reich«, sagte Frieda.
»Aber vulgär. Franziskas Bruder hat doch auch so reich geheiratet, die sind halt aufs Geld aus.«
»Marie hat sich in den Rechtsanwalt Kollmann verliebt.«
»In den Eiszapfen? Er hat jedenfalls die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und die fade Nocken mit der halben Million geheiratet.«
Frieda klingelte und ließ der Köchin sagen, daß drei Personen zum Abendbrot blieben.
»Das würd ich mich fei nie trauen, so mir nix dir nix der Köchin sagen, daß Gäste da bleiben. Augenblicklich sind ja meine Köchin und Stubenmädl ganz gut, aber es ist nie richtig geputzt, und grad die Zugeherin möcht ich aufgeben, wo mein Mann soviel klagt. Er bleibt jetzt manchmal bis halb elf Uhr abends im Geschäft. Es legt sich natürlich auf die Stimmung im Haus.«
»Wie wars Dienstag? Es tat mir so leid, daß wir im letzten Moment absagen mußten, aber ich gehe ungern aus, wenn Ottchen Fieber hat.«
»Schad! Es hat mir ja den Abend gar nicht gefallen. Ich hätt Siegmunds Heiterkeit so brauchen können. Den ganzen Tag war schon so eine Unruhe im Haus, ein ewiges Schellen und Telefonieren, und ein Telefonarbeiter da, und wir sind alle ganz unruhig geworden, und wir entdeckten im letzten Moment, daß die Zung’ ein bissl Haut Gout hatte.«
»Ja, was haben Sie denn da gemacht?«
»Es blieb nix übrig, wir haben sie gegeben. Aber es wurde auch sehr wenig gegessen. Der Frankfurter Beer war da, meinem Mann liegt so sehr an ihm, und dann eine nicht ganz frische Zung’! Und Kollmanns. Der Beer ist ein steifer Bock, und Sie wissen ja, wie maulfaul der Kollmann ist. Montag war halt ganz anders, der junge Dampf, der mich jetzt begleitet, und ein junger Sänger, ja wissens Künstler halt und ein piekfeines Essen, geräucherte Rinderbrust mit Schoten und Kartoffelsalat und ein famoser Kastanienberg.«
Das Fräulein klopfte. Frieda entschuldigte sich, sie hatte Otto versprochen, Dornröschen vorzulesen. Otto hörte ihr im Bett mit glühenden Backen zu.
Man saß bei einem kalten Abendbrot, Heringssalat, Eier in Majonäse, Platten mit Aufschnitt.
»Wer ist dieser Stern, der in solchem Stil lebt?« fragte Frieda.
»Kupfer in Südamerika«, sagte Markus, »ein Spekulant, ich glaube auch ein Phantast, jedenfalls unsolide.«
»Das siehst am Kaviar«, sagte Adelina, »aber sie haben ein bildschönes Buberl.«
»Joschua Beer in Frankfurt liquidiert«, erzählte Manfred, »der Alte hat so viel an dem Suez-Landwegprojekt verloren, die Schiffe mit Hilfe von zwanzig Lokomotiven über die Landenge zu ziehen. Der Suezkanal hat ihn auf dem Gewissen. Sie ziehen nach Berlin. Er ist ein Naturwunder – gescheiter als Napoleon, musikalischer als Wagner, versteht mehr von Kunst als Bode.«
»Kann ich den nicht für meine Zeitung gewinnen?« sagte Heye.
»Wieso meine?« fragte Manfred.
»Ich habe einen lebenslangen Anstellungsvertrag.«
»Sekt«, rief Siegmund, »von mir sind zwei Lieder bei Breitkopf und Härtel angenommen.«
»Gratuliere, kann ich sie haben und daheim ansehen?« fragte Adelina.
»Wirklich Sekt nach dem Bier?« fragte Frieda.
»Wein nach Bier, wünsch ich mir, Bier nach Wein, das laß sein«, sagte Siegmund.
Der zierliche Siegmund mit seinem blonden Spitzbart, der großartig aussehende Manfred mit dem braunen Vollbart, Heye mit Wulstlippen und einem Zwicker, Adelina mit dem Gemmenprofil, dem hohen Stehkragen, dem blonden Knoten oben auf dem Kopf, und die stille, pompöse, schwarzhaarige Frieda stießen mit den Sektschalen an. Die kleine Tafel unter der vielkerzigen Messingkrone verlor sich in dem getäfelten Raum. Es war so behaglich. Manfred war plötzlich sicher, er würde durchkommen.
Heye erzählte, von den niedrigen Pariser Restaurants mit weißlackierten, von Goldleisten umrahmten Wänden, seidenen Vorhängen mit kleinen Klunkern, Dorée, wo Offenbach und Dumas an einem Tisch saßen, Café Anglais, wo schon Napoleons Marschälle im Grand 16 gefeiert hatten, vom König von Serbien, der für 1400 Francs Sterlette von der Wolga kommen ließ – und für den Bankettsaal Maiglöckchen für 4000 Francs. Die tollen Abende, wo alle Fußbäder in Chateau D’Yquem nahmen, nachdem Adèle Dartois einen Cancan getanzt hatte.
»Wer war das?« fragte Adelina.
»Wenn ich es vor den beiden Damen in den Mund nehmen darf, es wurde von ihr erzählt, daß sich mehr Prinzen in ihrem Schlafzimmer einfänden als bei Napoleon in den Tuilerien …«
»Eine Nixgscheite also«, sagte Adelina.
Siegmund bog ab, sprach von einem neuen Roman, ›Buddenbrooks‹: »Bißchen viel Krankheitsbeschreibungen, und bisher haben wir Kunst für höher als Kaufmannstum gehalten, aber der neue Schriftsteller Thomas Mann findet Beschäftigung mit Kunst ein Verfallszeichen.«
»Das hab ich gar gern«, sagte Adelina.
Frieda dachte, Siegi lag nichts an der landwirtschaftlichen Maschinenfabrik seines Vaters, wollte lieber komponieren als Geld machen. Ist doch wohl das Höhere?
Manfred sagte: »Ich habe ihn gelesen. Der einzige Jude, der drin vorkommt ißt Gänseleberpastete auf seiner Schulsemmel und verdrängt die edle Patrizierei durch seine Geschäftstüchtigkeit.«
»Doch ein guter Roman«, sagte Siegmund, »man muß nicht alles vom jüdischen Standpunkt aus sehen.«
»Ein realistischer Roman?« fragte Heye, »man trägt doch Symbolismus, blaue Vögel und Seejungfrauen, bloß keine Wirklichkeit.«
»Du brauchst dir nur die neuen Häuser anzusehen«, sagte Markus, »plötzlich lehnt man die Säule ab, dies Symbol – ich sage auch schon Symbol – des Humanismus. Dieser gräßliche Jugendstil.«
»Man kann den Jugendstil nicht in Bausch und Bogen ablehnen. Munch«, sagte Heye.
»Na gräßlich!« sagte Markus.
»Ich war für seine Austellung ein bischen mit verantwortlich«, sagte Heye.
»Tut mir leid. Dieses gemeine ›Tingel-Tangel‹? Nackte Frauen mit langen schwarzen Strümpfen vor einer Reihe bärtiger Männer?«
»Aber Tingel-Tangel ist so gemein«, sagte Heye.
»Oder ›Der Kuß‹? Vor einer Spitzengardine, die nach möbliertem Zimmer und Mietskaserne nur so riecht? Sicher eine häufige Form der Liebe mit Angst vor der Wirtin. Aber was soll das, die Liebe immer nur als Angst und Lüsternheit?«
Heye dachte, aber die Mädchen haben Angst, die Männer sind lüstern. »Besteht nicht ein ewiger Kampf der Geschlechter? Bekomme ich je das Mädchen, das ich liebe?«
»Sicher«, sagte Markus. »Seit Ibsen haben wir dieses Hergemache mit der Liebe. Ist ja kindisch.«
»Kindisch?« sagte Adelina. »Ibsen ist der Erste, der das Liebesleben der Frauen ernst genommen hat.«
»Ja, ja«, sagte Markus beschwichtigend und ironisch.
Am Brandenburger Tor waren Bogenlampen aufgestellt. »Donnerwetter«, sagte Markus, »das nenn ich Fortschritt. Wunderbare Stadt wird Berlin. Ich hätte mich vorhin nicht so über den Antisemitismus aufregen sollen. Wenn ich diese Bogenlampen sehe, bei denen man fast lesen kann, finde ich meinen Glaube an eine bessere Welt wieder.«
Aus einem Hausflur kam eine jammervolle Kinderstimme: »Fünf Pfennig det Schäfken, fünf Pfennig det Schäfken.«
»Fortschritt«, verhöhnte Markus sich selbst.
»Mein Gott, das arme Würmerl, gib ihm eine Mark«, sagte Adelina.
»Das müßte verboten sein«, sagte Heye, »aber es ist hier immer noch besser als in Paris, wo Tausende in allen Winkeln liegen, die ein wenig Schutz gegen die Eiseskälte geben. Und der Skandal mit der Assistance Publique. Die Verwaltung verschlingt fast die ganzen Einnahmen. Fünfzig Millionen!«
In der dunklen Nebenstraße schlug ein Betrunkener mit zerlumpten Hosen und klaffenden Schuhen auf ein schreiendes Mädchen ein. Halbwüchsige, Kinder, eine Hochschwangere mit einem Säugling mit verbundenem Kopf, sahen zu.
»Wir hätten eine Droschke nehmen sollen«, sagte Manfred, »Wenn die Kirchenbaujuste statt Kirchen Wohnungen und Schulen bauen ließe, wäre viel gebessert«, und plötzlich mit einem Lächeln: »und so sind wir wieder beim Ausgang unsres Gesprächs und zu Hause.«
Heye war beschwingt, Redakteur einer aufblühenden Zeitung im aufblühenden Berlin im aufblühenden Deutschland, Entdecker großer Künstler, Kämpfer für eine friedliche freie Welt gegen den wahnwitzigen Nationalismus, gegen Herrn Sauerwein vom »Matin«, nur mit dem Wort, aber was war wirkungsvoller? Schon besprachen Minister die Politik mit ihm. Morgen würde er bei dem großen Verleger Klothilde Kramm treffen, die Ibsenschauspielerin. Würde sie ihn lieben können, einen dicklichen hässlichen Mann? Frauen, sagt man, verlieben sich in den Geist. Sie war wahrscheinlich ein bißchen älter als er. Würde sie die Bühne aufgeben, Kinder bekommen wollen?
5. Kapitel
Von Rumkes
Franziska wußte sofort, dies schüchterne Klingeln war Hildegard von Rumke vom gleichen Flur, Frau eines Majors beim Großen Generalstab. Sie waren seltsam intim, konnten offener miteinander sprechen als gewohnt, da sie keine gemeinsamen Bekannten hatten.
»Ihre Kachelöfen heizen besser als meine«, sagte Hildegard.
»Legen Ihre Mädchen genug Briketts ein?«
»Der Bursche heizt. Wir haben es gern kühl, es härtet ab. Bevor mein Mann kommt, legen wir etwas nach.«
Echt, dachte Franziska, sie friert den ganzen Tag, damit es genügend warm für den Herrn Major ist.
Sie schleppte auch alles allein nach Haus, worauf Franziska sagte, gespreizt in der dritten Person: »Frau Major haben doch den Burschen.«
»Ich will ihn nicht so anstrengen.« Hier sagte sie auch Franziska nicht die Wahrheit. Sie suchte den billigsten Laden, machte weite Wege für ein Stück Fleisch. Franziska konnte Hildegards ärmliches Aussehen nicht begreifen, immer das gleiche schwarze Wollkleid und ein gutes Schwarzseidenes. In den sechziger Jahren bekam man das gute Schwarzseidene zur Aussteuer fürs Leben, aber doch nicht jetzt? Hildegard machte sich ihre Kleider selbst, Franziska gab Geld für Kleider aus. Sie verdirbt unsere altpreußische Sparsamkeit, dachte Hildegard, sagte: »In unsern Kreisen kleidet man sich schlicht.« Schlicht war der Ausdruck des höchsten Lobes: »Sie hat so schönes schlichtes Haar.« Glattes Haar war lobenswürdig, welliges verdächtig. Neger und Juden hatten welliges Haar. Der kleinen Christine wurden die Locken mit Wasser glatt gebürstet. Zu Franziska kam täglich die Friseurin, legte die Brennschere auf den Spiritusbrenner, probierte die Hitze an ihren Lippen. Sie brennt sich die Haare, dachte Hildegard, und sie haben jeden Tag Gebratenes. Sie kannte nur Schmorbraten, Suppenfleisch, Gehacktes, Schweinebauch mit Dörrpflaumen, Hering mit Specktunke, Gries- und Graupensuppe im Winter, Kaltschale im Sommer, rote Grütze oder Flammerie nach. »Die Gewohnheiten haben sich seit dem alten Kaiser sehr geändert.« Aber nicht für sie. Das alles tat ihrer Intimität mit Franziska keinen Abbruch. Wem sonst hätte sie sagen können: »Ich habe so gehofft, daß meine Schwiegermutter Christl und Friedrich Wilhelm in den Osterferien nimmt, sie haben das schöne Haus in Langfuhr, aber nein. Meine Schwiegermutter spricht von mir als ›die Xgeborene Burrmann‹. Die Rumkes sind Soldatenadel, in der fünften Generation Offiziere seiner Majstät. Meine Schwiegermutter war sehr unglücklich über unsre Heirat. Sie ist eine Gräfin aus Schlesien, es war ein Abstieg, daß sie Herrn von Rumke heiratete, aber ich glaube, sie war schon etwas ältlich. Sie erwartete, daß ihr schöner Sohn – Sie wissen wie vorzüglich mein Mann aussieht – wieder in den Hochadel hinaufheiraten würde. Aber mein Willibald hat mich vorgezogen. Sie sagte zu allen Leuten: ›Willibald hätte eine Gräfin Itzenplitz haben können und heiratet eine Burrmann, die nichts hat. Regierungsrat ist der Papa.‹ Sie beanstandete alles bei uns. Der Tisch war nicht gut gedeckt, das Essen zu einfach. ›Es geht eben nicht, daß Offiziere ohne Geld heiraten. Sie müssen nicht umsonst eine Kaution hinterlegen.‹ Das sagte sie so einfach vor mir und den Kindern, und Friedrich Wilhelm ist so geweckt. Friedrich Wilhelm – der Älteste in unsern Familien wird immer Friedrich Wilhelm genannt – kommt bestimmt in den Großen Generalstab. Wir bringen ihn nach Lichterfelde.«
Die Demütigungen hatten sich ihr nicht in die Kleider gelegt. Sie setzte sich nur auf einen Hocker oder auf die Ecke vom Stuhl. Sie sprach viel von den Kosten, die teure Wohnung, das Reitpferd, die handgemachten Stiefel vom Hofschuhmacher. »Mein Mann hat ein Sektessen im Kasino gegeben, er kann nicht nachstehen, es herrscht heute großer Luxus bei den Regimentern.«
Hildegards Elternhaus, voll von Büchern und Musik, gab Willibald ein Heimatsgefühl. Denn er hatte keine Heimat, so wenig wie alle preußischen Offiziere, in einem oberschlesischen Nest zur Welt gekommen, in einer Wohnung, in der man schon packte, da man nach Holstein versetzt war, mit zehn ins Kadettenkorps, mit siebzehn Fähnrich, herumgeworfen von Bartenstein nach Wesel, von Kosel nach Königsberg, von Posen nach Straßburg, seine Heimat sein Regiment, seine Wurzeln sein Offizierskorps, sein Gesichtskreis sein Kasino. Keine Stadt, die ihm nahestand, keine Wohnung, an der er hing, kein Baum, mit dem er größer geworden war, Janitscharen, Söldlinge, Heimatlose. Immer im Dienst, ein Soldat gehört dem König. Willibald fand seine Hildegard in der Freiheit der bürgerlichen Welt, nicht als Tochter eines Vorgesetzten, der Einsame, dem man die Gefühle abgewöhnt hatte, ein weiches zärtliches Mädchen. Bei Burrmanns konnte er sich den hohen Kragen aufhaken und von ihr begleitet »Das Meer erglänzte weit hinaus« singen, konnte für sie »Die Toteninsel« von Böcklin kopieren, ohne daß er sich lächerlich machte. Als er sich verlobte, sagte seine Mutter: »Nicht schön, kein Geld, keine Familie, und klein ist sie außerdem.« »Aber ein Fels, an den ich mich lehnen kann«, sagte Willibald. »Und das Auftreten!« sagte die Mama, »dreht immer ihre Hände im Schoß aus Verlegenheit. Sie wird dir in deiner Karriere schaden. Das ist keine Frau, die mit dem Gesinde umgehen kann.«
»Hungern ist keine Schande«, erwiderte er seinem Vater, der sagte: »Auf einen Zuschuß von mir kannst du nicht rechnen.«
»Ich habe mich bei trockenem Brot und Käse um keinen Deut schlechter gefühlt als die Windhunde, die tausend Taler verjuxten.«
Aber Berlin und der Große Generalstab stellten viele Forderungen, und Hildegard trank Wasser, während für ihn immer Bier dastand, und fror den ganzen Tag, da erst gegen Abend geheizt wurde. Er merkte es nicht, sonst hätte er sich nicht die Stiefel beim kaiserlichen Hofschuhmachermeister anmessen lassen.
Ihre Wohnung war mit Möbeln eingerichtet, die leicht verpackt werden konnten. Über dem Sofa hing in Lebensgröße, nachgedunkelt, der Rumke aus dem Siebenjährigen Krieg, Fahnenträger bei Leuthen, der Rumke von Leipzig mit dem hohen Kragen, der eigentlich die Völkerschlacht gewonnen hatte, Onkel Rumke, General bei Düppel, und Rumkes Vater bei Gravelotte. Gegenüber hing ein Stich des Steuereinnehmers Burrmann, 1745 geboren, 1803 gestorben, Verfasser eines Bändchens Gedichte »Poetische Nebenstunden«. Das war aber auch alles, was man von Burrmanns wußte.
Friedrich Wilhelm kam zu Rudi Stern gelaufen, der Tisch wurde umgedreht, eine Decke darüber, so saßen sie im Zelt. Er brachte Heere von Bleisoldaten zu Sterns, Rudolf brachte seinen Ankersteinbaukasten zu Rumkes. Beide kamen in die Vorschule des Gymnasiums, marschierten mit ihren Konfekttüten durch das große Tor, wurden zum Religionsunterricht getrennt. Der Religionslehrer erklärte: »Diese Kinder sind jüdisch.« Wenige Tage später, bei Ankersteinbau und Bemannung der entstandenen Festung mit Soldaten, rief Friedrich Wilhelm: »Dreckiger Judenjunge!« »Dreckiger Christenjunge«, rief Rudolf. »Das sagt man nicht«, sagte Friedrich Wilhelm, »nimm doch den Bogen runter, da fällt uns ja der Turm ein.«
Ein halbes Jahr später kam Rudolf zu Hildegard gelaufen: »Er sagt, ich habe Christus ermordet. Das ist aber nicht wahr.«
Hildegard sagte in das schöne Kindergesicht: »Friedrich Wilhelm meint es auch nicht so.«
Hildegard dachte nach, Friedrich Wilhelm hatte die Wahrheit gesagt. Die Schuld der Juden an der Kreuzigung des Erlösers. Es durfte nicht vergessen werden, bis sie den Gottessohn anerkannten, es war ihr nicht wohl bei diesem Kinderverkehr. Aber es erfuhr ja niemand, hoffentlich erfuhr es niemand.
Auf einer Gesellschaft im Kasino hatte eine bezaubernde blutjunge Frau in den ersten Minuten ihre Tanzkarte voll.
»Wer ist denn das? Kennen Sie sie?« fragte Frau von Gubenow.
»Nein«, sagte Hildegard.
»Eine Italienerin von altem Adel«, sagte eine Dritte.
»So etwas Schwarzes? Der europäische Adel ist blond«, sagte eine Vierte.
»Na, ist das nicht eine Jüdin«, sagte Frau von Gubenow.
»Wo denken Sie hin? Eine Gräfin Retzow«, sagte die Dritte.
»Etwas vergoldetes semitisches Blut wird da wohl drin sein. Empörend solch zweideutige Erscheinung hier im Kasino«, sagte die Vierte.
»In mein Haus käme sie jedenfalls nicht«, sagte Frau von Gubenow.
»Warum denn nicht?« fragte die kecke Dritte.
»Sie hat so was Brünettes!« sagte Frau von Gubenow und raffte ihre Schleppe.
Die kecke Dritte sah Hildegard kalkweiß werden. Das ist ’ne Jüdin, dachte sie, warum wäre sie sonst so erschrocken?
Hildegard dachte, untergrub sie nicht die Karriere ihres Mannes? So mißtrauisch war man gegen eine italienische Adlige, und sie ließ ihre Kinder mit wirklichen Juden namens Stern verkehren?
6. Kapitel
Eine Bewegung beginnt
Major von Rumke kam in Zivil ins Wohnzimmer: »Du weißt, wir haben Zansibar gegen Helgoland eingetauscht, hat uns der Brite endgültig aus Afrika verdrängt. Der Prinz und Burlepsch holen mich zur Protestversammlung ab, zur Beobachtung natürlich nur.«
Hildegard sah den Dreien nach, imponierende Erscheinungen auch ohne Königs Rock. Dann ging sie in die Küche: »Der Schmorbraten kann für morgen bleiben. Mir bringen Sie bitte eine Leberwurststulle.«
In dicken Rauchschwaden, an langen ungedeckten Tischen, saßen die Männer, drängten sich die Kellner durch, in jeder Hand ein halbes Dutzend Bierseidel. Auf dem Podium saßen Zwanzigjährige. Einer rührte die Glocke:
»Meine Herren, in dieser ernsten Stunde, da wir um unser Recht am Erdball betrogen werden, da man uns für Zansibar Helgoland anzubieten gewagt hat, wollen wir es aussprechen: Kein Staat wird in Kürze mehr etwas gelten, der keine Kolonien hat. Nach Leistungskraft, Zahl und Zuwachs ist die Erde zu verteilen. Vier echt deutsche Männer drücken alles aus, was wir bei diesem gemeinen Vertrag fühlen. Männer aller Parteien, die bei dieser Gelegenheit sich lediglich als Deutsche fühlen, mögen der Regierung sagen: ›Der Vertrag mit England schädigt unsre Interessen und verwundet unser Ehrgefühl, er darf niemals Wirklichkeit werden.‹«
»Niemals, niemals, niemals«, riefen die Anwesenden und trampelten.
»Wer kann ein Volk von fünfzig Millionen, das jährlich über eine halbe Milliarde für Kriegswesen ausgibt, hindern, einen Vertrag zu zerreißen, der die kommenden Geschlechter um ihr Erbteil am Planeten betrügt? Zu groß wären unsre Opfer an Blut und Geld, wenn unsre militärische Macht uns nicht einmal die Möglichkeit verschaffte, unser gutes Recht auch da geltend zu machen, wo es die hohe Genehmigung der Engländer nicht findet.«
Einer rief: »Nieder mit den Engländern!«
»Nieder, nieder, nieder«, riefen die Versammelten.
»Wir sind bereit, auf den Ruf des Kaisers uns stumm den feindlichen Geschossen entgegenfahren zu lassen, aber wir können dafür auch verlangen, daß uns der Preis zufalle, einem Herrenvolk anzugehören, das seinen Anteil an der Welt sich selber nimmt und nicht von der Gnade und dem Wohlwollen eines andern Volks zu empfangen sucht. Deutschland, wach auf!«
Der Redner schob sein Pincenez zurecht und verlas das Programm einer zu gründenden patriotischen Gesellschaft:
1. Ersatz des allgemeinen Wahlrechts durch ein Klassen- oder Mehrstimmenwahlrecht.2. Annahme des Sozialistengesetzes von 1878 ohne die nachträglichen Verwässerungen.3. Ausweisung aller sozialistischen Abgeordneten, Herausgeber, Verleger, Redakteure und Gewerkschaftsführer.4. Verbot von Streiks. Wer gegen die Bestimmungen verstößt kann in Sicherungshaft genommen werden. Das Verfahren ist summarisch.5. Kampf um die Seele des Volkes durch Versorgung mit unvergiftetem Lesestoff, Vorträge vor Soldaten aus der deutschen Geschichte, vaterländische Festfeiern für das Volk usw.6. Ausweisung aller fremden Juden rücksichtslos bis auf den letzten Mann. Fremdenrecht für landansässige Juden, d.h. für alle, die am 18. Januar 1871 der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört haben und für ihre Nachkommen, auch wenn nur ein Elternteil jüdisch war oder ist. Ihnen bleiben alle öffentlichen Ämter verschlossen, der Dienst in Heer und Flotte, das aktive und passive Wahlrecht, Banken, Theater, Presse und die Berufe des Lehrers und Rechtsanwalts. Sie dürfen ländlichen Boden weder besitzen noch beleihen. Für den Schutz, den sie als Volksfremde genießen, entrichten sie die doppelten Steuern.7. Entschlossene Kampfpolitik gegen die Polen, eventuell unter Entziehung des aktiven und passiven Wahlrechts.8. Enteignung dänischen Grundbesitzes. Bei den Maßregeln wird man unterscheiden müssen nach der Rassenverwandtschaft sowie dem Werte oder Unwerte der Fremden. Die dänische Sprache muß verschwinden.9. Elsaß-Lothringen wird diktatorisch regiert. Wer sich nicht verpflichtet, die französische Sprache weder im Hause noch außerhalb zu gebrauchen, oder diese Verpflichtung bricht, muß das Land verlassen.10. Eine Reichszentralbehörde zur Heimholung der deutschen Kolonisten aus Südrußland, Russisch-Polen, Galizien und Nordamerika11. Reform der Freizügigkeit.12. Eine aggressive äußere Politik.Der Redner nahm sein Pincenez ab: »Schließlich dürfte es nicht unzweckmäßig sein, schon jetzt gelegentlich öffentlich von Evakuierung durch siegreiche Kriege neu erworbener Gebiete zu reden, damit die Gegner erkennen lernen, daß solche Maßnahmen in Deutschland schon ihre Vertreter finden, und damit wir uns daran gewöhnen, sie für zulässig zu halten.« Er erhob die Stimme: »Das Bedürfnis lebt heute in den Besten unseres Volkes, einem starken, tüchtigen Führer zu folgen. Ein Glück, wenn in dem Träger der Krone dieser Führer ihm erstünde. Wir legen Listen aus und bitten jeden, der mit unserm Programm einverstanden ist, sich einzutragen und zugleich die Summe anzugeben, die er zu unserm alldeutschen Verband beisteuern kann.«
»Wir gehen unauffällig«, sagte der Prinz Siegen-Siegen. Als sie aufstanden, sagte ein Mann in grünem Loden: »Wollen Sie sich denn nicht einzeichnen, etwas für das geliebte Vaterland in seiner entsetzlichen Lage tun?«
»Nein«, sagte der Prinz.
Der Mann schrie: »Da kommen Leute als Spitzel, gehören gar nicht zu uns, schleichen sich hier ein, Vaterlandsfeinde! Spitzel!« Einer, der nur das Letzte gehört hatte, sagte: »Lassen Sie doch die Leute festnehmen, wenn das Spitzel sind.«
»Möchte um die Begleichung der Rechnung bitten«, unterbrach der Kellner.
Die drei Herren zahlten und gingen.
»Na«, sagte der Prinz, als sie in der schneidenden Kälte waren, ›des deutschen Knaben Wunderhorn‹. Ist ganz richtig, Wir heben die Verfassung auf und regieren von unsern Schlössern, ist immer noch besser als der permanente Belagerungszustand, den die verlangen. Kriegserklärung an Juden, Dänen, Polen und Elsaß-Lothringer. Rechtlosigkeit für Sozialdemokraten, Beendigung der Freizügigkeit. Kriegen wir wieder Hintersassen. Na, vorzüglich!«
»Man kann nicht die Mehrheit des Volks zu Bürgern zweiter Klasse machen. Ein gefährliches Programm!« sagte Rumke.
»Kann nicht?« lachte der Prinz. »Wie lange ist es her, daß wir der erste Stand waren, und dann kam lange gar nichts, und dann die Plebs?«
»Selbst diese Herren wollen doch nicht hinter die französische Revolution zurückgehen.«
»Doch gerade, aber dann ist mein Herr Papa als unumschränkter Fürst besser als diese Oberlehrer, die sich als Herrenvolk fühlen. Hat man so was schon gehört ›Herrenvolk‹? ›Moralische Eroberungen‹ wollte der alte Kaiser, diese Lodenjoppler und Gamsbarthütler wollen Eroberungen ohne Moral. Keiner von diesen Leuten hat den Krieg noch mitgemacht. Da lernte man Demut.«
»Demut verlangst du von dieser Parvenu-Gesellschaft, diese Ladenbesitzer, die wir zu Leutnants der Reserve haben aufsteigen lassen«, sagte Burlepsch, »kommt in den Kaiserhof!«
Rumke konnte sich nicht ausschließen, hatte Angst, unter einem Taler konnte man den Mantel nicht in der Garderobe lassen. Der Baron Burlepsch, hiess es, hatte hundertausend Mark Rente im Jahr. Siegen-Siegen hatte, obwohl er Witwer war, Kammerdiener, Lakai, zwei Hausdiener, Koch, Küchenfrau, Aufwartefrauen, Kutscher, Reitknecht, Wagenhalter, dabei wohnte er nur einen Teil des Jahres in Berlin, von Reisen abgesehen, stand Schloß und Gut zur Verfügung.
»Bin froh, daß ich nichts mit Politik zu tun habe«, sagte Burlepsch, »dieser kleine Rechtsverdreher, ›helle Verzweiflung‹, weil eine Insel vor Hamburg nicht englisch bleibt? Na, mir ist die Taube in der Hand …«
»Mir auch«, lachte Rumke.
»Also Sperling in der Hand lieber …«
»Volk ist immer radikal«, sagte der Prinz, »als ich im Winter siebzig vor Paris lag, bekam Moltke mehrfach die Aufforderung, Paris in Klump zu schießen: ›Guter Moltke gehst so stumm immer um das Ding herum, bester Moltke sei nicht dumm, mach doch endlich bumm, bumm, bumm!‹«
»Moltke glaubte immer, daß der Entschluß zu einem Kriege viel leichter von einer Versammlung gefaßt wird, in der niemand die volle Verantwortung trägt.«
Plötzlich schlug ein junger Mann vor ihnen die Hacken zusammen.
»Bitte?« sagte der Prinz erstaunt.
»Zu Befehl, Leutnant von Blankenburg, sah Herrn Major soeben in der Versammlung, wollte nur Bewunderung aussprechen vor so viel vaterländischer Begeisterung, kein fauler Friede mehr, kein fauler Kompromiss, den Engländern wird es gezeigt. Schluß mit der jüdischen Asphaltpresse und den verhetzten Arbeitern, ein Hochgefühl unter nationalen Männern zu sein, die wissen, daß wir im Kriege sind gegen den äußeren und den inneren Feind.«
»Rühren, abtreten!« sagte der Prinz zu dem Aufgeregten.
Im Kaiserhof, es wurde doch teuer soupiert, sagte der Prinz: »Das war das Neue Preußen. Na Prost! Was wir heute gehört haben wird nicht als Politik angesehen, sondern als Patriotismus. Sie sind so schweigsam, Rumke?«
»Ich muß das verarbeiten, wird mir nicht leicht. Der Reichstag ist eine Schwatzbude, und bei der Gefahr der roten und der schwarzen Internationale kann uns eine patriotisch-nationale Gesellschaft nur recht sein.«
»Patriotischer Pöbel«, sagte der Prinz.
»So ganz unrecht«, sagte Burlepsch, »hatte der junge Mann nicht. Jüdische Asphaltpresse, verhetzte Arbeiter, stimmt doch? Und den Engländern muß man es zeigen.«
Der Prinz schwieg. Mit wem konnte er reden?
Zu Rumkes Entsetzen waren ein paar Goldstücke weg, als noch Droschken für die Heimfahrt genommen wurden.
7. Kapitel
Reisen
Alle, die es sich leisten konnten, reisten, die russischen Großfürsten nach Paris, der Kaiser mit der Yacht Hohenzollern an die norwegische Küste, ganz ohne Damen, Eduard von England mit vielen Damen nach Homburg oder Marienbad, Fürst Bülow nach Norderney, Kaiser Franz Joseph von Juni bis September nach Ischl, die Berliner auf die Inseln Usedom und Wollin und die Münchener ›ins Gebirg‹.
Adelina sagte zu Jacobys: »Wie könnt ihr in diese Protzen- und Parvenuhotels gehen? Kinder gehören nicht in Hotels. Wir gehen in ein Bauernhaus ins Gebirg, wirtschaften selbst mit Theres und Luis. Kommt mit.«
»Eine herrliche Idee«, sagte Siegmund.
Adelina in dem, was sie ›ein echtes Dirndl‹ nannte, dunkelbraun mit gefälteter hellblauer Seidenschürze, Manfred in blauer Steirerjacke, erwarteten sie in Mittelau mit einem Bauernfuhrwerk. Alberne Maskerade, dachte Frieda. Albern fanden die Markus den städtischen Aufzug der Jacobys. Adelina mit ihrem Wiener Komtesserlaussehen genoss die Tracht. Sie zeigte die Zimmer: »Schaut die herrlichen Bauernmöbel. Der Schrank innen ist doch eine Pracht.« Leinen mit bunten Bändern gebunden, Fächer voll Flachs, die Schranktüren mit Heiligenbildern beklebt. Der volle Schrank hieß aus dem Koffer leben. Wozu, dachte Frieda. Die Toilette war im Kuhstall. Eine Kuh berührte Frieda. Die Magd tröstete: »Derschreckens Eahna net. Das Schnauzerl ist ganz weich.«
Adelina sagte im Herrgottswinkel: »No, was sagt ihr zu unserm feinen Kuh W.C.?«
Wenn Adelina sagte: »Habt ihr das zwidre Gfries von der Theres gsehen?«, so hätte Frieda gern gesagt sie möchte eben auch Ferien haben. Und Waschen? Frieda fand im Dorf, wo sie die Leute nicht verstand, schließlich eine alte Wäscherin für Siegmunds täglich gewechseltes Hemd, für Ottchens Waschanzüge, für die riesigen weißen Leinenhemden und Nachthemden und Unterröcke mit Stickereieinsätzen, durch die Bändchen gezogen werden mußten.
Jacoby und Markus halfen bei der Heuernte, die Kinder durften oben auf dem Heuwagen in den Heuboden fahren. Abends standen sie an der Landstraße und sahen die Herden glockenläutend in die Ställe ziehen. Otto würde nicht noch einmal zum Entsetzen der Markus sagen: »Ich weiß, die braunen Kühe geben Milch und die schwarzen Kaffee.« Er sah Mähen, Trocknen, Einfahren, Melken, Alpenwiesen voll Blumen.
Der sechsundfünfzigjährige Bauer hatte vierundachtzig Stück Vieh, Wiesen, so weit das Auge reichte, samt der jetzt sechsundsiebzigjährigen Tochter erheiratet, die jeden Mittag für Familie, Knechte und Mägde ausgezogene Kücheln buk. Der Bauer schrie dreimal am Tag: »Machst, daß stirbst, damit ich a Junge krieg.« Keine Atmosphäre für Frieda Jacoby, die sich nach dem Hotel du Lac in Luzern sehnte, nach Dampferfahrten auf dem Vierwaldstätter See.
Otto radelte mit Walter, der Steigungen liebte. »Du kannst nicht den ganzen Tag radeln«, sagte Frieda.
»Weiter verpimpeln?« sagte Markus.
»Er überanstrengt sich«, sagte Frieda.
»Unsinn, ein Kind.«
Frieda rief den Dorfdoktor, der sagte: »Der Bub ist ja viel zu groß für elf Jahr und ein schlechter Esser noch dazu. Du darfst nicht mehr als eine halbe Stunde auf der flachen Landstraße radeln.«
»Ach bitte, sagen Sie das unsern Freunden. Sie denken, ich verzärtle den Jungen.«
Otto weinte. Der fünfzehnjährige Walter hatte sich mit ihm befreundet. Sie sprachen über die Dschungelbücher, über Felix Dahn: »Gebt Platz, ihr Völker, unserm Schritt, wir sind die letzten Goten …« Sie waren beide gleich begeistert. Und das sollte aufhören?
Markus glaubte, genau wie der Oberst von Rumke, nicht an Krankheit, sondern an Sichzusammenreißen.
Frieda sagte beim Zubettgehen zu ihrem Mann:
»Ich mache nie mehr Adelinas aristokratische Imitation mit. Diese ganze Münchener Albernheit. Von Berlin sagt sie, ›es ist halt gar nicht künstlerisch‹, von dem Rudi Stern, diesem Bild von einem Jungen, ›halt gar so schwarzhaarig‹, blond ist ihr Ideal.«
»Aber Frieda! Ich erkenne dich ja nicht wieder«, sagte Siegmund.
»Ich möchte deine Freundschaft mit Fred nicht zerstören, aber verreisen werde ich nie mehr mit ihnen.«
Amtsrichter Mayers reisten in den großen Ferien nach Kragsheim, immer am Sonntag, damit Max und Sabine sie abholen konnten. »Also da sinds ja«, riefen sie und küßten sich, was nur auf dem Bahnhof geschah.
Der Amtsrichter, Max Gutmann und sein Bruder David wuschen sich die Hände am kupfernen Gießfaß, trockneten sie am gestickten Handtuch. Das Brot lag unter einem Tuch auf Maxens Platz. Max dankte Gott für Brot und Wein. Sabine brachte Suppe mit Klößchen, Braten mit grünem Salat und Obstkuchen. Sabine sprach von den Zeitereignissen! Grete war nicht ins Bett zu bekommen. »Was sagt ihr, daß der Kaiser das Heinedenkmal im Achilleion abgerissen hat? Ist doch gemein?«
»Diese elenden Anarchisten, eine so schöne und unglückliche Frau wie die Kaiserin Elisabeth einfach zu erstechen«, sagte Roserl, »sie war eine große Verehrerin von Heine, darum hat sie das Denkmal errichtet. Man hat doch eigentlich nie erfahren, was damals in Mayerling geschehen ist? Sie sollen alle betrunken gewesen sein, und ein Offizier hat den Kronprinzen mit einem Leuchter derschlagen.«
»Der Kaiser wird immer unbeliebter«, sagte der Amtsrichter, »das Dreiklassenwahlrecht ist zu ungerecht.«
»Ich kann ihn nimmer schmecken mit seiner Herumreiserei und seinem ewigen Gered’«, sagte Roserl.
Das ging Sabine zu weit: »Er ist halt zu jung zur Verantwortung gekommen. Ich weiß nicht, ob so alles seine Schuld ist. Und was für ein vorbildliches Familienleben, sechs Söhne und unser Prinzeßchen, und der Eduard von England soll sich schon wieder mit der Otéro rumtreiben.«
»Weißt, der Sebald Ungeheuer und der Schneckenspeiser sind beide so jung gestorben.«
»Zurückgekehrt ist der Staub zur Erde und der Geist zu Gott«, sagte Max.
»Die Unsterblichkeit der Seele also«, sagte Julius zweifelnd.
»Was wäre der Mensch ohne die Fortdauer seines Geistes?« sagte Max. »Etwas Unfertiges …«
»Der Tod ist endgültig«, sagte Julius.
»Ich weiß, sie glauben jetzt an das Aufgehen der Menschenseele in der Weltseele, also an die Vernichtung«, sagte Max aufgeregt.
»Ich kann mich den modernen Naturwissenschaften nicht verschließen«, sagte Julius.
»Unsre Weisen sagen: ›Das diesseitige Leben ist eine Vorhalle, betrage dich darin so, daß du in den Palast aufgenommen wirst’‹.«
»Es ist ein Problem, wenn man nicht mehr an den Palast glaubt. Warum anständig sein, da klar ist, daß Laster und Bosheit oft Erfolg haben?«
»Alle Völker glauben an die Unsterblichkeit der Seele«, sagte Max.
»Wollen wir einen größeren Waldspaziergang machen?« fragte Julius.
Roserl war Feuer und Flamme. Sie gingen durch Weiherstein, das nur aus einer langen Straße bestand – »das germanische Straßendorf im Gegensatz zum slavischen Runddorf«, belehrte Julius –, zur uralten Aumühle im Wald. Das Gras stand hoch, voll mit Blumen. Sie setzten sich auf eine eingestürzte Mauer, die sich über die Höhe hinzog, hörten Sägemühle und Plätschern des Bachs, als ein Mann aus der Mühle kam und sagte: »Setzens sich nicht auf die Teufelsmauer.«
»Teufelsmauer?« fragte Julius.
»Ja, ja, der Herrgott hat doch dem Teufel das Stück Erd versprochen, um das er eine Mauer bauen kann, eh die Hähne krähen, aber die Hähne haben gekräht, bevor er fertig war, da hat der Teufel in seiner Wut die Mauer übern Haufen geworfen.«
Julius lächelte.
»Ja, wenn die Staderer herkommen und alles besser wissen, da kann ja kein Recht gedeihen. Es hat eine geheimnisvolle Bewandtnis mit der Teufelsmauer. Ich will kein Verdruß haben, stehens auf und gehens!«
Julius war verstimmt. Er setzte sich auf einen Baumstumpf. Vom nahen Beckenweiher zirpten die Grillen, und kleine Kröten sprangen herum. Grete pflückte Blaubeeren und Roserl Steinpilze und Rehpilze. »Wir könnten nach Heidenfeld,« sagte Julius, »und über die Schwedenschanze und Tillys Lager zurück. Da habe ich mal eine Kuh führen müssen, ich war nicht älter als du und habe mich schrecklich gefürchtet. Um halb vier kommt, glaub ich, immer noch der Münchener Schnellzug, wollen wir warten, wir können ihn vom Wald gut sehen.«
Heidenfeld lag mit Mauern und Türmen grau und abweisend zwischen Feldern, überragt von einem Felsen mit einer Ruine.
»Wunderbar!« jubelte Roserl.
»Hier gehen wir ins Wirtshäusl, trinken Kaffee.«
Das Wirtshaus mit seiner Einfahrt für hochbeladene Lastwagen lag verödet. Sie gingen durch den leeren Gang zwischen Herrenstübl und Gaststube. Die Schwanenwirtin erschien: »Tja, der Herr Mayer, das ist aber nett, daß Sie sich einmal bei uns sehen lassen. Sie sind schon lang droben in Berlin? Was kann ich Ihnen geben?«
»Wir möchten gern hinten im Grasgarten Kaffee trinken.«
Im Obstgarten waren lange Tische und lehnenlose Bänke. »Still bei Ihnen«, sagte Julius, als die Wirtin mit dem Kaffee kam.
»Seit das Eisenbahnnetz so ausgebaut ist, können wir uns an den Landstraßen nicht mehr halten. Heidenfeld ist keine Eisenbahnstation. Wer soll denn hierherkommen? Ein paar Wanderer sind alles.«
»Und was das für ein herrliches Haus ist«, sagte Roserl.
»Hundert Jahr ists in der Familie. Meine Kinder möchtens verkaufen. Aber es ist auch nicht zu verkaufen. Es ist nichts wie eine schwere Sorge.«
»Die Landstraßen sind nur noch für strategische Zwecke da. Es fängt ja an mit den Autos.«
»In den Autos sind reiche Leut’, die wollen elegante Hotels mit fließendem Wasser. Das einzubauen, gäb ich ja mein letztes Geld aus.«
Sie gingen noch durch den Ort. Am Brunnen im mittelalterlichen Spitalhof stand ein Alter im zerfetzten Anzug mit einem altertümlichen spitzen Hut, trank aus der gekrümmten Hand und ließ sich Wasser über den Schädel laufen. »Die Kirche«, erzählte Julius, »hat Wunibald aus England, ein Bruder des eichstättischen Bischofs Willibald um 750 gestiftet. Darüber wurde 700 Jahre später diese gotische Kirche gebaut, und vor zwanzig Jahren haben sie den Türmen die häßliche Bekrönung auf gesetzt. Wir müssen heim. Onkel Max will in die Synagoge.«
Julius besuchte mit Grete seinen Schulrektor Seufergeld, dem er sein Studium verdankte. Er saß im geblümten Schlafrock in einem birkenen Lehnstuhl, rauchte eine Pfeife mit einem porzellanen Kopf. Auf dem Tisch stand ein stark riechendes Heliotrop. Ein Papagei rief, als sie eintraten: »Sei nicht frech!«