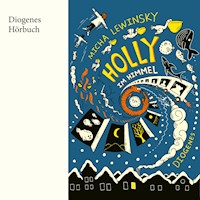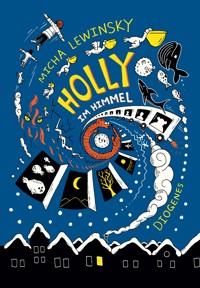21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ben Oppenheim balanciert zwischen Ex-Frau, zwei Kindern und seiner Liebe zu Julia. Er hat Rückenschmerzen und Geldsorgen, aber was ihn wirklich ängstigt, ist der Krieg in Osteuropa. Getrieben vom jüdischen Fluchtinstinkt steigt er eines Morgens kurzerhand in ein Flugzeug nach Brasilien. Mitsamt Ex-Frau und Kindern, aber ohne Julia. Im Krisenmodus läuft Ben zur Hochform auf. Nur der Atomkrieg lässt auf sich warten. Ben dämmert, dass er sich ändern muss, wenn sich etwas ändern soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Micha Lewinsky
Sobald wir angekommen sind
Roman
Diogenes
Freilich unsere Gegenwart macht es uns nicht leicht, sie zu lieben; selten ist es einer Generation auferlegt gewesen, in einer so gespannten und überspannten Zeit zu leben wie der unseren, und wir haben wohl alle manchmal das gleiche Verlangen, einen Augenblick auszuruhen von der Überfülle der Geschehnisse, Atem zu holen in der unablässigen politischen Bestürmung durch die Zeit.
Stefan Zweig
There is a whole school of American Jewish writers who spend their time damning their fathers, hating their mothers, wringing their hands and wondering why they were born. This isn’t art or literature. It’s psychiatry. These writers are professional apologists. Their work is obnoxious and makes me sick to my stomach.
Leon Uris
1
Benjamin Oppenheim dachte, er sei bereit für die Flucht. Nicht im praktischen Sinne, dafür war er zu nachlässig. Aber mental. Seit vielen Jahren rechnete er schon mit dem Schlimmsten. Hundertmal hatte er in Gedanken durchgespielt, was zu tun wäre. Und doch traf es ihn unvorbereitet, als es so weit war.
Am Abend des 29. Septembers ging er jedenfalls noch fest davon aus, drei Tage später wieder zurück in seiner Wohnung zu sein. Er nahm seine Tasche, die fertig gepackt im Flur lag. Dann blieb er stehen. Er wusste nicht, wie er sich von Marina verabschieden sollte. Seit ihrer Trennung gab es keine Konventionen mehr. Je nachdem ob sie gerade gestritten oder einige friedliche Tage durchlebt hatten, schien es angezeigt, die Wohnung wortlos zu verlassen oder sich freundschaftlich in den Arm zu nehmen. Meist einigten sie sich stillschweigend auf einen Mittelweg. Sie klopften sich ungelenk gegenseitig auf den Rücken, oder – was Ben im Grunde am liebsten war – sie winkten sich aus einem halben Meter Entfernung zu, so als stünden sie auf zwei Seiten eines unüberwindbaren Flusses.
Marina, mit der er immer noch verheiratet war, stand reglos vor dem offenen Kühlschrank. Der Nachrichtensprecher im Küchenradio erklärte, die Front habe sich um ein Dorf verschoben. Den Namen der Ortschaft, die nun in Schutt und Asche lag, vergaß Ben sofort wieder. Der Krieg im Osten Europas dauerte schon zu lange.
»Wohin gehen wir eigentlich mit den Kindern, falls es passiert?«, hatte Marina vor einigen Wochen gefragt. Ben verstand ohne Weiteres, dass sie vom Dritten Weltkrieg sprach. Wenn man wie er in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts zur Welt gekommen und mit einem ängstlichen Grundtemperament ausgestattet war, führten alle Wege zur Atombombe.
»Es gibt einen großen Luftschutzkeller unter der Fritschiwiese.«
Marina war dagegen. »Lieber lass ich mich verstrahlen, als mit all den hippen Zürchern da unten eingepfercht zu werden.«
Im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses, in dem sie wohnten, gab es zwar auch einen Schutzraum. Doch dort probten Take Five, eine fleißige Jazzband aus freundlichen Sekundarlehrern. Wo Feldbetten und Wasservorräte hätten bereitstehen müssen, lagerten Gitarrenverstärker und Vintage-Synthesizer.
»Man müsste raus aus der Stadt. Am besten raus aus Europa.«
»Und wohin?«
Ben sortierte in Gedanken die Optionen. Israel, der Staat, der einst gegründet worden war, um den Juden einen Hort der Zuflucht zu bieten, war selbst ein ewiger Krisenherd. Ben mochte zwar das Essen in Tel Aviv und das Klima. Aber das Land wurde von Fanatikern regiert. Es war umgeben von Feinden. From the river to the sea. Nein, danke. Im Ernstfall brauchten sie einen Zufluchtsort, an dem die Schutzräume nicht schon überfüllt waren.
Amerika fiel leider auch weg. Im Falle eines Atomkriegs würden die USA selber zu einem Angriffsziel. Außerdem waren die Mieten in Brooklyn und Silver Lake längst unbezahlbar. Und wo sonst wollte man leben. In Ohio?
Australien war zu weit weg. Afrika zu unsicher. Am Ende blieb nur Südamerika.
Stefan Zweig, Bens langjähriger Lieblingsautor, hatte sich in Petrópolis niedergelassen, als er von den Nazis verfolgt wurde. Und was für Zweig richtig gewesen war, konnte für die Oppenheims nicht falsch sein. Falls es zum Schlimmsten kommen sollte, wusste Ben, wohin.
»Brasilien«, sagte er. Und dabei blieb es.
Marina schloss den Kühlschrank, ohne etwas herausgenommen zu haben. Ben sah ihr zu, wie sie einen Lappen feucht machte und damit den Küchentisch, den er vor einer halben Stunde geputzt hatte, noch einmal wischte. Wartete sie womöglich darauf, dass er zu ihr hinging, um sich zu verabschieden? Er trug schon Straßenschuhe, und der Boden war frisch gefegt. Die Tasche über seiner Schulter war nicht nur schwer, sondern auch sperrig. Und auch sonst verspürte er wenig Lust, einen Schritt auf sie zu zu machen.
Ben hätte gehen können. Aber irgendetwas hatte er vergessen. Ihm fiel nur nicht ein, was.
Er warf noch mal einen Blick ins Schlafzimmer.
Das Bett, in dem sie einst zwei Kinder gezeugt hatten, stand kahl am Fenster. Bevor Marina nach Hause gekommen war, hatte Ben das Federbett abgezogen und zusammen mit dem Spannlaken im unteren Teil des Schranks verstaut. Marina würde, sobald er gegangen war, die fleckige Matratze und die Decke mit ihrem eigenen Bettzeug beziehen, das im oberen Regal bereitlag.
Der geteilte Schrank war ein planerisches Unikum. Zwei Systeme, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, existierten hier auf engstem Raum beisammen, getrennt allein durch ein dünnes Regal.
Marinas Kleider lagen im oberen Teil des Schranks. Sie hatte ihre malven- und dezent sandfarbenen T-Shirts nach Marie Kondo gerollt und die feine Unterwäsche ordentlich in kleine bunte Boxen verstaut. Im unteren Teil des Schrankes quollen Bens Kleider ungebügelt aus dem vollgestopften Regal. Jeans, Pullover, Hemden, Regenjacke und ein Fondue-Caquelon, in dem sein Reisepass steckte, lagen planlos beisammen.
Ben war nicht stolz darauf, dass sein Teil des Schrankes so aussah. Im Gegenteil. Immer wieder hatte er versucht, den knappen Raum besser zu nutzen. Aber es fehlte ihm einfach das Talent zur Ordnung. Womöglich auch der Wille. Dieser halbe Quadratmeter Kleiderschrank war sein Territorium. Hier galten seine Regeln. Es war der einzige Fleck in der ganzen Wohnung, den er nicht aufräumen musste, wenn Marina übernahm.
Überall sonst verwedelte Ben jeden Mittwochvormittag und jeden zweiten Freitagabend gewissenhaft alle Spuren, die daran erinnerten, dass er sich in der Wohnung aufgehalten hatte. Er fegte den Küchenboden, saugte den Flur, kratzte die Kackreste der Kinder von der Kloschüssel. Er legte die aufgerissenen Briefumschläge ins Altpapier und den angeschnittenen Käse in die Tupperdose. Aber was er auch tat, es war nie genug. Sobald Marina sich in der Wohnung einrichtete, teilte sie ihm verlässlich mit, was er übersehen hatte. Die Flaschen waren nicht entsorgt, im Kühlschrank schimmelte der Bio-Sellerie, die Fingernägel der Kinder waren nicht geschnitten. Marina hatte immer recht. Ihre Ansprüche waren nicht überzogen. Und doch ärgerte Ben sich jedes Mal über die Hinweise, die er als Bevormundung empfand. Manchmal fragte er sich, wieso sie sich überhaupt getrennt hatten, wenn die Kritik so unvermindert anhielt.
Aus dem Küchenradio war jetzt die Stimme des NATO-Generalsekretärs zu hören. Der Einsatz von Atomwaffen hätte verheerende Konsequenzen, warnte er. Ein Strategieexperte wurde zugeschaltet. Er erwähnte Drohnen und die Anzahl gefechtsbereiter Nuklearsprengköpfe.
»Das Olivenöl ist leer«, rief Marina aus der Küche.
»Okay«, sagte Ben.
Das war kein Eingeständnis einer Schuld. Nur eine sachliche Bestätigung. Wenn sie wollte, dass er vor ihr zu Kreuze kroch, musste sie schon ein bisschen weiter aus ihrer Deckung kommen. Ben überlegte, ob Marina vielleicht ebenfalls etwas versäumt hatte, was er ihr vorhalten konnte. Aber ihm fiel nichts ein.
Seine Hand wanderte zur Jackentasche. Wie immer, wenn es um Haushaltsfragen ging, überkam ihn das dringende Bedürfnis zu rauchen. Ben ertastete Zigaretten, aber kein Feuerzeug. Auch in der Innen- und in der Hosentasche fand er keines. Jetzt wusste er wenigstens wieder, was ihm vorhin gefehlt hatte. Er kramte in der Schublade im Flur, wo unbezahlte Rechnungen, Kleingeld und leere Kaugummipackungen lagerten. Er schob ein unterschriebenes Formular der Pensionskasse zur Seite. Darunter fand er verblasste Quittungen von Nachtessen, die er im letzten Jahr von den Steuern hatte absetzen wollen. Er entdeckte die Kreditkarte, die er vor Monaten hatte sperren lassen, weil er meinte, sie sei ihm gestohlen worden. Aber das Feuerzeug fand er nicht. Eben noch war Ben kurz davor gewesen, die Wohnung aufrechten Hauptes zu verlassen. Doch nun kauerte er wegen Marinas Olivenöl-Bemerkung wie ein Junkie im Flur und wühlte fahrig in unerledigten Angelegenheiten.
Vielleicht hatte ja Rosa das Feuerzeug. Ben meinte zwar zu wissen, dass seine Tochter nicht rauchte. Aber konnte er da wirklich sicher sein?
Rosa war fünfzehn. Sie gebärdete sich abwechselnd mal als Erwachsene und mal als Kleinkind, je nachdem ob es darum ging, Ben zu belehren oder im Haushalt mitzuhelfen. Noch vor Kurzem hatte sie tagelang Janis Joplin gesungen. Freedom is just another word for nothing left to lose. Dann erklärte sie plötzlich, sie investiere jetzt in Krypto, um mit der Rendite für Unabhängigkeit und Sicherheit im Alter vorzusorgen.
Ben nahm sich vor, bald mit dem Rauchen aufzuhören. Es konnte ja nicht so schwer sein. Es war ihm in der Vergangenheit schon mehr als einmal gelungen. Nur hatte es jedes Mal zwingende Gründe gegeben, um kurz nach dem Aufhören wieder anzufangen. Viele Jahre war es der regelmäßig aufflackernde Konflikt zwischen Marina und ihm gewesen. Selbstentzündliche Vorwürfe und Schuldzuweisungen, die Ben nervlich belasteten. Marina hatte getrennte Wohnungen vorgeschlagen, vielleicht eine offene Beziehung. Ben hatte gehört: Ende, Einsamkeit, Elend. Worauf er jedes Mal zur Tankstelle gehen und Zigaretten kaufen musste.
Als Marina die Beziehung dann an einem Dienstagabend im März tatsächlich beendete, wartete Ben darauf, in ein tiefes schwarzes Loch zu fallen. Zwei Tage rauchte und weinte er ohne Unterbruch. Danach wurde es besser. Er stellte Erleichterung fest. Er war noch am Leben. Die Angst vor dem Ende seiner Ehe hatte ihn viele Jahre belastet. Nun konnte Marina ihn nicht mehr verlassen. Sie stritten zwar weiter. Aber da nicht er den Schlussstrich gezogen hatte, konnte Ben sich für eine Weile als Opfer fühlen und ohne Schuld zufrieden leiden.
»Fehlt dir noch was?«, fragte sie aus der Küche.
Ben war sich ziemlich sicher, dass Marina wusste, wo das Feuerzeug war. Bestimmt hatte sie die Wohnung absichtlich so aufgeräumt, dass er die Übersicht verlor. Sie genoss ihre Überlegenheit in Ordnungsfragen. Aber diesen Triumph wollte er ihr nicht gönnen.
»Ich schau nur noch kurz nach Moritz.«
Die Tür zum Zimmer seines Sohnes war angelehnt. Moritz schlief schon. Ein Rudel von Plüschtieren bewachte den Jungen vor den Monstern, die nachts oft ohne Vorwarnung in sein Zimmer schlichen.
Moritz war selbstbewusst und furchtlos am Tag. Doch sobald es dunkel wurde, bevölkerte sich seine Welt mit Zombies und Vampiren, die nur darauf warteten, ihn anzuspringen. Seit der Trennung waren die Kreaturen besonders allgegenwärtig. Ohne Vorwarnung kam Moritz manchmal grell schreiend aus seinem Schlafzimmer gerannt und flüchtete sich in Bens Arme. Er zitterte dann am ganzen Körper und war kaum zu beruhigen. Auch wenn Ben seinem Sohn wortreich erklärte, dass es die Monster nur in seinem Kopf gab, auch wenn er das Licht einschaltete und alle Ecken der Wohnung inspizierte, Moritz ließ sich nur schwer trösten. Er fühlte sich schutzlos. Und im Grunde, dachte Ben, war er das ja auch.
Jetzt summte Moritz allerdings wohlig im Schlaf.
»Alles gut?«, fragte Marina.
»Alles gut«, sagte Ben.
Auch wenn es vieles gab, worüber sie aus dem Stand erbittert streiten konnten – wenn es um die Kinder ging, zogen sie am gleichen Strang.
Nach der Trennung hatte Marina rasch angefangen, nach Wohnungen zu suchen. Nicht zu teuer sollten sie sein und nicht zu weit entfernt von der Schule. Wie kleine Handelsvertreter hätten die Kinder mit ihren Köfferchen von Tür zu Tür ziehen sollen. Das war der Plan gewesen. Doch bald musste Ben erkennen, dass die Vereinzelung, vor der er sich so lange so gefürchtet hatte, in der Praxis nicht umsetzbar war. Marina und er verdienten zusammen nur gerade knapp genug, um sich das gemeinsame Leben in der günstigen Altbauwohnung leisten zu können. Eine weitere Wohnung im teuren Zürich überstieg ihre Möglichkeiten. Sie konnten sich die Trennung, zu der sie sich nach Jahren des Streits endlich durchgerungen hatten, nicht leisten.
So kam es, dass sie, Monate nach dem Abbruch ihrer Beziehung als Paar, noch immer im gleichen Bett schliefen. Wenn auch abwechselnd. Montags und dienstags war Ben dran, mittwochs und donnerstags Marina. An den Wochenenden wechselten sie sich ab.
Anfangs bemerkten die Kinder überhaupt nicht, dass die Eltern sich getrennt hatten. Marina mietete ein WG-Zimmer, in das sie auswich, wenn Ben zu Hause war. Und Ben zog sich, wenn Marina bei den Kindern war, in sein Atelier zurück, das zwar klein war, aber doch groß genug, um darin ungestört schlafen und schreiben zu können. So lebten sie die Hälfte ihrer Tage als Vertriebene im Exil. Die andere Hälfte waren sie Zeitreisende zu Besuch in der gemeinsamen Vergangenheit.
Erst nach über einem Monat verstand Ben, dass die Lebensform, für die er sich entschieden hatte, einen Namen trug: das Nestprinzip.
Ben nahm seine Tasche. Nun gab es nichts mehr zu erledigen in der Wohnung. Er winkte Marina von der Küchentür zu.
»Gute Nacht.«
Sie lächelte ihn an. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Tschah-au.« Der freundliche Singsang schien aus einer Zeit zu kommen, in der es noch keinen Krieg gab. Nicht im Osten Europas und nicht in der Altbauwohnung am Bullingerplatz. Der nostalgische Gruß heimelte Ben an. Kurz verspürte er Lust, die Schwelle der Küchentür zu überschreiten und diese Frau, die er einmal so geliebt hatte, in den Arm zu nehmen.
Sie sah ihn fragend an.
»Tschüss«, sagte Ben rasch. Dann verließ er die Wohnung.
2
Krumm über den Lenker seiner Vespa gebeugt, tuckerte Ben durch den nächtlichen Nieselregen. Er hatte noch im Hausflur eine SMS geschrieben: Bin unterwegs. Innert Sekunden war mit einem Pling die erhoffte Antwort eingetroffen: ein Kuss-Emoticon, das kleine Herzen versprühte. Bens Gehirn hatte ein Tröpfchen Dopamin ausgeschüttet, dann war er losgefahren.
Es war schon verwunderlich, dachte er, wie schnell es ihm gelungen war, wieder eine Freundin zu finden. Oder ein Date. Bei der Definition war er sich nicht ganz sicher. Julia sprach von Liebe. Ben war schon zufrieden, wenn sie ihn küsste.
Noch vor einem halben Jahr hatte er damit gerechnet, für den Rest seiner Tage allein bleiben zu müssen. Nach der Trennung von Marina fühlte er sich nicht bereit, um wieder auf Brautschau zu gehen. Was hatte er schon zu bieten? Er war kein junger Mann mehr. Traurige Falten hatten sich um seinen Mund gelegt und mattgraue Schatten unter seine Augen. Aber der physische Zerfall war nach der Trennung nicht einmal Bens größte Sorge. Er hatte ja auch früher nicht mit Äußerlichkeiten gepunktet. Was ihm wirklich fehlte, war etwas anderes.
Vor zwanzig Jahren hatte Ben für seine Erzählung Kariesden Schweizer Buchpreis gewonnen. Die Novelle wurde verfilmt, sein Name stand groß auf den Plakaten, die überall in der Stadt hingen: Nach einer Geschichte von Benjamin Oppenheim. Ben wurde regelmäßig interviewt und von wildfremden Menschen angesprochen.
»Bist du der Benjamin Oppenheim?«, wurde er gefragt.
»Dein Buch hat mich sehr berührt.«
Natürlich redete er seinen Erfolg klein. Die Bescheidenheit des Wunderkindes war das Leitmotiv seines jugendlichen Balztanzes. Wenn er flirtete, ließ er sich loben und winkte dann ab, als wäre es ihm unangenehm, schon wieder, verehrt zu werden. »Ich bin doch nur ein Pfuscher mit Glück«, sagte er gern. Es gab Frauen, die diese Masche als charmant empfanden.
Damals. Vor langer Zeit.
Inzwischen war Karies vergessen. Die Buchhändler hatten vor Jahren schon aufgehört, auf Bens Zweitling zu warten. Und auch seine hoffnungsvolle Ersatzkarriere als Drehbuchautor hatte er irgendwie gegen die Wand gefahren.
So würde er nie wieder eine Frau finden, fürchtete er. Nie wieder Zuneigung, nie wieder Zärtlichkeit. Das Einzige, was ihn noch retten konnte, war ein neuer Erfolg. Andere Männer gingen nach der Trennung ins Gym. Ben setzte sich an seinen Computer.
Er begann, ein Drehbuch zur Lebensgeschichte von Stefan Zweig zu schreiben. Einen Versuch war es wert. Er war zwar nicht der Erste, der diese Idee verfolgte, aber er hoffte, eine neue Perspektive zu finden, einen persönlichen Zugang.
Nicht nur dass Zweig wichtige Jahre in Zürich verbracht hatte. Auch sonst nahm Ben in den Schriften des Literaten etwas wahr, das ihm vertraut vorkam. Zweig war ebenso schwermütig gewesen wie er. Getrieben von einer drängenden Sehnsucht nach dem fernen Ideal. Moralisch streng (das war Ben zwar eher nicht, aber er schätzte es an Zweig). Voller Verständnis für alle Abgründe und Ängste (die hatte Ben im Überfluss). Zweig war ein manischer Schreiber gewesen wie er, ein Getriebener, ja ein Verfolgter (für Letzteres beneidete Ben ihn zuweilen). Während Zweig mit seiner Sekretärin hatte durchbrennen können, als die Welt in Flammen stand, schien Bens Angst vor dem Weltkrieg nur eine Marotte des jüdischen Neurotikers zu sein.
Ben hoffte, dieses Drehbuch würde ihm den Nimbus des Intellektuellen verleihen. Auf dem Dating-Markt war das zwar eher eine Special-Interest-Kategorie. Kaum beachtet vom Mainstream, der Wert aufs Aussehen legte, auf breite Schultern und emotionale Reife. Dafür war bei den Denkern die Konkurrenz kleiner. Und es gab durchaus Frauen, die bereit waren, sich von Buchstaben blenden zu lassen, das wusste Ben.
Bloß, er hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Immer fürchtete er, die Zeit renne ihm davon. Und dabei vertrödelte er sie erst recht. Alle paar Minuten unterbrach er sein Schreiben, um auf Social Media zu erfahren, welcher seiner Kollegen gerade wieder was publiziert hatte und wer von wem gefeiert wurde. Halbe Kinder schrieben scheinbar mühelos ganze Bücher. Vor Kurzem hatten sie ihn noch um Rat gefragt, weil ihre holprigen Texte nichts taugten – jetzt lasen sie in Klagenfurt. Unerträglich.
Auch Julia Beck war so ein Fall.
Er hatte sie vor vielen Jahren bei der Verleihung der städtischen Kulturpreise kennengelernt. Eine junge Kunstdebütantin, die Karies gelesen und offenbar geliebt hatte. Inzwischen war sie eine gefeierte Künstlerin. Ihre Installationen standen, lagen und hingen in Museen und Galerien rund um die Welt. Während Ben noch immer in seinem Kelleratelier vor sich hin moderte, eröffnete sie eine Ausstellung nach der anderen. Die letzte in New York. Sie postete auf Instagram Fotos von der Vernissage.
Gratuliere zu deinem Erfolg, schrieb Ben. Er rechnete nicht mit einer Antwort. Doch Julia meldete sich sofort zurück.
Schön, von dir zu hören!
Die vergangenen Wochen seien anstrengend gewesen, berichtete sie. Ihre Beziehung sei gerade in die Brüche gegangen. Nun sei sie allein mit ihrem kleinen Sohn Prince.
Ben wunderte sich, dass Julia, die er doch kaum kannte, ihm all das so offen erzählte. Und dass sie ihren Sohn wirklich Prince genannt hatte. Vorsichtig berichtete er nun auch von seiner Trennung. Er fand die richtigen Worte, entdeckte verbindende Gemeinsamkeiten. Julia antwortete mit ersten Emoticons, die Herze und Küsse versprühten.
Ben kniff die Augen zusammen. Aber die Straße vor ihm verschwamm nicht wegen seiner Kurzsichtigkeit, es war der Regen, der jetzt in Schlieren über die schlecht geputzten Brillengläser rann.
Zum Glück war der Weg zu Julia nicht allzu weit. Bald würde er in ihr warmes Bett schlüpfen. Sie würden zusammen schlafen, noch in dieser Nacht, daran hegte er keinen Zweifel. Zärtlichkeiten waren verblüffend unkompliziert mit ihr. Gut ausgeschildert und ohne Drama. Trotzdem war es mehr als ein erwachsenes Arrangement. Immer wieder hatte Ben in den vergangenen Monaten das Gefühl gehabt, die Gesetze der Physik zu überwinden. Mehr als einmal träumte er, wenn er neben Julia eingeschlafen war, vom Fliegen. Durch leichtes Anheben der Füße gelang es ihm dann, über dem Boden zu schweben. Als hätte er schon immer geahnt, dass es eigentlich ganz einfach war.
Der Regen prasselte jetzt hart gegen das Visier. Mit hochgezogenen Schultern klammerte Ben sich an den Lenker. Er drosselte das Tempo. Die Scheinwerfer eines Wagens, der sich von hinten näherte, blendeten ihn im Rückspiegel. Bens Blick wanderte zum Tacho. Die Nadel zitterte deutlich unter vierzig. Vermutlich ärgerte sich der Fahrer hinter ihm über sein Schneckentempo. Aber er musste doch die Straßenverhältnisse mit berücksichtigen. Den glatten Asphalt, den Zustand der Reifen, den Bremsweg. Außerdem war da noch die schwere Umhängetasche, die ihn jederzeit aus dem Gleichgewicht bringen konnte.
Schon lange hatte er diese Tasche mal ausräumen wollen. Es konnte ja nicht sein, dachte er, dass der Pullover, die beiden Unterhosen und die Socken, die er für die wenigen Tage im Exil gepackt hatte, allein so viel wogen. Er erinnerte sich, dass noch zwei Bücher in der Tasche liegen mussten. Ein oder zwei halb getrunkene Wasserflaschen. Ein Brillenetui. Einzelne Tageslinsen. Bleistifte. Vielleicht doch noch ein Feuerzeug. Ganz sicher Tabletten: Paracetamol, Ibuprofen, Johanniskraut. Außerdem: Kaugummis, Kondome, Kabel. Sand vom letzten Urlaub. Der Bodensatz der Tasche war unappetitlich. Undefinierbarer Dreck.
Ben vermutete, dass sich auch der Aufsatz des Rasierapparats, den er einmal in Jerusalem gekauft hatte, irgendwo in dieser Tasche befinden musste. Der Aufsatz war nutzlos, da Ben den Rasierapparat selbst schon lange nicht mehr finden konnte. Unterdessen trug er einen Bart. Keinen richtigen zwar. Nicht zu vergleichen mit der religiösen Gesichtsbehaarung des Verkäufers in der Jaffa Street. Aber doch ein bartähnliches Gewucher.
Woher kam das eigentlich mit den Bärten bei den Juden, fragte sich Ben. Stand das irgendwo geschrieben, oder war es einfach eine Mode, geboren aus den unruhigen Umständen? Wenn auf der Flucht aus Ägypten schon die Zeit gefehlt hatte, um Brotteig aufgehen zu lassen, dann hatten die Männer bestimmt auch keine freie Minute gehabt, um sich zu rasieren. Und da die Flucht der Juden nie wirklich aufgehört hatte, wuchsen die Bärte bis heute weiter. So musste es sein, dachte Ben.
Er nahm sich fest vor, den Aufsatz des Rasierapparats zu suchen. Selbst wenn es dafür nötig war, die Tasche auszuräumen. Ben war bereit, sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen. Er wollte sich rasieren, seine Steuererklärung erledigen und endlich mal die Rückenübungen machen, die er immer wieder vergaß. Er wollte all das tun, was man tat, wenn man angekommen war. Sobald er angekommen war.
Wieder spürte Ben den Drängler im Nacken. Die Ampel vor ihm schaltete auf Gelb. Ben beschloss, dem drohenden Konflikt auszuweichen, indem er Gas gab. Flucht nach vorne. Der Klügere gibt nach. Er beschleunigte, dann überlegte er es sich anders. Er wollte nicht bei Rot über die Kreuzung rasen. Und eigentlich wollte er sich auch nicht hetzen lassen. Ist ja nicht mein Problem, wenn der es so eilig hat. Ben bremste trotzig. Das Vorderrad arretierte. Das Hinterrad rutschte auf der feuchten Straße zur Seite. Die Vespa legte sich quer, und fast in Zeitlupentempo fiel Ben mit seiner plumpen Umhängetasche vom Sattel.
Noch ehe er verstand, was passierte, war sein Körper schon dabei zu reagieren. Der Sympathikus wurde aktiviert. Adrenalin floss. Die Nebenniere schüttete Cortisol aus. Die Bronchien wurden gedehnt, die Herzfrequenz gesteigert, die Pupillen geweitet. Alles automatisch, ohne sein Zutun.
Ben war angegriffen worden, aus dem Nichts. Nun gab es nur noch eine Frage: fliehen oder kämpfen?
Die Entscheidung war schon viele Jahre vor ihm gefallen.
Bens Urgroßvater hatte im Ersten Weltkrieg für Deutschland gedient. Als die Nazis begannen, die Juden zu verfolgen, fühlte er sich nicht gemeint. Er freute sich auf den Karneval und starb in Theresienstadt. Sein Sohn Arthur wurde ausgehungert in die Schweiz gebracht. Immer wieder fragte sich der junge Mann, warum gerade er noch am Leben war, seine Eltern, seine Schwester und die meisten seiner Cousins und Cousinen aber nicht.
Arthur heiratete ein Mädchen, deren Eltern vor den Pogromen in Galizien geflohen waren. Auch viele ihrer Verwandten lebten nicht mehr.
Bens Großeltern zeugten eine Tochter, die sie behüteten wie eine zerbrechliche Kostbarkeit. Das Kind sollte ein glücklicheres Leben haben. Aber es verstand nicht viel vom Glücklichsein. Woher auch? Die Mutter schlug, der Vater weinte im Schlaf. An ihrem zwanzigsten Geburtstag heiratete sie einen Zürcher Juden, der schnell viel Geld verdiente. Er hieß Jacques Oppenheim.
Dessen Familie kam aus dem Elsass, lebte aber schon länger in der Deutschschweiz. Darauf war man stolz. Ein paar Großtanten aus Straßburg waren deportiert worden. Auch in Belgien und Holland gab es einst diverse Verwandte, die es längst nicht mehr gab. Wie in jeder jüdischen Familie. Ansonsten aber: Schweizer seit Generationen. Jacques’ Mutter hatte immer Wert darauf gelegt, um keinen Preis aufzufallen. Der Chanukka-Leuchter durfte nie auf dem Fensterbrett stehen. Man musste die Kippa vom Kopf nehmen, wenn man aus dem Haus ging. Die Nachbarn sollten nichts erfahren. So konnte man durchs Leben kommen.
Jacques Oppenheim, der jüdische Schweizer, und seine Braut, die traurige Emigrantentochter, zeugten einen Sohn, der Mitte der Siebzigerjahre zur Welt kam. Das Kind hatte in seinem Leben keinerlei Verfolgung erfahren, und doch saß ihm der Schreck in den Knochen.
Das Motorrad lag einen Meter vor ihm quer auf der Kreuzung. Vorsichtig rappelte Ben sich auf. Nichts tat ihm weh. Die Hosen waren beim Knie zwar zerrissen und durchnässt vom Regen. Aber Blut war keines zu sehen.
Ben spürte den Puls im Hals.
Der Wagen, der ihn so bedrängt hatte, wartete jetzt still vor der roten Ampel. Der Motor knurrte leise. Die Scheibenwischer wischten.
Ein anderer wäre nun zu diesem Wagen hingegangen, hätte mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen und vor Wut gebrüllt. Wegen Arschlöchern wie dir gibt es so viele Verkehrsunfälle, du Vollidiot! Schon mal was von Sicherheitsabstand gehört?
Ben tat nichts dergleichen.
Selber schuld, dachte er nur.
Was musste er auch zu einer fremden Frau fahren, mitten in der Nacht. Bei diesem Wetter.
So typisch.
Das passiert auch nur dir!
Und dann noch eine Schickse!
Die sinnlosen Beschimpfungen kamen von Ahnen, deren Namen Ben kaum kannte. Wie unzufriedene Abonnenten im Theater murrten sie in den Rängen.
Haben wir nicht genug gelitten?
Ben schämte sich. Mit Julia hatte er sich unverwundbar geglaubt. Er hatte vergessen, auf die Gefahren zu achten, die überall lauerten. In Osteuropa wurde geschossen. Die Welt stand am Abgrund. Und was tat er? Fuhr wie der letzte Idiot durch den Regen.
Kleinlaut rollte er die Vespa zum Straßenrand. Er fingerte eine Zigarette aus der offenen Packung. Dann erinnerte er sich wieder daran, dass er kein Feuer hatte. Wieso war er nicht zum Kiosk gefahren, um Streichhölzer zu kaufen? Dann wäre das alles nicht passiert.
Stumm sah Ben zu, wie die Ampel auf Grün schaltete. Der Wagen fuhr weiter. Der Mann am Steuer – jetzt sah Ben ihn zum ersten Mal, ein käsiges Allerweltsgesicht – unterhielt sich mit seiner Freundin, die neben ihm saß. Vielleicht besprachen die beiden einen anstehenden Urlaub. Oder das Abendessen. Ben, der zitternd im Nieselregen stand, beachteten sie mit keinem Blick.
Er nahm das Telefon aus der Tasche, wählte Julias Kontakt.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ich hatte einen kleinen Unfall.«
Hochstapler, dachte er. Es war ja gar kein richtiger Unfall. Er war von keinem Laster überrollt worden, hatte sich nichts gebrochen. Das Einzige, was ihm fehlte, war Feuer.
»Lass die Vespa stehen«, sagte Julia. Sie blieb ganz ruhig. »Ruf ein Uber, und komm zu mir.«
Ben fühlte sich, als hätte ein Sanitäter eine goldene Thermodecke um seine Schultern gelegt. Jemand wartete auf ihn in dieser kalten Nacht. Er war nicht allein.
3
»Man kriegt den Körper zwar aus dem Krieg, aber den Krieg kriegt man nicht so schnell wieder aus dem Körper.«
Das hatte Bens bester Freund Joachim einmal gesagt. Und der musste es wissen. Joachim litt seit Jahren an Panikattacken. So wie Moritz sich in der Dunkelheit vor Monstern fürchtete, fürchtete Joachim sich vor dem Leben. Vor dem Aufstehen am Morgen, vor dem Telefonat, das er erledigen musste, vor dem Einkauf, vor dem Abwasch, vor dem Verlust seiner Freunde, seines Jobs und seines Verstands.
Als Auslandskorrespondent des Schweizer Fernsehens hatte er aus Kabul berichtet, aus Grosny und Aleppo. Er hatte verkohlte Leichen gesehen und drogensüchtige Kindersoldaten. Jetzt fürchtete er sich beim Einkaufen vor dem Regal mit den Milchprodukten.
Immer wieder versuchte Ben seinem Freund klarzumachen, dass statistisch gesehen wenig passieren konnte beim Bifidus.
»Das weiß ich selber«, sagte Joachim dann. »Ich bin ja nicht blöd, ich hab bloß eine Angststörung.«
So wie es Moritz wenig half, wenn man ihm logisch erklärte, warum es keine Monster gab, nützte es auch dem erwachsenen Joachim nichts, von der Ungefährlichkeit seines Alltags zu hören. Sein Kopf verstand. Aber was hatte der zu melden? Es war ja der Körper, der nicht aufhören wollte, Alarm zu schlagen.
Ben war kein Hypochonder. Zumindest kein großer. Als er nun aber, noch immer unter Schock, mit der Vespa zu Julia fuhr, begann er sich ernsthaft zu sorgen. Was, wenn auch ihn der Schrecken nie wieder losließ? Die Aktivierung des sympathischen Nervensystems führte zu Bluthochdruck, was über längere Zeit Schlaganfall und Herzinfarkt nach sich ziehen konnte, das wusste er. Auch wenn der Ursprung längst vergessen war, konnte die Angst tödliche Folgen haben.
Je weiter Ben sich von der Unfallstelle entfernte, desto schlechter fühlte er sich. Die Stadt verschwamm in einem dumpfen Nebel. Nur noch die Straße vor ihm existierte. Meter um Meter fuhr er weiter. Immer langsamer. Der Schmerz nahm all seine Aufmerksamkeit in Beschlag.
Als Ben in Julias Straße einbog, eine Reihe schmucker, schlecht beleuchteter Jugendstilhäuser, zitterte er so sehr, dass er die Vespa auf dem Gehsteig abstellen musste. Die letzten Schritte ging er zu Fuß. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Als er die Klingel drückte, traten ihm Tränen in die Augen. Ein Summton. Fast war er da. Jetzt ließ die schwere Haustür sich endlich öffnen. Er betrat den kühlen, mit Fresken verzierten Eingang, stieg die Treppe hoch in die zweite Etage, wo Julia schon in der Türe ihrer Wohnung auf ihn wartete. Sie trug Trainerhosen und ein gestreiftes Pyjama-Oberteil. Ben ließ die schwere Tasche fallen und stürzte in ihre Arme.
»Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist«, sagte Julia.
Ben erzählte jetzt atemlos. Dass er weitergefahren war, obwohl sie ihm doch gesagt hatte, er solle ein Uber nehmen.
»Mein Liebster«, sagte sie. »Setz dich mal hin.«
Sie wollte seine Blessuren besichtigen.
Ben stöhnte, als er sich in das weiche Sofa sinken ließ. Er streckte Julia die Beine entgegen wie ein Kleinkind, das sich nass gemacht hat. Als sie ihm die Jeans abstreifte, jaulte er auf. Er fürchtete sich vor dem Anblick der offenen Wunde. Und je blutiger er sich das rohe Fleisch vorstellte, das gleich unter der zerfetzten Hose zum Vorschein kommen würde, desto schlimmer schien ihm alles. Als Julia ihn noch nicht einmal anfasste, litt er schon lautstark. Sie lachte, und Ben beruhigte sich langsam wieder. Der tatsächliche Schmerz, der beim vorsichtigen Abstreifen der Hose entstand, war vergleichsweise milde.
An Bens rechtem Knie war eine ordentliche Schürfung zu erkennen. Nichts, was das kindische Drama annähernd gerechtfertigt hätte, dachte er beschämt, aber doch wenigstens eine Verletzung, groß genug, um sich nicht als komplettes Weichei fühlen zu müssen.
Julia tupfte die Wunde ab. Sie desinfizierte sie und klebte ein Pflaster drauf, das sie für ihren Sohn im Badezimmerschrank aufbewahrt hatte. Prince war an diesem Abend glücklicherweise bei seinem Vater. So konnte Ben die Fürsorge seiner Freundin ganz für sich allein in Anspruch nehmen.
Das Pflaster, das jetzt auf seinem Knie klebte, war mit kleinen Dinosauriern bedruckt. Jetzt musste Ben doch auch ein wenig lachen. Julia kauerte sich neben ihm aufs Sofa. Immer wieder beugte sie sich zu ihm herunter und küsste ihn. Ihre Hand lag auf seiner Unterhose. Ihr Bauch lag auf seinem. Nichts war zwischen ihnen. Nur noch das lange Barthaar.
Ben träumte in dieser Nacht von Papageien. Aber er sah die Vögel nicht, es war nur das Wort, an das er sich erinnerte, als er am nächsten Morgen vom Alarm seines Telefons geweckt wurde.
Die Papageien von Petrópolis sind astreine Stabreimer, waberte es durch sein schläfriges Gehirn.
Am Tag davor hatte Ben eine Szene geschrieben, in der Stefan Zweig sich im brasilianischen Exil der Ornithologie widmet. Er beobachtet von seiner Terrasse aus Papageien und denkt dabei über den Weltfrieden nach.
Ben hatte eine klare Vorstellung von Petrópolis, der kleinen Stadt in der Nähe von Rio, in der Zweig sich niedergelassen hatte. Obwohl er selber nie dort gewesen war, kannte Ben sich aus im gemütlichen Bungalow an der Rua Gonçalves Dias, 34. Er hätte blind vom Schlafzimmer zur Terrasse gehen können. Wenn er beim Schreiben die Augen schloss, sah er Zweig auf der Veranda. Er begleitete ihn hinaus in das kleine, windige Café unten an der Straße. Er trank mit ihm den türkischen Kaffee, den Zweig so mochte.
Uta, eine Berliner Produzentin, die Ben sehr schätzte, hatte versprochen, das Drehbuch zu lesen. Sie kam extra nach Zürich, um darüber zu sprechen. Das war ein gutes Zeichen. Ben hoffte auf ein Angebot, das ihm helfen würde, die nächsten Monate finanziell über die Runden zu kommen.
Er setzte sich auf. Es würde ein anstrengender Tag werden. Nach Uta hatte er einen Krankenbesuch bei Joachim eingeplant und danach eine Mediation mit Marina. DasDinosaurierpflaster war durchgeblutet. Die nässende Wunde brannte. Und sein Rücken tat weh.
Neben dem Bett lag ein Fiebermesser. Hoffnungsvoll richtete Ben ihn gegen die Stirn. Das Resultat war ernüchternd: 36,7 Grad. Er musste aufstehen.
Auf dem Weg zur Küche trat er auf einen Playmobil-Piraten.
Prince, Julias Sohn, war zwar noch nicht im Kindergarten, dennoch fühlte Ben sich von ihm bedroht. Das Kind hatte kurze Beine und einen breiten Brustkorb. Man konnte erkennen, dass er mit etwas Training und richtiger Ernährung zu einem Gorilla heranwachsen würde. Ben beneidete den Jungen, der manchmal noch von Julias Brust trinken wollte, um dessen Physis. Wenn er mit schlackernden Ärmchen über den Spielplatz rannte, sah Ben schon den Mann in ihm.
Prince war, auch wenn niemand dies so direkt zu sagen wagte, Bens härtester Widersacher.
Obwohl Julia mit Phil, dem Vater des Buben, eine klare Regelung über die Betreuungszeit vereinbart hatte, ließ sie sich immer wieder zu Ausnahmen hinreißen. Dann entschied sie sich, kostbare Stunden, die eigentlich für Ben reserviert waren, mit ihrem Sohn zu verbringen.
Auch an diesem Morgen hatte Prince sich außerplanmäßig vorgedrängelt. Noch vor neunUhr wollte sein Vater ihn vorbeibringen.
Ein Mitspracherecht schien Ben in dieser Sache nicht zu haben.
Manchmal hatte er den Eindruck, dass Julia gar nicht bemerkte, wie sehr ihr Sohn über ihre Zeit verfügte. Und damit auch über die Zeit von Ben. Rücksichtslos zog der Junge jedes Register, um zu bekommen, was er wollte. Und das war oft mehr, als ihm zustand. Prince behauptete, krank zu sein, er jammerte und quengelte. Er schreckte nicht einmal davor zurück, ins Bett zu pinkeln. Manchmal schien es Ben, als würde der Vierjährige sich absichtlich kleinkindlich verhalten, um seine Ziele leichter zu erreichen. Julia ging dem manipulativen Jungen dabei immer wieder auf den Leim.
Ben konnte sich noch so viel Mühe geben. Er konnte den Jungen kitzeln, ihm ein Eis kaufen oder mit ihm Playmobil spielen. Nichts half. Früher oder später sagte Prince, was er wirklich wollte: Bens Tod.
»Warum bist du so dick?«, fragte Prince zum Beispiel einmal, als Ben in Badehosen neben ihm in einer Wiese lag.
»Ich bin dick, weil ich so viel esse.«