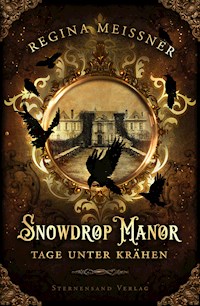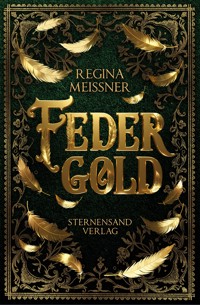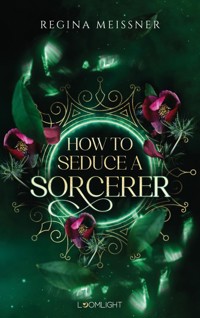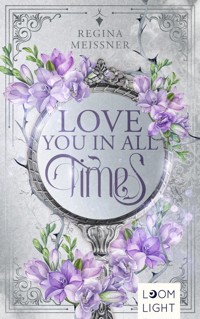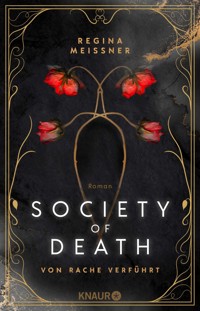
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Society of Death
- Sprache: Deutsch
Zwischen Liebe und Verrat: Dark Academia mit Romantic Suspense an der Elite-Uni Yale Ende des 19. Jahrhunderts »Von Rache verführt« ist der erste Band der Dilogie von Regina Meissners »Society of Death«. Yale University, New Haven, 1875: Der 22-jährige Medizinstudent Emery wird in der Tap Night gefragt, ob er Teil der geheimen Studentenverbindung Skull & Bones werden möchte. Als neues Mitglied, nun bekannt unter dem Namen Raven, sieht er sich einer schillernden, jedoch gefährlichen Zukunft gegenüber. Sein erster Auftrag als Teil der Bruderschaft führt ihn geradewegs in ein moralisches Dilemma: den Mord an Nathaniel, einem Stadtrat, der schließlich wie ein Suizid aussehen soll. Nathaniels Schwester Victoria, getrieben von Zweifeln an Nathaniels vermeintlichem Suizid, begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit – eine Suche, die sie schlussendlich zu Emery führt. Beide, verfangen in einem Netz aus Lügen, Rache und verbotener Liebe, stehen vor tiefgreifenden Entscheidungen. Victoria entdeckt die Wahrheit hinter dem Tod ihres Bruders und gemeinsam mit Emery strebt sie danach, deren gemeinsame Vergangenheit aufzuarbeiten und ein neues Leben fern des Einflusses von Skull & Bones sowie ihres mächtigen Vaters aufzubauen. Die perfekte Mischung aus düsterem Setting, Romantik, moralischen Dilemmata und mitreißender Spannung! Die historische Dark Academia Romance lässt dich hautnah an den mystischen Ritualen und dekadenten Festen einer der berüchtigtsten Studentenverbindungen aller Zeiten teilnehmen. Band 1 der New Adult-Dilogie begeistert mit folgenden Tropes: - Broken Hero - Enemies to Lovers - Fake Dating - Secred Identity - Dark Secrets - He falls first and harder - Forbidden Love - Dark Academia - Romantic Suspense Entdecke auch Regina Meissners historischen Liebesroman bei Knaur: - Die Duellantin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Regina Meissner
Society of Death
Von Rache verführt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Geheimbund Skull & Bones an der Elite-Uni Yale, dunkle Machenschaften und eine Liebe, die nicht sein darf
Yale University, 1875: Der 22-jährige Medizinstudent Emery wird in der Tap Night gefragt, ob er Teil der geheimen Studentenverbindung Skull & Bones werden möchte. Als neues Mitglied, nun bekannt unter dem Namen Raven, sieht er sich einer schillernden, jedoch gefährlichen Zukunft gegenüber. Sein erster Auftrag als Teil der Bruderschaft führt ihn geradewegs in ein moralisches Dilemma: den Mord an Nathaniel, einem Stadtrat, der schließlich wie ein Suizid aussehen soll. Nathaniels Schwester Victoria, getrieben von Zweifeln an Nathaniels vermeintlichem Suizid, begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit – eine Suche, die sie schlussendlich zu Emery führt. Verfangen in einem Netz aus Lügen, Rache und verbotener Liebe, entdeckt Victoria die Wahrheit hinter dem Tod ihres Bruders ...
»Dieses Buch ist wie ein Licht in der Dunkelheit – unverzichtbar und ergreifend. Zwischen menschlichen Abgründen, unverzeihlichen Geheimnissen und der Sehnsucht nach Neuanfängen habe ich mein Herz an Victoria und Emery verloren.« Kristin MacIver, Autorin
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Notes – Hinweis
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Leseprobe zu
Prolog
Kapitel 1
Danksagung/Nachwort
Liste sensibler Inhalte/Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Inhaltsverzeichnis
Für Lena.
Danke, dass du den Wahnsinn in mein Leben gebracht hast.
Alles ist schöner mit dir.
PS: Hubert ist Norberts bester Freund. Nicht du.
Für Mario, über den ich nicht eine schlechte Sache sagen kann.
Playlist
Hozier – Abstract (Psychopomp)
Lizzy McAlpine – Doomsday
Birdy – Your Arms
Fionn Regan – Dogwood Blossom
Noah Kahan – Fear of Water
Alex Helsby – Improper Goodbye
Moncrieff – How It Ends
Bon Iver – S P E Y S I D E
Coldplay – Til Kingdom Come
Nick Cave & The Bad Seeds, Kylie Minogue – Where the Wild Roses Grow
Wasia Project – Remember When
SYML – The White Light of the Morning
Tom Odell – Don’t Let Me Go
Band of Horses – The Funeral
Sufjan Stevens – Death with Dignity (Demo)
Agnes Obel – Familiar
Sleeping At Last – Saturn
Kapitel 1
Victoria
Das letzte Licht des Sommertages fiel durch die Fenster des Hörsaals und ließ feine Staubkörner auf dem Tisch vor mir tanzen. Meine Hand schmerzte vom minutenlangen Mitschreiben, Tintenflecken zogen sich über meinen Daumen. Ich legte die Stahlfeder zur Seite und streckte die Schultern durch.
Doctor Andrew Thorne, Mediziner und Dozent für Nervenkunde, stand seitlich der Tafel und deutete mit einem Stock auf das Bild, das er mit den Teilnehmern der Vorlesung erarbeitet hatte. Die Brille auf seiner Nase saß etwas schief; das graue Haar ging allmählich in eine Glatze über. Doch in seinen Augen lag ein Glanz, der ihn nahezu jung wirken ließ.
»Melancholie ist nicht bloß eine Trägheit unseres Gemüts. Sie ist vielmehr ein Zustand inneren Erleidens, den wir ergründen und verstehen müssen«, schloss er. Seine Stimme war von einem angenehmen Timbre, das tief in mir widerhallte. »Schon Hippokrates hat den Zustand der Schwermut als eine der vier Grundverfassungen der Seele beschrieben. Menschen, die zu dieser Gemütsart neigen, sind oftmals ernst, tiefgründig und nachdenklich.« Er ließ den Blick über die Menge schweifen. Ich hatte die Anwesenden gezählt, es waren vierundzwanzig, und mich darüber gefreut, dass wir die ersten vier Reihen des Vorlesungssaals vollständig füllten. Der letzte Vortrag zur Melancholie hatte nicht einmal fünfzehn Menschen angezogen. Vielleicht war das steigende Interesse ein Zeichen dafür, dass das Thema endlich die Aufmerksamkeit bekam, die es verdiente.
»Ein Mann, der von nachdenklicher Natur ist, muss nicht zwangsläufig in Melancholie verfallen.« Doctor Thorne rückte den Kragen seines Hemds zurecht. »Dennoch zeichnet sich in manchen Fällen eine Tendenz dazu ab, Gefühle zu intensiv zu empfinden. Dies mündet nicht nur in Hoffnungslosigkeit, sondern kann auch mit einer Verdüsterung des Gemüts und Symptomen wie Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit einhergehen.« Er räusperte sich. Doctor Thorne hatte sich auf dem Gebiet der Nervenkunde in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Ich war stolz darauf, dass wir ihn als Redner für den New Haven Circle for Mind Studies hatten gewinnen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte sein Name allein für einen Anstieg der Besucher gesorgt.
Obwohl die meisten Anwesenden Mitglieder des New Haven Circle for Mind Studies waren, entdeckte ich neue Gesichter in den Reihen. Einen älteren Mann mit Schnauzer und buschigen Augenbrauen ganz vorn. Vier junge Burschen hinter mir, bei denen es sich wahrscheinlich um Studenten des ersten Semesters handelte. Besonders freute ich mich jedoch über die brünette Frau, die eine Reihe vor mir saß und sich eifrig Notizen machte. Sie trug ein kariertes Kleid, das von schlichter Eleganz zeugte; im Haar eine weiße Schleife. In unregelmäßigen Abständen blickte sie sich um, fühlte sich offensichtlich in diesem Meer von Männern nicht besonders wohl.
Bleib stark. Irgendwann wird unsere Zeit kommen. Wir dürfen nur nicht aufhören, aufzutauchen. Uns zu zeigen. Teilzunehmen.
»Jeder Fall von Schwermut liegt individuellen Voraussetzungen zugrunde und muss deswegen auch einzeln betrachtet werden. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.« Doctor Thorne neigte den Kopf und klopfte sich den Kreidestaub von den Händen. Auf seiner Stirn stand ein feiner Schweißfilm, geboren von einem viel zu heißen Sommer, der sich in diesem Jahr endlos dehnte.
»Doctor Thorne.« Eine Hand wurde gehoben. Sie gehörte zu einem jungen Mann, der in der ersten Reihe saß. Pechschwarzes Haar, in der Mitte gescheitelt. Eine Jacke aus dunkelgrauer Wolle ließ seine Schultern breit wirken.
»Emery Grant ist mein Name. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen?«
»Natürlich.« Doctor Thorne zog sich einen Stuhl zurecht und nahm Platz. Der Kreidestaub, den er sich eben von den Händen geklopft hatte, fand den Weg auf seine Knie.
»Es steht nicht zum Besten um meine Mutter. Sie … nach einem Todesfall hat sie mit … Schwermut zu kämpfen.« Seiner Stimme hörte man an, wie viel Überwindung es ihn kostete, zu sprechen. Nervös räusperte er sich. »Wir sorgen uns um sie. Seit Wochen verlässt sie ihr Bett nicht mehr und nimmt am täglichen Leben kaum noch teil.« Er rutschte auf seinem Stuhl nach vorn. »Wir haben bereits einiges versucht …«
Doctor Thorne nickte ihm ermutigend zu.
»Frische Luft, Spaziergänge, Gespräche mit dem Arzt … Wir haben sogar ihre Kost umgestellt. Leider blieben alle Bemühungen wirkungslos.«
Eine zweite Hand hob sich; Doctor Thorne nickte einem Mann aus der Reihe hinter dem Dunkelhaarigen zu. »Jack Ferguson mein Name. Meinem Onkel erging es vor einem Jahr ähnlich. Ich …«
Emery Grant drehte sich um − und das war der Moment, in dem unsere Blicke sich das erste Mal trafen. Er hatte ein schönes, beinahe anmutiges Gesicht. Dichte Augenbrauen, lange Wimpern und einen feinen Bart über seiner Oberlippe. Seine Haut war blass, bildete einen markanten Kontrast zu seinem dunklen Haar. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er mich an, dann schenkte er seine Aufmerksamkeit dem anderen Studenten.
»Mein Onkel zog sich monatelang zurück. Er hütete das Bett und wurde von seinen bisherigen gesellschaftlichen Kontakten abgeschnitten. Auf diese Weise gelang es uns, seine emotionale Belastung zu mildern.«
»Es gibt durchaus Betroffene, denen es hilft, sich zurückzuziehen.« Doctor Thorne stand von seinem Stuhl auf und ging zur Tafel. Mit dem Zeigefinger deutete er auf das Wort Rückzug, das er während seines Vortrags notiert hatte. »Allerdings bedarf jeder Fall einer besonderen Betrachtung. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Mutter, Mister Grant.«
»Nun.« Emery richtete seinen Blick wieder nach vorn. »An manchen Tagen erscheint es mir, als wäre sie gar nicht mehr richtig da. Sie hat diese … leeren Augen. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es beschreiben soll.« Er schüttelte den Kopf. Das Sonnenlicht ließ sein schwarzes Haar beinahe glänzen. Unruhig trommelte er mit seinen Fingern auf das Pult vor sich. »Wir haben versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie nimmt uns kaum wahr. Manchmal höre ich sie weinen …«
In meiner Kehle bildete sich ein Kloß. Ich erlaubte meinen Gedanken jedoch nicht, sich in eine Richtung zu verlieren, aus der ich sie nicht mehr zurückholen konnte.
»Erzählen Sie mir von dem Ereignis, das Ihre Mutter in die Melancholie getrieben hat«, bat Doctor Thorne.
Emerys Körper spannte sich an. »Sehr gern, Doctor. Allerdings …«
»Sie müssen es nicht im Beisein der Anwesenden machen. Kommen Sie einfach im Anschluss auf mich zu.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank.« Hörte ich da ein Zittern in seiner Stimme?
Der Kaffee schmeckte bitter und war nicht mehr besonders warm. Ich griff nach einem Biscuit, um die beißende Note des Getränks loszuwerden und tupfte mir über die Mundwinkel.
»Doctor Thorne hat sich bereit erklärt, sich kommenden Dienstag noch einmal unseren Fragen zu stellen.« Henry Grey legte die Fingerspitzen aneinander. »Er gewährt uns eine Stunde, wir sollten vorher besprechen, welche Anliegen wir mit ihm klären möchten.«
»Werden wir uns hier mit ihm treffen?«, erkundigte ich mich.
Henry schüttelte den Kopf. »Er bot an, uns direkt im Versammlungshaus zu besuchen. Meine Notizen zu seinem Vortrag werde ich Ihnen vorab bereitstellen.«
Die Mitglieder des New Haven Circle for Mind Studies hatten sich in einem Halbkreis im Nebenraum des Hörsaals versammelt. Henry Grey bekleidete den Posten des Leiters, außer ihm waren wir sechs weitere – und ich die einzige Frau unter ihnen.
»Darüber hinaus habe ich ein interessantes Buch von einem französischen Autor gefunden. Die niedergeschlagene Seele. Ich werde es am Dienstag mitbringen.«
»Davon habe ich gehört.« Ich stellte meine Kaffeetasse auf dem Tischchen ab, das spärlich mit kleinen Stärkungen bestückt war. Die meisten Besucher griffen ohnehin nie danach, sondern gingen direkt nach den Vorträgen wieder ihrer Wege.
Anscheinend gehörte Emery Grant nicht dazu.
Die Tür zum Besprechungsraum wurde aufgestoßen. Orientierungslos sah Emery Grant sich um. Er wirkte fahrig, beinahe durcheinander.
Ich löste mich aus dem Kreis der Anwesenden. »Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Mister Grant?«
Die Erwähnung seines Namens ließ ihn den Kopf heben. Eine Sekunde sah er mich verwirrt an, dann zeichnete sich in seinen Augen ein Anflug von Erkenntnis ab.
»Ich muss Sie jedoch warnen: Er bereitet keinen besonderen Genuss.«
»Das werde ich überleben.«
Ich führte ihn zu dem Tisch mit der weißen Decke und goss eine Tasse Kaffee ein. »Bedienen Sie sich gern an den Biscuits«, forderte ich ihn auf, doch sein Blick blieb an mir hängen.
»Kenne ich Sie?«
»Nicht, dass ich wüsste. Mein Name ist Victoria Foster«, fügte ich mit einem Lächeln hinzu.
»Foster. So wie der Bürgermeister von New Haven?«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Dass man mich mit meinem Vater in Verbindung brachte, wenn man meinen Namen erfuhr, war die Bürde, die ich mit mir herumtrug.
»Und Sie sind Emery Grant«, lenkte ich das Thema daher auf ihn.
»Korrekt.«
»Studieren Sie an der Universität?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Das heißt, noch nicht. Ich habe vor wenigen Wochen die Zulassung für das Medizinstudium bekommen.« Seine Augen glänzten, und ich erkannte, dass mir seine Gesellschaft angenehm war.
»Medizin.« Ich stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Ein anspruchsvoller Studiengang.« Nicht, dass ich das aus erster Hand berichten konnte, doch das Medizinstudium in Yale galt als eines der schwierigsten in ganz Amerika.
Emery fuhr sich durch die Haare. »Machen Sie mir nicht noch mehr Angst, als ich ohnehin schon habe.« Sein Lächeln präsentierte mir zwei Reihen schneeweißer Zähne.
»Nicht doch.« Abwehrend hob ich die Hand. »Ich bin mir sicher, dass Sie das hervorragend bewerkstelligen werden. Wieso gerade Medizin?«
»Mein Vater arbeitet als Chirurg, doch das ist nicht der einzige Grund.« Ernsthaftigkeit schlich sich in seinen Blick. »So pathetisch es auch klingt, Miss Foster, ich möchte diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich möchte Menschen helfen. Einen Unterschied machen.«
»Das möchte ich auch.«
»Aus welchem Grund sind Sie heute hier?« In seinen Augen spiegelte sich aufrichtiges Interesse.
Mit dem Kinn deutete ich auf die sechs Männer neben uns. »Ich bin Mitglied des New Haven Circle for Mind Studies. Wir sind eine kleine Gruppe, die sich vor allem mit dem Gebiet der Nervenkrankheiten befasst. Wir möchten Betroffenen Hilfestellungen geben und Orte für sie schaffen, an denen sie keine Angst haben müssen, als wahnsinnig abgestempelt zu werden.« Ein Anflug von Stolz breitete sich in mir aus. Ich war noch nicht da, wo ich einmal sein möchte, doch in den letzten Monaten waren mir Dinge gelungen, die ich anfangs nicht für möglich gehalten hatte. Dass der New Haven Circle mich als Mitglied aufgenommen hatte, obwohl ich eine Frau war, gehörte ebenfalls dazu.
»Das ehrt Sie, Miss Foster. Wie kommt es, dass Sie sich gerade mit diesem Thema beschäftigen?« Emery Grant trank seinen Kaffee in einem einzigen Zug leer. Seiner Mimik war nicht zu entnehmen, ob er ihm schmeckte. Einen Moment zu lang schaute ich auf seine Lippen, an denen noch ein brauner Tropfen klebte, ehe ich mich auf seine Frage rückbesann.
»Wie wäre es, wenn wir uns draußen weiter unterhalten?« Mittlerweile dämmerte es; die Sonne schien nicht mehr durch die Fenster. Dennoch würde sich die Wärme weitere Stunden halten. »Es ist ein wenig stickig hier drin«, fügte ich entschuldigend hinzu.
An der Seite von Emery Grant verließ ich das Besprechungszimmer. Wir durchquerten den mit hellem Holz ausgekleideten Korridor und nahmen den Weg durch den Hintereingang. Als Frau war mir der Zugang zur medizinischen Fakultät eigentlich nicht gestattet, doch durch meine Rolle als Mitglied des Circles – vor allem aber als Tochter des Bürgermeisters – wurden mir besondere Privilegien zuteil.
»Endlich hat die drückende Hitze ein Ende gefunden.« Emery Grant richtete den Blick auf den Himmel. Eine Ansammlung von Wolken hatte die Sonne verdrängt. Vor uns breitete sich eine der Wiesen aus, die zum Campus gehörten. Ein Teil in mir wollte sich in das frische Gras setzen und ungezwungen mit Emery plaudern. Der andere besann sich meiner guten Manieren und deutete auf eine Bank im Schatten des Gebäudes.
»Mein Bruder«, knüpfte ich an unser Gespräch an, als wir nebeneinander Platz genommen hatten. »Er leidet seit Jahren unter Melancholie. Sie macht sich jedoch nur zeitweise bei ihm bemerkbar. Er hat gute Tage, teilweise Wochen, doch früher oder später fällt er in die Schwermut zurück.« Ich richtete den Blick in die Ferne, meine Hände im Schoß verschränkt. »Nathaniel ist sieben Jahre älter als ich, doch manchmal erscheint es mir, als wäre ich seine große Schwester. Ich spüre fortwährend den Druck, auf ihn aufpassen zu müssen.« Ich seufzte.
»Stehen Sie sich nah?«
»Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und mein bester Freund. Weswegen es umso mehr schmerzt, ihn leiden zu sehen.« Ich richtete den Blick auf Emery. »Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrer Mutter?«
Von jetzt auf gleich verschloss sich seine Miene. »Ich möchte ihr helfen. Unbedingt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es so etwas wie eine Heilung gibt.«
»Deswegen wurde der Circle gegründet. Weil zu wenige Gesellschaften existieren, die sich mit der Krankheit beschäftigen. Ein Großteil der Ärzte nimmt sie als solche nicht ernst. Die Kirche ist der Auffassung, dass Melancholie das Resultat einer schwachen Seele ist. Und dann gibt es noch die Menschen, die sie als Wahnvorstellungen abtun.« Ich blies mir eine Strähne meines blonden Haares aus der Stirn.
»Was wünschen Sie sich für Ihren Bruder, Victoria?«
Es war das erste Mal, dass er mich beim Vornamen nannte. Das erste Mal, dass er meinen Namen überhaupt aussprach. Normalerweise fiel es mir nicht schwer, Blickkontakt zu halten. Als Tochter eines Politikers hatte ich über die Jahre Bekanntschaft mit den unterschiedlichsten Menschen gemacht und wusste, wie man sich im Gespräch bestmöglich präsentierte.
Doch irgendetwas an Emery Grant ließ mich nervös werden und mich an ihm vorbei auf die Rasenflächen des Campus schauen.
»Ich wünsche mir natürlich, dass er wieder gesund wird. Aber ich glaube nicht an eine Wunderheilung über Nacht. Vielmehr erhoffe ich mir … Verständnis. Geduld. Weniger Vorurteile.«
»Ihr Bruder kann stolz sein, so eine Schwester zu haben.«
Emerys unerwartetes Kompliment trieb mir die Röte auf die Wangen. »Ich tue es ja nicht nur für ihn. Ich tue es auch für mich. Denn manchmal, wenn ich ihn allein auf dem Balkon sitzen sehe und er diesen abwesenden, abgekämpften Blick hat, da kommt es mir vor, als hätte ich ihn bereits verloren. Und so egoistisch es auch klingen mag: Ich vermisse den Mann, der er einst gewesen ist.«
»Und ich meine Mutter.« Emery rutschte einen Hauch näher an mich heran. Sein Oberschenkel streifte meinen. »Ich würde alles dafür tun, dass es ihr besser geht.«
»Dass Sie heute Abend hier waren, ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn Sie erst Ihr Medizinstudium aufnehmen, erhalten Sie Zugang zu Wissen, das mir verwehrt bleibt. Vielleicht machen Sie sich eines Tages ja sogar selbst einen Namen auf dem Gebiet.«
Emery grinste. »Sie halten ganz schön große Stücke auf mich.« Als er mich jetzt ansah, lag in seinem Blick etwas Kokettierendes.
»Ich zeige Ihnen lediglich Ihre Möglichkeiten.« Sosehr ich das Gespräch mit ihm genoss, regte sich in mir ein leiser Anflug von Enttäuschung. Wie gern wäre ich an Emerys Stelle. Würde im September das Studium anfangen, mich ausführlich mit medizinischen Themen beschäftigen, an wissenschaftlichen Diskussionen teilnehmen und irgendwann meinen Beitrag in dieser Welt leisen. Doch die Pforten der Yale University hatten sich für Frauen noch nicht geöffnet.
»Auf was freuen Sie sich besonders?«, fragte ich ihn – und genoss es, wie er mir mit Begeisterung von Innerer Medizin, Chirurgie und Pathologie erzählte. Von praktischen Übungen, ersten Erfahrungen in Krankenhäusern und dem Durchdringen der menschlichen Anatomie.
»Ich träume von einem Medizinstudium, seit ich ein kleiner Junge bin. In den letzten Jahren hat sich der Wunsch nur verstärkt.«
»Stammen Sie aus dieser Gegend?«
»Ich wohne in New York.«
»Ein Neuanfang also«, erkannte ich. »Ein neuer Wohnort, eine neue Umgebung …«
Emery nickte. »Ich kann es kaum erwarten. Heute Morgen habe ich mir die Universität angeschaut. Waren Sie schon einmal da?«
»Nicht überall. Aber ich kenne die medizinische Fakultät und die Bibliotheken.«
»Oh, die Bibliotheken!« Sein Blick wurde sehnsüchtig. »Mehr Bücher, als man in seinem ganzen Leben lesen kann. So viel Wissen, das schon verschriftlicht wurde – und ich muss nur danach greifen.« Sein Lächeln ließ Grübchen um seine Mundwinkel entstehen – ein Hinweis auf den Jungen, der er einst gewesen war.
»Wie alt sind Sie, Emery?«
»Zweiundzwanzig. Und Sie?«
»Einundzwanzig.«
»Wie lebt es sich als Tochter eines der mächtigsten Männer in New Haven?«
»Nicht unbedingt so, wie mein Vater es gerne hätte.«
»Ach nein?« Interessiert legte er den Kopf schief.
»Ich bin dem Circle beigetreten, um meinem Bruder zu helfen. Um besser zu verstehen, was in seinem Kopf vor sich geht. Sagen wir es so: Ich hatte mir mehr Unterstützung von meinem Vater erhofft.«
»Er tut Ihre Arbeit als Humbug ab?«
»Einen großen Sinn sieht er darin nicht. Er ist der Ansicht, dass ich meine Zeit lieber mit vernünftigen Dingen füllen soll.«
»Wie etwa ein Bild zu malen oder ein Taschentuch zu sticken?« Er trieb seinen Spott mit mir.
»Nein. Vielmehr eine gute Bürgermeistertochter zu sein. Ihn auf Empfänge und Reden zu begleiten. Vorzeigbar zu sein. Und in naher Zukunft zu heiraten. Im besten Fall einen Politiker, auf den er aktiv Einfluss nehmen kann.« Ich schnaubte.
»Haben Sie den Herrn schon kennengelernt?«
»Ich habe Dutzende von ihnen kennengelernt und sie alle in die Flucht geschlagen.« Das Lachen kam mir unsicher über die Lippen. »Ich werde mein Herz nicht an jemanden verschenken, nur weil mein Vater ihn als gute Partie erachtet. Nicht, wenn es in diesem Leben so viel Wichtigeres zu tun gibt.« Ich blickte in die anbrechende Dämmerung. Der frühe Abend war seit jeher meine liebste Zeit. Der Tag hatte sich noch nicht vollkommen verabschiedet, wurde aber bereits schläfrig und machte Platz für eine unbestimmte Nacht.
»Ist Ihnen kalt, Victoria?« Emerys Blick glitt auf meine Oberarme, auf denen sich der Hauch einer Gänsehaut abzeichnete. Bevor ich antworten konnte, war er schon aus seiner Jacke geschlüpft und hatte sie mir über die Schulter gelegt. Sein Geruch benebelte mich und machte mich für einen Moment unzurechnungsfähig. Unsere Blicke trafen sich, und ich musste mir eingestehen, dass er schöne Augen hatte. Sie waren von einem satten Braun, das mich an Karamell, vielleicht sogar an Bernstein erinnerte. Für einen Moment erlaubte ich mir, in ihnen zu versinken. Dann wurde ich auf ein Poltern aufmerksam, das aus dem Inneren des Gebäudes kam.
»Ich sollte wieder hineingehen. Einige Themen müssen noch besprochen werden. Morgen treffen wir uns mit Professor Stanley, der ein Experte auf dem Gebiet der Naturheilkunde und Physiologie des Nervensystems ist. Er wird uns einige Fragen beantworten und mit ein wenig Glück, können wir ihn vielleicht für einen Vortrag gewinnen.«
»Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.« Emery neigte den Kopf. Ich erhob mich. »Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mister Grant.« Kurz dachte ich darüber nach, wie ich mich von ihm verabschieden sollte, dann streckte ich ihm meine Hand entgegen.
Emery stand ebenfalls auf. »Die Ehre ist ganz meinerseits, Victoria.« Seine Finger schlossen sich um meine – und obwohl ich ihn gerade erst kennengelernt hatte, lag in der Geste etwas seltsam Vertrautes.
Dass ich noch immer seine Jacke trug, fiel mir erst auf, als ich in der Kutsche saß und mich auf dem Weg nach Hause befand.
Kapitel 2
Emery
Sechs Wochen. So lange dauerte es noch, bis ich endlich dazugehören würde. Bis ich mir nicht mehr wie ein Schaulustiger vorkam, sondern als Glied jenes ehrwürdigen Gefüges galt, das den Kosmos der Universität bildete. Sechs Wochen – dann würde ich mein Medizinstudium an einer der renommiertesten Universitäten Amerikas aufnehmen. Die vergangenen Monate hatte ich in ständiger Angst verbracht, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend geleistet zu haben und nicht das nötige Charisma mitzubringen.
Und doch war ich hier.
Ich legte den Kopf in den Nacken. Ließ das monumentale Universitätsgebäude auf mich wirken, das gleichzeitig einen ehrfurchtgebietenden, aber auch strengen Eindruck auf mich machte. Die hohen Fenster und steinernen Türmchen erinnerten an alte englische Universitäten, ein Symbol der Weisheit, von Generation zu Generation überliefert.
Eine Allee aus dichten Baumreihen führte direkt zum Campus, ein umzäunter, grüner Platz mit mehreren Gebäuden, die für unterschiedliche Zwecke genutzt wurden. Ich lief an der Connecticut Hall vorbei, die einst ein Studentenwohnheim gewesen war, heutzutage für Unterricht und Lehrstunden genutzt wurde. Die College Library wirkte eher unscheinbar, ein schlichtes Backsteingebäude mit klaren Linien und wenigen Verzierungen. Doch ich hatte sie mir bereits von innen ansehen dürfen: die holzvertäfelten Wände, vor denen sich massive Regale befanden, über und über mit Literatur gefüllt. Lange Lesetische luden zum Lernen ein; der Geruch alter Bücher schwelte in der Luft. Es kam einer Zerreißprobe gleich, nicht sofort mit dem Studieren beginnen zu dürfen. Sich eine wissenschaftliche Abhandlung über Medizin zur Hand zu nehmen und in altehrwürdigem Wissen zu versinken.
Doch bald war es so weit.
Sechs Wochen noch. Sechs Wochen, bis mein neues Leben endlich beginnen und ich meine Vergangenheit hinter mir lassen durfte. Tiefe Sehnsucht breitete sich in mir aus. Ich umklammerte den Griff meiner Ledertasche fester.
Auf den Grünflächen vor mir saßen Studenten auf Decken, beim Mittagessen, in Bücher oder in Gespräche vertieft. Das Sonnenlicht zeichnete ihre Umrisse weich. Nicht mehr lange, und ich würde einer von ihnen sein.
Endlich dazugehören.
Doch vorher hatte ich etwas anderes zu erledigen. Ich verließ den Campus und bog in die College Street, die mich zur Sheffield Scientific School führte. In einem der schlichten Gebäude hielt Professor Stanley heute einen Vortrag, zumindest hatte das meine Recherche ergeben. Und ich hoffte, dass nicht nur die Zeit, sondern auch das Schicksal auf meiner Seite war.
Denn ich wollte sie unbedingt wiedersehen. Unser Gespräch am vergangenen Abend hatte so abrupt geendet, dass es sich unvollständig anfühlte. Wie eine Geschichte, die jemand zu schreiben begonnen, aber mitten im Satz unterbrochen hatte.
»Verzeihung.« Ich hielt einen braunhaarigen Studenten mit Bowler an. Verwirrung zeichnete sich in seinem Gesicht ab, als er sich zu mir umdrehte.
»Ich suche Professor Stanley. Er soll heute hier einen Vortrag halten.«
»Oh, da war ich soeben. Du bist leider zu spät.« Mit seiner behandschuhten Hand deutete er auf die offen stehende Tür eines der Gebäude. »Wenn du dich beeilst, triffst du ihn vielleicht noch an.«
»Vielen Dank.« Ich neigte den Kopf, dann huschte ich an ihm vorbei. Nach und nach traten Studenten aus der Tür, redeten miteinander oder waren in ihre Aufzeichnungen vertieft. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können, doch von Victoria fehlte jede Spur. Weswegen ich zu einem der Fenster ging und ungeniert hineinstarrte: Im Vorlesungssaal befand sich noch etwa eine Handvoll Studenten – und ein älterer Mann mit Schnurrbart, den ich für Professor Stanley hielt. Er sammelte einige Papiere vom Schreibtisch auf und verstaute sie in seiner Tasche.
War ich zu spät gekommen? Oder hatte ich Victoria gestern nicht richtig zugehört und sie traf sich zu einer anderen Zeit mit dem Professor?
Eine Berührung an meiner Schulter ließ mich herumfahren. Sonnenlicht blendete mich, sodass ich für eine Sekunde blind war und meine Augen mit der Hand abschirmen musste.
»Habe ich mir doch gedacht, dass du es bist.«
Ich hörte ihre Stimme, bevor ich sie sah, doch kaum zeigte sich ihre Gestalt vor mir, machte mein Herz einen verräterischen Satz. Victoria Foster sah umwerfend aus. Ihre blonden Locken hatte sie zu einem Dutt gebunden, der die weichen Züge ihres Gesichts besser zur Geltung brachte. Sommersprossen zeichneten sich auf ihren Wangen und ihrer Nasenspitze ab.
»Victoria.« Ganz von selbst legte sich ein Lächeln auf meine Lippen. »Was für ein erfreulicher Zufall.«
»Emery Grant.« Sie streckte mir die rechte Hand entgegen. Mit der linken hielt sie einen Bücherstapel fest. »Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns so schnell wiedersehen. Was treibt sie an die Sheffield Scientific School?«
»Nun, es wird von mir erwartet, dass ich mir einen Überblick über die gesamte Universität verschaffe. Damit ich mich im September zurechtfinde.«
»Wie lange bleiben Sie noch hier?«
»Nur noch bis übermorgen. Dann fahre ich mit dem Zug zurück nach New York City. Waren Sie schon einmal da?«
»Ja, aber ich war vier Jahre alt und kann mich an nichts mehr erinnern. Bedauerlich, denn man hört viel Gutes über die Stadt.«
»Sie sollten mich dort mal besuchen«, schlug ich mutig vor, und als Victoria die Lippen schürzte, wusste ich nicht, wie ich ihre Reaktion deuten sollte. Sie trug ein braun kariertes Kleid mit weißer Bluse darunter, das mich an den Herbst, Lesestunden vor dem Kamin und buntes Laub im Central Park erinnerte. Ein Anflug von Heimweh ergriff mich.
»Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit. Mein Vater ist geschäftlich oft in New York. Nathaniel begleitet ihn manchmal.« Sie schnalzte mit der Zunge, dann schien sie etwas abzuwägen. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Emery?«
»Natürlich.« Victoria sah sich um, als fürchte sie, belauscht zu werden.
»Haben Sie manchmal Angst, dass Ihre Mutter Ihnen etwas verschweigt?«
»Wovon sprechen Sie?«
Sie ließ die Bücher von der einen in die andere Hand wandern. Victoria hatte schmale, gepflegte Finger, die darauf hindeuteten, dass sie in ihrem Leben noch keine schwere Arbeit hatte leisten müssen.
»Lassen Sie uns ein Stück gehen«, schlug sie vor. Gemeinsam ließen wir die Sheffield Scientific School hinter uns, nahmen den Weg zurück über die College Street und bewegten uns in Richtung des Campus vor. »Seit ich denken kann, ist Nathaniel die Person, der ich mich am nächsten fühle. Der große Altersunterschied hat nie ein Problem dargestellt. Wir konnten immer über alles reden.« Der Wind löste eine Locke aus ihrem Haar. Ich widerstand dem Impuls, sie ihr aus dem Gesicht zu streichen. Stattdessen vergrub ich meine Hände in den Taschen meiner Hose.
»Nathaniels Gesundheit will sich schon seit Längerem nicht bessern. Seine Schwermut trägt er schon einige Jahre mit sich herum.« Ihre Brust hob und senkte sich, als sie Atem holte. »Schon zu Beginn hat er mit mir über seine Gefühle gesprochen, auch wenn ich diese nicht immer verstand. Dennoch wusste ich, dass er mir gegenüber offen ist. Doch in letzter Zeit …« Sie sah mich von der Seite an. Ihre Augen hatten die Farbe des Himmels, kurz bevor ein Gewitter losbrach. »… er ist schweigsam geworden.«
Wir liefen an einer Kutsche vorbei und passierten einen Schreibwarenladen, in dessen Schaufenster sich Bleistifte, Tintenfässchen und eine Auswahl von besonders erlesenem Briefpapier befanden. Ich betrachtete den schwarzen Füllfederhalter, der mit goldener Schrift individuell graviert werden konnte. Meine Eltern suchten noch nach einem Geschenk zum Beginn meines Studiums – vielleicht wäre das eine Idee.
Erst als sich die Stille zwischen uns verdichtete, fiel mir auf, dass Victoria nicht mehr sprach und ich stehen geblieben war.
»Es tut mir aufrichtig leid«, beteuerte ich, doch auf ihren Lippen lag ein Lächeln.
»Nathaniel geht hier gern einkaufen. Das Geschäft führt eine große Auswahl an Farben und Leinwänden.«
»Ihr Bruder malt?«
Sie nickte. »Jegliches künstlerisches Talent, das an mir verloren gegangen ist, hat er geerbt. Seine Bilder sind wunderschön und voller Tiefe, aber sie machen mir auch ein wenig Angst.« Victoria lehnte sich gegen die Hauswand neben dem Schaufenster.
»Wieso das?«
»Weil ich sie nicht verstehe und er sie mir auch nicht immer erklären möchte. Da ist so viel Schönheit auf seinen Leinwänden, aber auch Schrecken. Dunkle Himmel, Blitz und Donner, Abgründe …« Sie schüttelte den Kopf. »Vielleicht zeigt er auf seinen Gemälden all das, was er mir nicht sagen kann.«
»Meine Mutter spricht auch nicht mit mir«, knüpfte ich an das an, was sie eben gesagt hatte. »Wahrscheinlich, weil sie mich nicht belasten möchte. Doch dadurch fühle ich mich von ihr entfremdet. Ich glaube, sie sieht in mir immer noch den kleinen Jungen von damals.«
»Und Ihr Vater?«
Ich schnaubte, dabei wollte ich ihn nicht verurteilen. Ein jeder Mensch ging anders mit Trauer um, das hatte ich in den letzten Jahren lernen müssen. »Er versteht seine Frau noch weniger als ich. Ich … wünschte mir, er würde mehr für sie tun. Stattdessen stürzt er sich in seine Arbeit. Manchmal sehe ich ihn tagelang nicht.« Ich presste die Lippen aufeinander, merkte, wie ich wütend über etwas wurde, an dem ich nicht ganz unschuldig war.
»All das … ist auch nicht leicht zu verstehen.« Wir setzten unseren Weg fort. »Was mich am meisten herausfordert, ist die Tatsache, dass sich die Schwermut bei Nathaniel in so unterschiedlichem Ausmaß zeigt. Es gibt Tage, an denen ich beinahe glaube, dass er es geschafft hat. Aber früher oder später kommt der Dämon zurück.«
»Der Dämon?« Ich hob die Augenbrauen.
»So nennt Nathaniel es manchmal. Er hat auch ein Bild von ihm gemalt.« Ihr Gesicht verwandelte sich in eine starre Maske. »Er meinte, dass man seine Dämonen nie vollständig loswird, diese aber nicht immer die gleiche Macht über einen haben. An guten Tagen beobachtet der Dämon Nathaniel bloß aus der Ferne, an sehr guten zeigt er sich gar nicht. An schlechten wiederum …«
»… sitzt er ihm direkt auf der Schulter und flüstert ihm Lügen ins Ohr?«
»Ja. Mittlerweile glaube ich, dass man weniger nach einem Weg suchen muss, den Dämon zu töten, als vielmehr eine Möglichkeit schaffen sollte, mit ihm zu leben.« Victoria stolperte über eine leere Bierflasche, die jemand am Straßenrand abgestellt hatte. Im letzten Moment hielt sie sich an meinem Arm fest.
»Vorsichtig«, murmelte ich, während ich sie ungelenk auffing. Verlegen räusperte sie sich. »Worauf ich eben hinauswollte, Emery …« Nun sah sie mich geradewegs an, und zum ersten Mal erlaubte ich mir einen offenen Blick in ihr Gesicht.
»Haben Sie manchmal Angst, dass Ihre Mutter … eine Dummheit begehen könnte?«
»Eine Dummheit?« Kaum hatte ich die Frage zu Ende formuliert, verstand ich, was sie meinte. »Sie sprechen von … Selbstmord?« Allein die Vorstellung machte mich schwindlig. Vielleicht schob ich den Gedanken deswegen weit von mir weg. »Auf keinen Fall. Das würde sie niemals tun.«
»Wie können Sie sich da so sicher sein? Selbstmord ist leider in nicht wenigen Fällen eine Folge von …«
Vehement schüttelte ich den Kopf. »So schlecht geht es ihr nicht.«
Schweigen breitete sich zwischen uns aus. Victoria blickte auf den Boden und registrierte gar nicht, dass wir den Campus bereits erreicht hatten. Ich wollte sie aufmuntern, doch das Einzige, das mir einfiel, war: »Ist es möglich, dass Sie noch meine Jacke haben?«
Sie hob den Kopf. »Die Jacke, die Sie mir gestern Abend über die Schulter gelegt haben? Denkbar, dass sie sich noch in meinem Besitz befindet.« Um ihre Mundwinkel legte sich ein neckischer Zug.
»Es war das Weihnachtsgeschenk meiner Großmutter.«
»Wie überaus großzügig.« Sie grinste mich an. »Wollen Sie es wiederhaben, Emery Grant?«
»Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Sagen Sie mir einfach, wo ich es abholen …«
»Kennen Sie den Crimson Parlor in der Chapel Street?«
»An diesem Ort befindet sich meine Jacke?«, feixte ich.
»Ja. Das heißt, sie wird sich dort befinden. Heute Abend um acht Uhr. Aber seien Sie pünktlich. So ein schönes Stück ist schnell vergriffen.« Eine sanfte Röte überzog ihre Wangen. »Es war mir erneut ein Vergnügen, Emery.« Mit diesen Worten verschwand sie über den Campus in Richtung Stadt. Ich blickte ihrer Gestalt noch hinterher, als sie gar nicht mehr zu sehen war. Dann lächelte ich wie ein Dummkopf in mich hinein.
Einer meiner zukünftigen Kommilitonen zeigte mir den Weg zum Crimson Parlor, bei dem es sich um eine Art Saloon handelte, in dem die Studenten ihre Abende bei einem Glas Whiskey und musikalischer Unterhaltung ausklingen ließen.
Die Stimmung war ausgelassen, als ich das Etablissement betrat. Mir schlug der Geruch nach Zigarrenrauch und fremden Parfüms entgegen. Der Innenraum desCrimson Parlors bestand aus mehreren Holztischen, die in regelmäßigen Abständen zueinander standen und ausnahmslos alle besetzt waren. Ein Mann spielte eine beschwingte Melodie auf einem Klavier. Das Herzstück des Saloons stellte jedoch die breite Theke dar – und die Wand dahinter, die mit diversen Flaschen an Alkohol ausgestattet war. Mit Müh und Not gelang es mir, Victoria und mir zwei Hocker zu reservieren. Auf einem nahm ich Platz und bestellte ein Glas Whiskey beim Schankwirt. Von Victoria fehlte jede Spur, aber ich war – wie es meinem Naturell entsprach – beinahe eine halbe Stunde zu früh.
Genüsslich leerte ich das Glas in einem einzigen Zug. Mein Vater sah es nicht gern, wenn ich Alkohol trank – auch mit meinen zweiundzwanzig Jahren erachtete er mich als zu jung dafür. Doch seine eigene Sammlung hatte mich in der Vergangenheit schon schwach werden lassen.
Ich ließ den Blick über die Gäste schweifen, junge Männer, die lautstark lachten, miteinander redeten und den Abend genossen. Bald würde ich dazugehören. Ein Teil von ihnen werden. Anschluss finden.
Die bloße Aussicht darauf rührte mich. Zu Hause in New York gab es niemanden, den ich wahrhaftig als Freund bezeichnen würde. Wie einsam ich mich tatsächlich fühlte, wurde mir erst jetzt, da ich die anderen Gruppen sah und allein an der Theke saß, bewusst. Ich umklammerte mein Whiskeyglas. Mit einem Zeichen gab ich dem Schankwirt zu verstehen, es mir erneut aufzufüllen.
Da öffneten sich die breiten Türen des Saloons. Noch bevor Victoria das Crimson Parlor betrat, wusste ich, dass es sich um sie handelte. Es war ein inneres Gefühl, das sich in mir ausbreitete, eine Intuition vielleicht. Oder ich erkannte sie daran, dass mein Herz auf einmal raste.
Wenn ich in den letzten vierundzwanzig Stunden eine Sache über Victoria Foster gelernt hatte, dann die, dass sie sich gern an Orten aufhielt, die für gewöhnlich Männern vorbehalten waren. Dass sie sich darüber hinaus keine Gedanken zu machen schien, welchen Eindruck ihr Auftreten bei den Anwesenden hinterließ. Dass sie sich generell wenig um die Meinung der Menschen scherte.
Das gefiel mir.
Mindestens so sehr wie das Kleid, das sie unter meiner grauen Jacke trug, die sie sich locker über die Schultern gelegt hatte. Es war aus dunklem Purpur und endete kurz unter ihrem Knie, während es hinten den Boden berührte. Auf Höhe der Taille wurde es von schwarzen Bändern zusammengehalten. Victoria trug ihr blondes Haar offen und ungezähmt. In wilden Wellen fiel es ihr über die Schultern hinab und reichte fast bis zu ihrer Hüfte.
Sie sah hinreißend aus.
Die Tatsache, dass sie hergekommen war, um mich zu treffen, ließ mich beinahe so etwas wie Stolz empfinden. Ich hob die Hand, denn mein Räuspern hörte man über das Gerede der anderen nicht. Victoria kam auf mich zu und ließ sich auf den freien Hocker neben mir nieder.
»Guten Abend, Emery Grant«, grüßte sie mich neckend. In einer einzigen, fließenden Bewegung legte sie mir die Wolljacke auf den Schoß. »Danke, dass ich sie mir ausleihen durfte.«
»Es ist schön, Sie zu sehen. Was darf ich Ihnen bestellen?«
Ich fragte mich, ob sie sich der Blicke der anderen Männer bewusst war. Ob es ihr etwas ausmachte, dass sie die einzige Frau war und wie selbstverständlich im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Doch als sie an ihrem Punsch nippte und wir ganz natürlich dort anknüpften, wo wir heute Nachmittag aufgehört hatten, glaubte ich, dass es ihr gleichgültig war.
Gleichgültig … oder eine Art Rebellion gegen das Leben, das sie als Bürgermeistertochter führen musste? Ich kannte sie nicht gut genug, um das sagen zu können.
Aber bei Gott, ich wollte sie so gern näher kennenlernen. Victoria Foster verzauberte mich. Jedes Mal, wenn ich sie traf, zeigte sie mir eine neue Facette von sich – ich war neugierig darauf, welche Geheimnisse sich noch hinter ihren kirschroten Lippen verbargen.
»Womit haben Sie heute Ihren Tag verbracht?« Victoria drehte ihren Hocker in meine Richtung, sodass wir uns gegenübersaßen.
»Ich habe mir das Wohnheim angeschaut, in dem ich mir ab September ein Zimmer mit anderen Studenten teile. Außerdem war ich kurz in der Bibliothek. Und Sie?«
»Ich hatte gehofft, noch einmal mit Nathaniel reden zu können, aber seine Arbeit spannt ihn sehr ein.« Victorias Lippen schlossen sich um das dickwandige Glas.
»Als was arbeitet er?«
»Er ist Stadtrat, also ebenfalls in der Politik tätig. Meinem Vater war es wichtig, dass sein einziger Sohn in seine Fußstapfen tritt.«
»Eine Stelle, die mit viel Verantwortung verbunden ist.«
»Er ist nicht besonders glücklich darüber.«
»Wieso nicht?«
Victoria seufzte und schwieg. Drang ich mit meinen Fragen zu sehr in ihre Privatsphäre ein?
»Nathaniel hat sich von jeher aus freien Stücken nur wenig für die Politik interessiert. Mein Vater ließ ihm allerdings keine andere Wahl. Schon früh nahm er ihn auf Bankette und Reden mit. Die Position des Stadtrates ist nicht nur mit Verantwortung, sondern auch mit Prestige verbunden. Eine Stelle, über die sich viele weniger begüterte Männer freuen würden. Aber mein Bruder …«, ihr Blick verlor sich im Boden ihres Glases, »passt nicht in diese Welt.«
»Was wäre er geworden, wenn er frei hätte entscheiden dürfen?«
Victoria lächelte leicht. »Darüber haben wir erst gesprochen. Er hätte gern etwas Künstlerisches gemacht, eventuell Bildhauerei. Nathaniel hatte schon immer diese filigranen, feingliedrigen Finger. Wo ich nicht einmal einen Pinsel halten kann, macht er aus einem Stein ein Kunstwerk.« Ich beobachtete sie, wie sie das Glas leer trank und es auf der Theke abstellte. Die Gespräche mit Victoria fühlten sich ungezwungen und natürlich an. Beinahe so, als würde ich sie schon sehr viel länger kennen als die wenigen Stunden, die uns verbanden.
»Was starren Sie mich so an, Emery?«
Ich durchforstete mein Gehirn nach einer geistreichen Antwort, doch ihr Augenaufschlag machte es schwierig, nicht vollkommen den Verstand zu verlieren. »Sie sehen bezaubernd aus«, war alles, was mir einfiel.
Das Lächeln auf ihren Lippen vertiefte sich. Ihre Wangen färbten sich zartrosa. Unsere Knie berührten sich ganz sacht, und doch spürte ich ihre Wärme überall auf meiner Haut.
Der Mond stand bereits am Himmel, als wir das Crimson Parlor verließen. Auf die Frage, ob ihr Vater sie nicht allmählich vermisste, hatte Victoria mit einer wegwerfenden Handbewegung reagiert.
»Ich habe ihn seit Tagen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Irgendwann hat er aufgehört, mich über seine Pläne zu informieren. Vielleicht bereitet er gerade eine Rede vor oder ist bei Nathaniel im Rathaus. Oder …«, sie zog die Schultern hoch, »er tut etwas zu seinem Vergnügen, wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, was das sein könnte.«
Auf einem Platz in der Nähe des Saloons warteten zwei Kutschen. Ich deutete Victorias Blick richtig.
»Wie weit haben Sie es bis nach Hause?«
»Mit der Kutsche zehn Minuten. Zu Fuß etwa eine halbe Stunde.«
Ich warf einen Blick gen Himmel, der friedlich anmutete. »Das Wetter scheint sich zu halten. Darf ich Sie nach Hause bringen?« Es kostete mich Mut, ihr meinen Arm entgegenzustrecken. Die Angst vor Zurückweisung begleitete mich wie ein zweiter Schatten. Umso mehr freute es mich, als sie bereitwillig danach griff.
»Liebend gern, Emery.«
»Möchten Sie wieder meine Jacke haben?«, schäkerte ich.
»Heute Nacht gehört sie Ihnen«, gestattete sie mir großzügig.
Es fühlte sich berauschend an, mit Victoria Foster durch die abendlichen Straßen New Havens zu flanieren. Den Campus hinter uns zu lassen und sich in Richtung des East-Rock-Viertels zu bewegen, wo die Villa des Bürgermeisters stand. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto ruhiger wurde es. Begegneten wir in der Nähe des Crimsons Parlors noch Studenten oder wichen Pferdekutschen aus, hielt sich im East-Rock-Viertel keine Menschenseele mehr auf den Straßen auf. Vereinzelte Laternen wiesen uns den Weg vorbei an gepflegten Vorgärten, pittoresken Wohnhäusern und weitläufigen Grundstücken. Wer hier lebte, besaß Geld. Victorias Vater war wahrscheinlich einer der reichsten Menschen der Stadt.
Während wir nebeneinanderher liefen und in einvernehmlichem Schweigen versanken, betrachtete ich ihr Profil. Die winzige Nase, die kaum aus dem Gesicht heraustrat. Die dichten Wimpernkränze um ihre Augen. Ihr langer, schlanker Hals.
Obwohl wir nicht mehr miteinander sprachen und jeder seinen eigenen Gedanken nachhing, genoss ich ihre Gegenwart. Wäre sie fremd in der Stadt, würde ich sie über einen Umweg zur Villa das Bürgermeisters führen. Um noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen zu können.
Viel zu früh erreichten wir das imposante Gebäude, das das Herzstück des East-Rock-Viertels darstellte. Sandfarbener Backstein, mehrere Stockwerke hoch, ein steil abfallendes Dach mit Schieferplatten. Das Anwesen von Victorias Familie lag hinter einem schmiedeeisernen Zaun, der den Blick auf einen prächtigen Garten bot, welcher mit Fackeln erhellt war. Hinter zwei der unzähligen Fenster brannte Licht.
Ihr Gesicht lag im Schatten, als sie das Gartentor öffnete. Ich wartete auf den Moment, in dem sie das Grundstück betrat und unsere Geschichte ihr Ende nahm.
Stattdessen blieb sie stehen, das offene Tor wie ein stummes Mahnmal vor uns.
»Emery.« Ihre Stimme war nur ein Flüstern in der Sommernacht. »Ich habe die Zeit mit Ihnen sehr genossen. Mir ist bewusst, dass Sie in New York leben und erst in ein paar Wochen wiederkehren, aber was halten Sie davon, wenn …« Sie brach ab.
»Was möchtest du mir sagen, Victoria?« Ganz bewusst wechselte ich in die persönliche Anrede, weil sich dieser Moment zu intim anfühlte, um ihn auf Distanz zu verbringen. Mutig griff ich nach ihrer Hand.
»Ich würde gern mehr über dich erfahren«, sagte sie schließlich. Ich wollte etwas erwidern, doch sie kam mir zuvor. »Wir könnten uns Briefe schreiben in den kommenden Wochen. Und wenn du offiziell als Student zurückkehrst, sehen wir uns wieder.« Sie atmete tief durch. »Sofern du das möchtest.«
Oh, wenn sie wüsste, wie sehr ich mir genau das wünschte! Wie heftig mein Herz jetzt schon schlug, wenn sie mich mit diesem eindringlichen Blick ansah.
Sollte ich mutig sein? War es zu früh, ihr meine Zuneigung zu zeigen?
Aber bereuten wir am Ende nicht immer die Dinge, die wir nicht getan hatten?
Ich ließ ihre Hand los und trat noch einen letzten Schritt auf sie zu. Wir waren uns nun so nah, dass sich unsere Gesichter beinahe berührten. Victorias Lippen bebten. Mit dem Finger strich ich über ihre Wange bis zum Muttermal an ihrem Kinn. Etwas schien in mir zu erwachen, zart und kaum wahrnehmbar. Es war mit einem warmen Gefühl verbunden.
Erschrocken sah sie mich an, überrascht von meinem Vordringen. Ich würde sie nicht küssen, wenn sie nicht bereit war. Wenn sie Angst hatte oder es ihr zu schnell ging.
Victoria gab mir auch so schon alles, was ich brauchte.
Und dann … gab sie mir noch ein bisschen mehr.
Sie stellte sich auf die Zehnspitzen und legte ihre Hände auf meine Schultern. Neigte den Kopf kaum merklich, schloss die Augen und legte ihre Lippen auf meine.
Nie zuvor hatte ich mich derart lebendig gefühlt.
Kapitel 3
Emery
Zarte Schneeflocken rieselten auf meine Nase. Ich drehte mich einmal um die eigene Achse, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen offen auf das Schneegestöber gerichtet. Der Zauber des Winters würde nicht mehr lange anhalten. Schon jetzt zeigten sich die ersten Frühlingsboten. Vielleicht war dies der letzte Schneefall, bevor es endgültig wärmer wurde.
Ich zog mir meine Mütze tiefer ins Gesicht und stopfte den Schal in den Kragen meines Mantels. Ohne den Schnee wäre es stockdunkel gewesen, doch das Weiß der Flocken vertrieb die Düsternis des Abends.
»Wie lange möchtest du noch wie ein Narr im Schnee tanzen?« Henrys Stimme schallte zu mir herüber, doch er klang nicht aufgebracht, eher belustigt. Schweren Herzens wandte ich mich von dem Naturspektakel ab. Henry hatte The Quiet House, die Taverne in der Court Street, bereits erreicht und hielt mir die Tür auf. Ich stapfte durch den Schnee auf ihn zu.
»Hast du an das Geschenk gedacht?« Er hob die Augenbrauen.
Ich klopfte bestätigend gegen meine Ledertasche, dann schob ich mich an ihm vorbei durch die Eingangstür des Quiet House. An einem Mittwochabend musste man sich nicht darum sorgen, einen Platz zu finden. Ein Großteil meiner Mitstudenten befand sich bereits in ihren Zimmern und ging den Lernstoff des Tages durch.
»Ist er schon da?«, fragte ich Henry, der die Tür hinter uns schloss. Warme Luft schlug mir entgegen, die im Gegensatz zu den eisigen Temperaturen stand, die draußen herrschten. Ich nahm die Mütze vom Kopf, strich den geschmolzenen Schnee aus meinem Haar und hing meinen Mantel an einen Garderobenhaken an der Wand.
»Dort hinten.« Henry deutete auf einen groß gewachsenen Studenten, der an einem Holztisch in der Ecke saß. Er blätterte desinteressiert in einem Buch, vor ihm stand ein Krug Bier.
Ich wartete, bis Henry seinen Mantel ebenfalls verstaut und seine Stiefel abgeklopft hatte, dann schlängelte ich mich an den spärlich besetzten Tischen im Mittelraum vorbei. In der Luft hing der Geruch nach Ale und Tabak; schon jetzt war mir viel zu warm.
Etwa zwei Fuß vor Samuels Tisch blieben wir stehen. Henry gab mir ein Zeichen, woraufhin ich das in braunes Packpapier eingeschlagene Geschenk aus meiner Tasche holte. Das Rascheln des Papiers ließ Samuel den Kopf heben. Verwirrt rückte er seine Brille zurecht, dann kräuselten sich seine Lippen zu einem Lächeln.
»Da seid ihr ja.« Um seine Augen bildeten sich kleine Falten. Er trug ein graues Sakko aus Wolle, das mit einem Samtkragen verstärkt und von einer karierten Weste ergänzt wurde.
»Verzeih die Verspätung.« Henry zog sich einen der Stühle zurecht und ließ sich unter einem Seufzen sinken. »Unser Freund Emery war zu beschäftigt damit, Schneekönigin zu spielen.«
Ich grinste, während sich ein warmes Gefühl in mir ausbreitete. Henry hatte mich seinen Freund genannt. Nicht nur einen Mitstudenten, ein bekanntes Gesicht aus der Vorlesung, sondern tatsächlich einen Freund. Das, was ich mir so sehr für mein Studium gewünscht hatte, war eingetroffen. Ich hatte Freunde gefunden.
Ich setzte mich zu den zweien und schob Samuel sein Geschenk über dem Tisch entgegen. »Ich bin gespannt, was du dazu sagst.«
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.« Henry drückte Samuel die Schulter, woraufhin sich das Lächeln auf dessen Gesicht vertiefte. Seine Augen waren von einem so tiefen Blau, wie ich es selten gesehen hatte, und passten zu seinem nachdenklichen und stillen Charakter.
Samuel und Henry kannten sich bereits aus der Zeit vor dem Studium, sie hatten im selben Viertel in Providence gelebt. Es fühlte sich wie ein Privileg an, Teil ihrer Gruppe sein zu dürfen.
Samuel riss das Packpapier auf und förderte den schwarzen Füllfederhalter zutage, auf dem sein Name eingraviert war. Nachdem ich ihn vor ein paar Monaten mit Victoria im Schreibwarengeschäft gesehen hatte, war er mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Nach langem Überlegen hatten Henry und ich uns daher für ein Präsent entschieden, das sowohl ästhetisch war als auch einen praktischen Nutzen hatte.
»Jetzt kannst du dir endlich anständig Notizen in den Vorlesungen machen und musst dir nicht länger mein Schreibwerkzeug leihen«, scherzte Henry. »Das Lernen ersetzt dir der Stift allerdings nicht«, fügte er mit Blick auf das Anatomiebuch hinzu, in dem Samuel eben gelesen hatte. Der Gedanke daran, dass wir in wenigen Tagen eine Prüfung schrieben und ich mir den Stoff erst sporadisch angesehen hatte, schob ich zur Seite. Heute Abend brauchte ich eine Auszeit vom ständigen Lernen. So sehr ich es mochte, mir neues Wissen anzueignen, so sehr ich eines Tages ein guter Arzt werden wollte – heute stand mir einzig der Sinn danach, die Gemeinschaft meiner Freunde zu genießen.
»Herzlichen Dank.« Samuel sah uns nacheinander an. »Ein wahrhaft erlesenes Schreibinstrument.« Mit dem Zeigefinger fuhr er über die Gravur, die uns eine Stange Geld gekostet hatte.
»Was darf ich euch zu trinken bringen?«, fragte er dann. »Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Unverfrorenheit, dass ich bereits ohne euch angefangen habe.«
»Ich nehme ein Bier«, bestellte ich, was Henry mit einem Nicken bestätigte. »Für mich auch.« Samuels Stuhl schabte über den Holzboden, als er sich erhob. Hinter ihm an der Wand hingen Landschaftsgemälde und Artefakte der Universität Yale. Eine Erinnerungsstrecke, die die Entwicklung der Taverne in den letzten Jahren zeigte. Gaslampen auf den Tischen sorgten für eine gemütliche und einladende Stimmung.
Samuel kam mit zwei gefüllten Krügen und einer Platte mit Brot und Käse zurück an unseren Tisch. Mein Magen, der seit heute Mittag bis auf eine Handvoll Nüsse nichts mehr bekommen hatte, meldete sich prompt. Gierig griff ich nach einer mit Butter bestrichenen Scheibe Brot und biss hinein. Krümel bröselten auf den Tisch.
»Wie fühlt man sich mit zweiundzwanzig Jahren?«, fragte Henry. Da unser Tag voller Vorlesungen und Seminaren gewesen war, hatten wir noch keine Gelegenheit gehabt, uns auszutauschen.
Samuel trank sein Bierglas leer und wischte sich den Schaum von den Lippen. »Nun, ich bin über Nacht zu einer Weisheit gelangt, die du mit deinen einundzwanzig Jahren nur schwer nachvollziehen kannst.« Mit einem dramatischen Augenrollen wandte er sich an mich. »Welch Erleichterung, dass du mein Alter bereits erreicht hast und verstehst, wovon ich spreche.«
»Oh, durchaus.« Ich verschluckte mich an meinem Stück Brot und hustete. »Mit zweiundzwanzig startet man in ein vollkommen neues Zeitalter. Die Jahre davor erscheinen auf einmal so profan … beinahe banal.« Samuel fiel in mein Gelächter mit ein. Auf Henrys genervten Blick hin sagte ich: »Noch zwei Monate und du hast es ebenfalls geschafft.«
»Ich kann es kaum erwarten«, murmelte er in sein Bier hinein und schaute missbilligend. Ich lehnte mich auf meinem Holzstuhl zurück und betrachtete die beiden. Henry und Samuel waren in den vergangenen fünf Monaten zu meinen Vertrauten geworden. In ihrer Gegenwart machte nicht nur das Studieren, sondern auch das Leben Spaß.
Als ich im September nach New Haven gekommen war, um mein Studium der Medizin aufzunehmen, hatte ich mir drei Dinge vorgenommen.
Erstens: Ich wollte Freunde finden. Eine Gruppe Menschen, der ich mich zugehörig fühlte. Die mich annahmen, wie ich war, und auch meine Schwächen akzeptierten. In New York war ich der Außenseiter gewesen; eine Rolle, in die ich nie mehr zurückwollte.
Zweitens: Ich sehnte mich nach einem Neuanfang. Wollte meine Vergangenheit und das, was in den letzten Jahren geschehen war, hinter mir lassen. Abstand von meinen Eltern haben und mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren. Vor allem aber wollte ich den Ereignissen früherer Tage keine Macht mehr über mich geben. Denn ich glaubte fest daran, dass jeder eine zweite Chance verdiente.
Drittens: Ich wünschte mir, dass das zwischen Victoria und mir nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft blieb, sondern mehr daraus wurde. Während der Wochen in New York waren wir über Briefe in Kontakt geblieben: Sie schrieb mir jeden Dienstag, ich schickte meine Nachrichten freitags ab. Schnell entwickelte sich ein Ritual, das zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde und das ich nicht mehr missen mochte. Dennoch hatte ich sie in der Zeit, in der ich sie nicht sehen konnte, schmerzlich vermisst. Wären ihre Briefe nicht gewesen, die als Beweis für unsere kurzen gemeinsamen Tage fungierten, hätte ich wohl an ihrer Existenz gezweifelt.
Ich nahm einen Schluck von meinem Bier, das herrlich süß nach Malz schmeckte. Meine Kommilitonen waren in ein Gespräch über die Vorlesung bei Professor Stuart vertieft, ehe Samuel nonchalant das Thema wechselte.
»Ich möchte euch noch etwas erzählen«, begann er und wirkte auf einmal aufgeregt. »Erinnert ihr euch an Clara Kingsley?«
»Du meinst das Mädchen, von dem du andauernd erzählst, dass es mir beinahe vorkommt, als kenne ich sie selbst?« Henry sah Samuel neckend an, woraufhin dieser beschämt den Blick senkte. »Sie hat mir … heute Morgen einen Geburtstagsbrief und ein selbst gesticktes Taschentuch mit meinen Initialen zukommen lassen.« Die Röte auf seinen Wangen vertiefte sich. »Sie traute sich nicht, mit mir zu sprechen, auch wenn ich alles daransetzte, sie zum Bleiben zu überreden.«
»Hast du ihren Brief gelesen?«, erkundigte sich Henry.
Als Samuel den Kopf hob, sah ich ihn: den Ausdruck der Liebe. Jenes Funkeln in den Augen, das man nur bekam, wenn man frisch verliebt war und das Gehirn aus nichts als rosa Wolken bestand. Ich hatte mir vorgenommen, mich nicht Hals über Kopf in Victoria zu vergucken. Nichts zu überstürzen. Aber sie hatte mir letztlich keine Wahl gelassen. Auch wenn wir noch nicht über das, was uns verband, gesprochen hatten, hatte ich mein Herz längst an sie verloren.
»Auch wenn ich es für beinahe unmöglich hielt, erwidert Clara Kingsley meine Gefühle. Sie hat es in ihrem Brief zwar etwas kompliziert ausgedrückt, aber ich bin mir sicher, dass …« Henry ließ Samuel nicht ausreden, stattdessen schlug er ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt! Aber du hast dich ja nicht getraut.«
»Herzlichen Glückwunsch.« Ich grinste ihn an.
»Wie steht es um Victoria?« Henry drehte seinen Stuhl in meine Richtung. Ich nahm einen tiefen Schluck von meinem Bier und überlegte, was ich den beiden am ehesten erzählen sollte. Dass ich die Tage bis zu unserem nächsten Treffen zählte? Dass ich jede Nacht von ihr träumte? Dass es mir manchmal schwerfiel, mich auf meine Lerninhalte zu konzentrieren, wenn sie in meinen Gedanken herumspukte?
»Wir wollen sie endlich kennenlernen«, drängte Samuel. »Ich habe euch von Clara erzählt, lange bevor sich etwas zwischen uns entwickelt hat.«
Vielleicht lag es daran, dass es mir gefiel, Victoria als mein Geheimnis zu wissen. Dass ich selbst entscheiden durfte, wie viel ich von ihr preisgab und was ich lieber für mich behielt.
»Bald«, vertröstete ich die beiden.
Als wir die Taverne drei Stunden später verließen, waren wir angetrunken und alberten herum. Samuel gab eine Imitation unseres Anatomieprofessors zum Besten, der aufgrund seines Bartes und der weit auseinanderstehenden Augen stets einen ulkigen Eindruck machte. Henry bewegte sich nicht mehr ganz sicher auf den Beinen und stolperte in unregelmäßigen Abständen. Ich freute mich darüber, dass es noch immer schneite, und verzichtete darauf, meine Mütze aufzusetzen. Der Winter in New Haven ließ mich vergessen, wie sehr ich die Kälte eigentlich verabscheute. Doch in diesem Moment fühlte sich der Winter wie das Innere jener Schneekugel an, die bei meiner Mutter auf dem Frisiertisch stand und mich schon fasziniert hatte, als ich noch ein kleiner Junge gewesen war.
Ich wurde jäh aus den Gedanken gerissen, als mich etwas an der Schulter traf. Verwirrt drehte ich mich um und sah noch den Schneeball, der von meinem Jackett in Stücke zerfiel.
»Genug geträumt.« Henry formte bereits die nächste Attacke in seinen Händen. Im letzten Moment gelang es mir, in einem Hauseingang Deckung zu suchen. Hektisch bückte ich mich, knetete einen eigenen Schneeball und ließ ihn durch die Luft sausen, sobald sich Henry in mein Sichtfeld bewegte. Eine Sekunde später wurde ich am Kopf getroffen. Ich hörte Samuels ersticktes Lachen in der Stille.
»Warte nur ab«, murmelte ich, schob Schnee zusammen und versuchte, mich in der Dunkelheit zu orientieren, als ich an der Hüfte getroffen wurde. Wie eine Armee standen Henry und Samuel vor mir, je zwei Schneebälle in den Händen, ein siegessicheres Grinsen auf dem Gesicht.
»Zwei gegen einen ist ungerecht«, beschwerte ich mich noch, als sie bereits auf mich zuliefen und mich zu Fall brachten. Ein Lachen löste sich aus meiner Kehle, nach Luft ringend kugelten wir über den verschneiten Boden. Verzweifelt versuchte ich, weitere Schneebälle zu bauen, aber das Gerangel machte es mir unmöglich. Außer Atem blieben wir schließlich mitten auf der Straße liegen, den Blick auf den wolkenverhangenen Himmel gerichtet. Unser Atem stieg in feinen, weißen Wölkchen zwischen uns auf.
»Wir sollten dringend zurück ins Wohnheim.« Samuels Stimme klang erstickt. »Es ist schon sehr spät, und morgen werden wir im Seminar einschlafen.«
»Wir hätten nicht so lange im Quiet House bleiben sollen«, stimmte Henry zu, und ich wusste, dass er recht hatte. Dennoch machte niemand von uns Anstalten, aufzustehen. Stattdessen lagen wir eine Ewigkeit nebeneinander, selig und mit rosigen Wangen, und ließen die Schneeflocken auf uns herabrieseln.
Kapitel 4
Victoria
Das hereinfallende Sonnenlicht ließ mich blinzeln. Müde gähnte ich und reckte die Arme. Dann richtete ich mich in meinem Bett auf, einen schalen Geschmack im Mund, die Nachwirkungen eines Traums noch im Gedächtnis.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Moth.«
Mein Sichtfeld klarte sich; und ich sah Nathaniel in meinem Schlafzimmer stehen. In der Hand einen Muffin, in dem eine brennende Kerze steckte.
Heute war der 21. März. Mein zweiundzwanzigster Geburtstag.
Ich wischte mir den Schlaf aus den Augen und schlug die Decke zur Seite. Das Nachtkleid, das ich trug, bedeckte kaum meine Knie, doch das war mir gleichgültig. Ich ließ mich von Nathaniel in die Arme nehmen und vergrub meine Nase in seinem weizenblonden Haar.
»So viele Menschen auf dieser Welt – und ich habe zufällig die beste Schwester bekommen«, flüsterte er mir ins Ohr. Ich schloss die Augen, genoss den Moment, in dem er mich festhielt und ich vergessen durfte, dass unbeschwerte Tage wie dieser immer seltener wurden.
Dann griff ich über seine Schulter hinweg nach dem Muffin, blies die Kerze aus und biss herzhaft in den süßen Teig.
»Sind das Birnen?« Ich kaute geräuschvoll.
»Heather hat noch welche im Keller gefunden. Möchtest du dein Geschenk sehen?« Nathaniels Augen strahlten – so wie damals, als ich ein Kind gewesen war und er der ältere Bruder, der mir die Welt zeigte. Auffordernd streckte er mir die Hand entgegen.
»Ist Vater zu Hause?«
»Er ist im Rathaus. Du kannst also ganz ungeniert durch die Villa laufen.«
Vaters Abwesenheit erleichterte mich. Es war nicht so, dass ich ihn an meinem Geburtstag nicht sehen wollte, aber ich fühlte mich freier, wenn er nicht da war.
Nathaniel führte mich durch den Korridor, der im Halbdunkel lag, weil bisher niemand die roten Vorhänge zur Seite gezogen hatte. Vor der Tür zu seinem Schlafzimmer blieben wir stehen. Im Gegensatz zu mir war er bereits angezogen und für den Tag zurechtgemacht.
»Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich dir schenke, weshalb es zwei Dinge geworden sind. Was möchtest du zuerst sehen?«
»Wie soll ich dir das beantworten, wenn du mir nicht sagst, was …« Sein erhobener Zeigefinger unterbrach mich.
»Schließ die Augen.«
»Was?«, fragte ich noch, hatte es aber bereits getan. Kurz darauf spürte ich seine kalten Finger, die mir das Haar aus dem Nacken strichen.
»Eins, zwei … Augen auf.«
Mein Blick glitt hinab zu der feinen Goldkette an meinem Hals, an der ein schlichter Anhänger hing. »Ist das …?« Ich nahm ihn in die Hand.
»Eine Motte.« Nathaniel grinste. »Unser Goldschmied wollte mir eigentlich einen Schmetterling andrehen.«
»Sie ist wunderschön.« Mit den Fingerspitzen fuhr ich die filigranen Flügel ab. Eine Motte. Moth. So nannte mich Nathaniel seit Jahren, weil kein Geheimnis vor mir sicher war und ich immer zu nah ans Licht heranflog, um die Wahrheit zu ergründen. »Vielen Dank, Nathie.«
»Das ist noch nicht alles.« Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer. Er hatte aufgeräumt, das Durcheinander der letzten Wochen war besiegt.