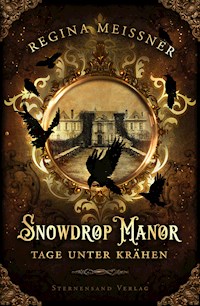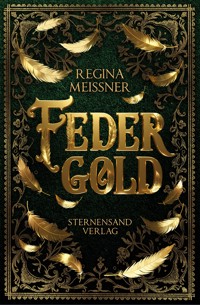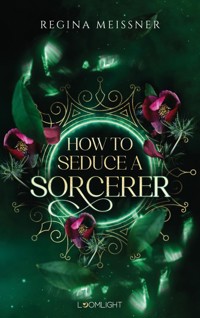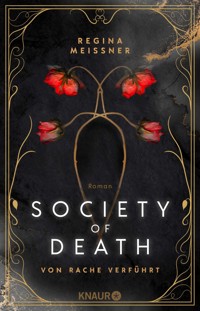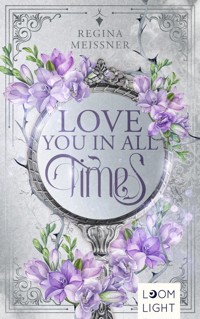Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das versunkene Reich Nysolis
- Sprache: Deutsch
Finlay O'Sullivan lebt mit seinem Onkel in einer kleinen Stadt an der irischen Küste. Das Schicksal hat dem Achtzehnjährigen übel mitgespielt, er wuchs ohne Eltern auf und wird von den Mitschülern aufgrund seines Aussehens schikaniert. Als er eines Nachts mitten im Meer einen Palast sieht, traut er seinen Augen kaum. Dann lernt er die wunderschöne Prinzessin Aurora kennen und mit ihr ein magisches Volk, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Nicht nur, weil noch kein menschliches Auge den Palast je sah, sondern auch, weil das Königreich Nysolis vor über zweihundert Jahren im Meer versank. Finlay möchte der Prinzessin helfen, doch dafür muss er erst selbst herausfinden, wer er ist. Und was es mit den schrecklichen Morden auf sich hat, die regelmäßig am Strand geschehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Kapitel 1 - Finlay
Kapitel 2 - Aurora
Kapitel 3 - Finlay
Kapitel 4 - Aurora
Kapitel 5 - Finlay
Kapitel 6 - Aurora
Kapitel 7 - Finlay
Kapitel 8 - Aurora
Kapitel 9 - Finlay
Kapitel 10 - Aurora
Kapitel 11 - Finlay
Kapitel 12 - Aurora
Kapitel 13 - Finlay
Kapitel 14 - Aurora
Kapitel 15 - Finlay
Kapitel 16 - Aurora
Kapitel 17 - Finlay
Kapitel 18 - Aurora
Kapitel 19 - Finlay
Kapitel 20 - Aurora
Kapitel 21 - Finlay
Kapitel 22 - Aurora
Kapitel 23 - Finlay
Kapitel 24 - Aurora
Kapitel 25 - Finlay
Kapitel 26 - Aurora
Kapitel 27 - Finlay
Kapitel 28 - Aurora
Nachwort
Regina Meißner
Das versunkene Reich Nysolis
Band 1
Fantasy
Das versunkene Reich Nysolis (Band 1)
Finlay O’Sullivan lebt mit seinem Onkel in einem kleinen Fischerdorf an der irischen Küste. Das Schicksal hat dem Achtzehnjährigen übel mitgespielt, er wuchs ohne Eltern auf und wird von den Mitschülern aufgrund seines Aussehens schikaniert. Als er eines Nachts mitten im Meer einen Palast sieht, traut er seinen Augen kaum. Dann lernt er die wunderschöne Prinzessin Aurora kennen und mit ihr ein magisches Volk, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Nicht nur, weil noch kein menschliches Auge den Palast je sah, sondern auch, weil das Königreich Nysolis vor über zweihundert Jahren im Meer versank. Finlay möchte der Prinzessin helfen, doch dafür muss er erst selbst herausfinden, wer er ist. Und was es mit den schrecklichen Morden auf sich hat, die regelmäßig am Strand geschehen.
Die Autorin
Regina Meißner wurde am 30.03.1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren, in der sie noch heute lebt. Als Autorin für Fantasy und Contemporary hat sie bereits viele Romane veröffentlicht. Weitere Projekte befinden sich in Arbeit.
Regina Meißner hat Englisch und Deutsch auf Lehramt in Gießen studiert. In ihrer Freizeit liebt sie neben dem Schreiben das Lesen und ihren Dackel Frodo.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, April 2020
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021
Umschlaggestaltung: Sternensand Verlag GmbH | Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-175-8
ISBN (epub): 978-3-03896-176-5
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für das Meer.
Das unbezwingbare, unbegreifliche, unbeschreibliche Meer.
Nichts hat mich je so fasziniert wie du.
Kapitel 1 - Finlay
Das Meer war unruhig an diesem Abend. Wellen brachen sich an den Kreidefelsen, die bis in den Himmel zu reichen schienen. Ein salziger Geruch lag in der Luft, der sich mit dem Nebel vermischte und die Sicht erschwerte.
Ich zog den Kragen meiner Jacke höher und senkte den Kopf, um dem Nieselregen zu entkommen. Bis heute Mittag hatte die Sonne geschienen, aber hier in Chatair war es nichts Ungewöhnliches, wenn das Wetter plötzlich umschlug.
Missmutig versteckte ich die Hände in den Jackentaschen und blickte auf den dreckigen Sand unter mir, der sich schier endlos in die Ferne erstreckte.
In meiner Kindheit war ich oft hierhergekommen, um mit Freunden Verstecken zu spielen. Unermüdlich hatten wir uns einen sicheren Ort aufgebaut und unvergessliche Momente verbracht. Doch all das – all das Schreien, Jauchzen und Fangenspielen – gehörte einer anderen Zeit an, die mir so weit weg erschien, dass ich daran zweifelte, ob es sie tatsächlich gegeben hatte.
Ich presste die Lippen aufeinander, um dem Hass, der in mir wütete, keinen Weg nach draußen zu geben.
Wie konnte sich in so kurzer Zeit so viel verändern? Wo war all die Leichtigkeit hin, die ich einst verspürt hatte?
Unbeirrt setzte ich meinen Weg fort, ließ mir den Wind ins Gesicht blasen und blickte auf den Abfall, der den Sand bedeckte.
In meiner Kindheit war es hier nicht so dreckig gewesen, doch die Verschmutzung nahm mit jedem Jahr zu. Unter anderen Umständen hätte ich mich nach den Plastikverpackungen gebückt und sie in den Mülleimer geworfen, aber heute war ich viel zu sehr mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt, um Raum für etwas anderes zu schaffen.
Ich kickte eine leere Coladose mit dem Fuß weg und ließ mich auf eine der Bänke fallen, die zu dieser Tageszeit unbesetzt waren. Der Regen wurde stärker, jedoch störte er mich nicht genug, als dass er mich dazu angetrieben hätte, nach Hause zu gehen.
Tief durchatmend lehnte ich mich an das klamme Holz der Bank und schloss die Augen. Hörte auf das Rauschen des Meeres, das wilde Schlagen der Wellen, den Ruf der Möwen.
Normalerweise waren es diese Geräusche, die mich beruhigten. Die mir vermittelten, dass alles gut werden würde und ich auch den kommenden Tag so wie alle anderen überstehen würde. Heute stellten die Töne des Meeres nur ein Hintergrundrauschen dar, weil das, was ich in mir trug, viel lauter war.
Ich blinzelte, um die Erinnerungen, die sich wie ein Film in meinem Kopf abspielten, loszuwerden, doch sie waren zu fest in mir verankert. Ich hörte ihre Stimmen, ihr hämisches Gelächter. Und ich musste die Augen nicht öffnen, um mir des blauen Flecks an meinem Handgelenk bewusst zu werden.
Das Meer hatte normalerweise eine beruhigende Wirkung auf mich – heute verstärkte es nur die Trauer, die ich in mir trug. Ich schluckte mehrmals – der Kloß in meiner Kehle wurde dadurch nicht kleiner.
Mittlerweile musste es nach sieben sein. Eventuell hatte Niall bereits versucht, mich zu erreichen, aber bevor ich das Chaos in mir nicht halbwegs in den Griff bekam, würde ich mich nicht bei ihm melden. Er sollte nichts von den Hänseleien meiner Mitschüler wissen.
Um ihn in Sicherheit zu wiegen und nicht zusätzlich zu belasten, setzte ich in seiner Gegenwart ein fröhliches Lächeln auf und machte gute Miene zum bösen Spiel. Doch das schaffte ich nur, wenn ich eine Weile allein war und meine Gedanken ordnete. Wenn ich mich daran erinnerte, dass in ein paar Monaten alles vorbei war, ich die Schule, diese vermaledeite Stadt und am besten gleich ganz Irland verlassen konnte.
Ich nickte – als würde ich mir durch die Geste den Mut holen, den ich brauchte – und stand auf. Wann hatte es jemals geholfen, Trübsal zu blasen?
Du bist der Sohn einer Hure!, schallte Connors Stimme durch meinen Kopf. Sein teigiges Gesicht mit den stahlblauen Augen schwebte durch meine Gedanken. Wie viele hat deine Mum gefickt? Und dich Missgeburt hat sie behalten! Kein Wunder, dass sie abgehauen ist, nachdem sie dich das erste Mal gesehen hat!
Wut sammelte sich in mir, heiß und alles verschlingend. Nur mit Mühe unterdrückte ich einen Fluch.
Ich biss die Zähne zusammen, versuchte Connors Visage aus meinem Kopf zu bannen, jedoch hallte sein Lachen laut in meinen Ohren wider.
Bei Leuten wie dir sollte Abtreibung bis in den letzten Monat erlaubt sein. Schau dich an, du missgestaltete Kreatur!
Ich legte den Kopf in den Nacken, ließ den Regen, der stärker geworden war, ungehindert auf mein Gesicht prasseln. Atmete mehrmals tief durch, hoffte, dass es dadurch einfacher werden würde.
Wurde es nicht. Da war so viel Hass in mir, so viele unterdrückte Gefühle … und ich befürchtete, dass ich sie irgendwann herauslassen musste. Mein Körper war zum Zerreißen gespannt – dann drehte ich mich dem Meer zu.
Die Wellen schlugen wild gegen die Felsen, der Himmel war so dunkel, dass ich ein Gewitter vermutete.
Ich trat näher an das Wasser heran, ging so weit, bis meine Schuhe nass wurden und ich zu frieren begann. Mein Blick blieb an den gigantischen Wellen hängen – und nicht zum ersten Mal wünschte ich mir, in ihnen zu verschwinden. Unsichtbar zu werden, nicht mehr da zu sein, unterzutauchen. Ich selbst war nicht in der Lage, etwas an meiner Situation zu verändern, weswegen ich auf die einzige Konstante hoffte, die auf meiner Seite war: die Zeit.
Ich ging einen Schritt weiter, versank im nassen Sand und wartete so lange, bis das Wasser meine Knöchel umspielte. Egal, wie warm es war, die Irische See schien ihre Kälte nie zu verlieren.
Meine Zähne begannen zu klappern, doch das hielt mich nicht davon ab, weiter auf das Meer zuzugehen, so weit, bis auch meine Knie nass wurden und die Jeans klamm um meine Beine hing. Ich wollte etwas anderes fühlen, etwas, das Connor aus meinem Kopf vertrieb.
Kurzerhand bückte ich mich, tauchte meine Arme in das Wasser, in der Hoffnung, dass die Kälte mich lahmlegen würde. Eine dicke Gänsehaut überzog meinen Oberkörper, brachte mich zum Schlottern.
Hätte ich etwas mehr Mumm, würde ich einmal komplett untertauchen, mir meinen Weg durch die Wellen kämpfen und so weit hinausschwimmen, bis ich allein nicht mehr zurückfand. Mein Dad hätte es getan. Doch irgendetwas hielt mich in dieser Welt – ich wusste nur nicht, was es war.
Entschieden, kein Feigling zu sein, streckte ich die Arme tiefer in das eiskalte Wasser und ging weiter nach vorn. Die Wellen umspielten meinen Körper.
Auf der einen Seite wusste ich, wie gefährlich sie waren, auf der anderen faszinierten sie mich.
Ich ging in die Hocke, ließ mich vollständig von dem salzigen Wasser umgeben und grub meine Hände in den kalten Sand. Ich stieß auf Muscheln, die ich aufgrund ihrer rauen Oberfläche auch blind erkennen konnte.
Doch was war das?
Meine Stirn legte sich in Falten, während ich meinen rechten Arm tiefer im Sand vergrub. Ein runder Gegenstand lag in meiner Hand, der sich im Meer wie ein Fremdkörper anfühlte.
Entschlossen zog ich ihn heraus, befreite ihn vom nassen Sand und warf einen Blick darauf.
Ich staunte nicht schlecht, als ich eine goldene Münze sah, von der sich der feuchte Schlamm löste. Sie war größer als unser Geld, füllte meine Handfläche komplett aus.
Dann verließ ich das Meer und ging zurück zu der Bank, um mir meinen Fund genauer anzuschauen.
Ich wusste nicht, ob es sich bei der Münze um echtes Gold handelte, dafür kannte ich mich nicht gut genug aus, aber mein Onkel würde mir die Frage beantworten.
Mit dem Jackenärmel wischte ich über die Oberfläche des Geldes und nutzte zusätzlich den Regen, damit sie sauber wurde. Ich kniff die Augen zusammen, sodass ich das Motiv, das auf die Münze geprägt worden war, besser erkennen konnte.
Im schimmernden Glanz des Goldes sah ich ein großes, imposantes Schloss mit spitzen Türmen und aufwendigen Verzierungen an den Wänden. Es wirkte prunkvoll und erhaben.
Ich drehte die Münze, um die Rückseite zu betrachten, auf der ein älterer Mann mit resoluten Gesichtszügen und einem Schnurrbart abgebildet war. Sein Mund schien eingefroren, so als hätten seine Lippen nie zuvor ein Lächeln gezeigt. Er trug einen seltsamen Hut, der mich von der Form her an ein Schiff erinnerte, und hatte langes schwarzes Haar, das darunter hervorschaute und ihm über die Schultern fiel.
Verwirrt drehte und wendete ich die Münze – nicht recht wissend, was ich damit anfangen sollte. Ich hatte diesen Strand unzählige Male aufgesucht und mir als Kind oft vorgestellt, hier einen Schatz zu finden. Meine damaligen Funde beliefen sich auf Plastikmüll, seltsam geformte Muscheln und den ein oder anderen Seestern. Eine solche Münze hatte ich noch nie gesehen.
Ich steckte sie mir in die Hosentasche – froh, dass ich durch sie auf andere Gedanken gekommen war. Mein Onkel würde mir mehr über sie erzählen können.
Das Wasser fraß sich durch meinen Körper, entzog ihm jegliche Wärme und brachte mich zum Schlottern. Es war Zeit, nach Hause zu gehen.
Ich lief bis zu den Dünen, hinter denen ich meinen Rucksack aufbewahrt hatte, und holte Kopfhörer und Handy aus der Vordertasche. Langsam wurde es dunkel – da brauchte ich Musik, damit die Finsternis nicht auch in meine Gedanken drang.
Nachdenklich scrollte ich durch meine Playlist, die hauptsächlich aus Instrumentalem und Soundtracks bestand.
Bevor ich mich für einen Song entscheiden konnte, drang ein helles Geräusch an mein Ohr, das mich abrupt herumfahren ließ. Verwirrt spähte ich in alle Richtungen, doch wähnte mich weiterhin allein.
Den Kopf schief gelegt, lauschte ich auf den sonderbaren Ton, der zunehmend leiser wurde und hinter dem ich eine weibliche, zarte Stimme vermutete. Eine seltsame Melodie grub sich in mein Gehör und erinnerte mich an ein trauriges Lied, das voll Inbrunst gesungen wurde. Aus unerfindlichen Gründen drang es mir durch Mark und Bein.
Kopfschüttelnd wurde mir bewusst, dass sich Tränen in meinen Augen gesammelt hatten und mein Herz sein Gewicht verdoppelte. Eine Trauer, wie ich sie nie zuvor gekannt hatte, grub sich in meine Eingeweide und ließ mich taumeln – so tief ging sie.
Mein Handy und die Kopfhörer stopfte ich zurück in den Rucksack, fest entschlossen, die Eigentümerin der Stimme zu finden. Ich spitzte die Ohren, schaute mich abermals am verlassenen Strand um, doch je länger ich suchte, desto aussichtsloser kam mir mein Unterfangen vor.
Die Stimme wurde immer leiser, bis sie schließlich ganz verklang. Gut möglich, dass ich sie mir eingebildet hatte. Heute war genug passiert, es würde mich nicht wundern, wenn mein Gehirn durchdrehte.
Schulterzuckend ging ich den Strand entlang, stieg die Dünen hoch und steuerte den Heimweg an, ohne dem Meer einen weiteren Blick zu schenken. Der Regen hatte sich in einen konstanten Schauer verwandelt, der sich in Tausenden Tropfen auf meinem Gesicht brach.
Ich hielt den Blick gesenkt, schaute auf den dreckigen Asphalt unter mir und lief mittig auf der unbefahrenen Straße.
Bis zu meinem Onkel dauerte es nicht länger als eine viertel Stunde, und darüber war ich froh, denn dadurch, dass er ein kleines Cottage zwischen Feldern und einem Wald bewohnte, gelang es mir, mich dem Trubel der Stadt zu entziehen. Wenn ich mich in meinem Zimmer auf das Bett setzte und aus dem Fenster schaute, konnte ich sogar das Meer sehen.
Dennoch war da diese riesige Leere in mir. Diese Leere, die mich auffraß und meine Schritte immer langsamer werden ließ, weil ich selbst nicht wusste, wo ich hingehörte.
Missmutig ballte ich die Hände zu Fäusten, ignorierte die Schafe, die neben mir auf der Wiese grasten und die wohl jemand vergessen hatte, in ihren Stall zu bringen.
Am Rand meines Sichtfeldes sah ich bereits Onkel Nialls Cottage, das mir zwischen all den grünen Feldern winzig vorkam. Das Dach war etwas windschief, doch die Hütte besaß ihren ganz eigenen Charme, dem ich mich nie hatte entziehen können.
Eine kleine, kaum greifbare Freude breitete sich in mir aus, sie reichte, um mich voranzutreiben, die Abkürzung über die Felder zu nehmen und behände über den Zaun zu springen, der Nialls Hütte umgab.
Sein Antiquitätenladen schloss jeden Tag mehr oder weniger pünktlich um sechs Uhr, weswegen er schon eine Weile zu Hause sein musste.
Schnell fischte ich den Schlüssel aus meiner Hosentasche und schloss die Tür auf, die mit einem Knarren aufsprang.
Ein süßlicher Geruch schlug mir entgegen, und ich erkannte, dass Niall seinen Plan, Flapjacks zu backen, in die Tat umgesetzt hatte. Mein Blick fiel auf den Backofen, in dem die Haferriegel auf ihre Fertigstellung warteten.
Mit einem Lächeln auf den Lippen schlüpfte ich aus meinen Schuhen und hängte die Jacke an den einzigen freien Haken der Garderobe. Kurz darauf hörte ich Nialls Schritte.
Die Tür, die zum Schlafzimmer führte, öffnete sich, und ein verwirrt dreinblickender Niall betrat die Küche. Als er mich sah, lichtete sich sein Blick, nur um kurz darauf einem Stirnrunzeln zu weichen.
»Junge, warst du schwimmen?«, fragte er mich entgeistert.
Ich blickte an mir herab. Wie schnell man vergessen konnte, dass man bis auf die Knochen durchnässt war. Langsam, aber sicher breitete sich eine Wasserlache um mich herum aus, die unschöne Flecken auf dem hölzernen Boden hinterließ.
»Ich denke, ich zieh mich mal um«, meinte ich mit einem Schulterzucken. Niall sah mich weiterhin verwirrt an, doch ich schob mich an ihm vorbei und nahm die Stufen der Treppe nach oben. Sie führte in die zwei Räume, die sich auf der ersten Etage befanden.
In meinem Zimmer schlüpfte ich umständlich aus den nassen Hosen, zog meine Strümpfe aus, trocknete mir die kalten Beine mit einer Fleecedecke ab und griff nach der Jogginghose, die auf meinem Bett lag. Duschen konnte ich später noch.
Aus den Augenwinkeln erhaschte ich mein Gesicht im Spiegel des Kleiderschranks – entschied mich allerdings dagegen, meinem Äußeren einen zweiten Blick zu schenken. Stattdessen griff ich nach der Münze, die sich in der Hosentasche befand, und ging die Treppe nach unten.
Niall hatte unterdessen den Tisch gedeckt und ein Blech Flapjacks aus dem Ofen geholt. Ich seufzte, als sich der frische, süße Geruch seinen Weg in meine Nase bahnte, und nahm auf einem der Stühle Platz.
»Willst du mir erzählen, wieso du bis auf die Knochen nass warst?«, erkundigte sich mein Onkel, aber ich tat seine Frage mit einer Handbewegung ab.
Er zog die buschigen Augenbrauen zusammen, stellte jedoch keine weiteren Fragen. Stattdessen setzte er sich mir gegenüber an den Tisch, rückte seinen Stuhl heran und schenkte uns etwas von dem Preiselbeersaft ein, der sich in der Glaskaraffe vor mir befand.
»Greif zu, ich hab mehr Flapjacks gebacken, als wir in einer Woche verdrücken können«, meinte er und grinste mich schief an.
Ich schaffte es, sein Lächeln zu erwidern, streckte die Hand nach dem Gebäck aus, zuckte kurz zusammen, als ich bemerkte, dass es noch heiß war, und ließ es dann auf meinen Teller wandern. Ich pustete mehrmals, bevor ich den ersten Bissen nahm.
»Wie war dein Tag, Finlay?«, fragte mich Niall.
Ich hob den Blick, nur um zu erkennen, dass seine grünen, treuen Augen auf mich gerichtet waren. Wenn er mich so ansah, konnte ich ihn nicht anlügen. Wenn er mich so ansah, las er mir jeden Schwindel von der Nasenspitze ab.
Deswegen wechselte ich das Thema, bevor ich ihm etwas sagte, das ich später bereuen würde. »Ich war eben am Strand und habe etwas Seltsames gefunden.«
Ich biss von meinem Flapjack ab, langte in meine Hosentasche und schob Niall die Münze über den Tisch hinweg zu.
Seine Stirn legte sich in Falten, seine Augen verzogen sich zu Schlitzen, doch ich wusste, dass ich seine Aufmerksamkeit hatte. Der Antiquitätenhändler in ihm kam zum Vorschein. Er ließ seinen Flapjack los und griff nach der Münze, die er unter das Deckenlicht hielt.
»Vielleicht ist es eine Fälschung«, murmelte ich zwischen zwei Bissen.
Die Flapjacks schmeckten fantastisch. Niall hatte das Rezept von seiner Mutter und wenn ich der Geschichte Glauben schenkte, wurde es seit mehreren Jahrhunderten in der Familie weitergegeben. Allerdings wusste ich auch, dass es mein Onkel mit der Wahrheit nicht immer ganz so ernst nahm und er der Ansicht war, dass man Storys ausschmücken durfte, wenn sie dadurch spannender wurden.
Niall schob sich die Brille höher auf die Nase. Seine Lippen waren geschürzt. »Wo hast du die Münze genau gefunden?«, wollte er wissen.
Ich zuckte mit den Schultern. »Oben am Strand. Sie war im Sand vergraben. Glaubst du, sie ist echt?« Den Kopf schief gelegt, sah ich ihn an.
Mein Onkel räusperte sich, warf noch einen letzten Blick auf die Münze, bevor er sie mir zurückgab. »Es ist definitiv keine Fälschung«, verkündete er schließlich. »Die Münze besteht aus echtem Gold und ist sicherlich einiges wert. Wie viel, das kann ich im Moment nicht sagen. Wenn mich mein geübtes Auge nicht täuscht, ist sie gewiss zweihundert Jahre alt.«
»Zweihundert Jahre«, wiederholte ich staunend. »Woher kommt sie? Kennst du den Mann, der darauf abgebildet ist?« Ich schaute auf den griesgrämigen Typen hinab.
Niall schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn nie zuvor gesehen. Am Rand steht etwas in einer fremden Sprache, aber auch die ist mir nicht bekannt.« Er kratzte sich am Kinn. »Wenn es okay ist, nehme ich sie morgen mit in den Laden und stelle ein paar Nachforschungen an.«
Ich nickte und trank meinen Preiselbeersaft leer. »Wie war es im Geschäft?«, fragte ich schließlich, um das Gespräch nicht abklingen zu lassen und damit ich nicht Gefahr lief, dass Niall sich stattdessen nach der Schule erkundigte.
Mein Onkel tat unbestimmt – so wie immer. »Es war recht wenig los, doch das muss nichts bedeuten. Im Sommer kommen weniger Kunden, das machen wir im Herbst und Winter wieder wett.«
Sein Optimismus war unerschütterlich, dennoch hörte ich die stumme Besorgnis, die in seinen Worten mitschwang. Ein Antiquitätengeschäft schrieb in den meisten Fällen rote Zahlen. Ein Antiquitätengeschäft in einer kleinen Stadt an der irischen Küste war quasi ein Selbstmordkommando.
Ich wusste nicht genau, wie schlecht es um den Laden stand. Umso deutlicher war mir bewusst, dass mein Onkel aufgrund seiner schwierigen finanziellen Lage niemals ein Kind gewollt hatte – und doch mit mir auskommen musste.
»Mach dir nichts draus, Fin«, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Das ist ganz normal. Es gibt gute und weniger gute Zeiten. Kein Grund zur Sorge.«
»Ich kann gern die Schicht am Samstag übernehmen«, bot ich an, weil mein schlechtes Gewissen nicht verschwinden wollte. Ich kam schon nicht gut damit klar, dass mein Onkel alles für mich bezahlte und ich bei ihm wohnen durfte – dass er jeden Tag stundenlang schuftete, um uns über die Runden zu bringen, fiel mir noch schwerer zu akzeptieren.
»Hilf mir aus, wenn du Zeit hast.« Er winkte ab. »Die Schule geht vor.«
Ja. Und in ein paar Monaten ist alles vorbei.
Ich kaute nachdenklich auf meinem Flapjack herum. Niall ließ mich nicht oft aushelfen – und wenn ich doch mal eine Schicht bekam, wollte er mich dafür bezahlen.
Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her.
»Was hast du, Finlay?« Auch ohne ihn anzusehen, wusste ich, dass sein aufmerksamer Blick auf mir ruhte.
Nur mit Mühe unterdrückte ich ein Seufzen. Ich zerteilte den Flapjack mit den Fingern in der Mitte.
»Hast du Kummer?« Seine Stimme wurde väterlich – was es für mich nur schlimmer machte.
Der Kloß in meiner Kehle ließ die Erinnerung an den Schultag lebendig werden. Ich krampfte meine Hand um die Tischplatte, um all den Hass, der in mir wütete, in den Griff zu bekommen. Es funktionierte nicht.
Ich hätte Angst, mich mit dir in der Öffentlichkeit zu zeigen! Schau dich an, du verkrüppelte Missgeburt!
Ich presste die Lippen so fest aufeinander, dass es wehtat. Obwohl mein Onkel nichts sagte, kam ich mir wie bei einem Kreuzverhör vor.
Zwar wusste ich, dass er mich zu nichts drängen würde, aber er spürte, dass etwas nicht stimmte … und das schon länger. Ich erkannte es an der Weise, wie er mich ansah, wenn ich zur Schule aufbrach. Doch heute wollte ich nicht mit ihm darüber sprechen … ich konnte es nicht.
»Weißt du, ich hab einiges für die Schule zu tun. Wir schreiben am Freitag Englisch und ich hab noch nicht gelernt«, sagte ich mit gepresster Stimme und schaute ihn kurz an.
Ein wissender Blick legte sich auf das Gesicht meines Onkels, er stellte allerdings keine Nachfragen.
Ich biss noch einmal in den Flapjack, bedankte mich für das Abendessen, griff nach meinem Rucksack und stieg die Treppe hoch.
Erst in meinem Zimmer konnte ich aufatmen. Eine Weile lauschte ich auf Nialls Schritte – glücklicherweise folgte er mir nicht. Dann ließ ich mich auf mein Bett fallen.
Neben mir auf meinem Nachttisch stand eines der wenigen Bilder, die mir von meinem Dad geblieben waren. Ich musste mich nicht umdrehen, um mich an die Fotografie zu erinnern, die an einem warmen Sommermorgen aufgenommen worden war. Einer der letzten Tage, die wir miteinander verbracht hatten. Sein Tod war jetzt acht Jahre her – ich damals noch ein Kind – mit mehr Träumen im Kopf, als die Realität je zerstören konnte. Die Schikanen in der Schule hatten noch nicht begonnen und ich genoss mein Leben mit jeder Faser meines Herzens.
Auf dem Foto strahlte mein Dad in die Kamera, zeigte seine perfekten weißen Zähne, die ich gern von ihm geerbt hätte. Er hatte den Arm um mich gelegt, doch ich – der zehnjährige Junge, der ich gewesen war –, schaffte es nicht mal, in die Linse zu schauen, weil ich mit dem Blick einer Möwe folgte, die am Strand spazieren ging. Ich konnte nur mutmaßen, wieso ich mich mit solcher Detailtreue an diesen Moment erinnerte. Wahrscheinlich war es ein Versuch meines Gehirns, mit dem Schmerz umzugehen, der kurz darauf zu einem Teil meines Lebens geworden war.
Ich kämpfte gegen die Tränen an und drehte mich auf die andere Seite des Bettes. Es war zu früh, um schlafen zu gehen, aber die Versuchung, die Augen zu schließen und in eine Traumwelt zu flüchten, war groß.
Wie von selbst fielen meine Lider zu, als mich ein sonderbares Geräusch wach hielt. Leise drang es an mein Ohr, bis es immer lauter wurde und tief in mir widerhallte.
Die Härchen auf meinen Unterarmen stellten sich auf, gleichzeitig war mir klar, dass ich etwas Ähnliches schon einmal erlebt hatte. Heute am Strand – vor wenigen Stunden. Und bevor ich länger darüber nachdenken konnte, wusste ich, dass es sich um dieselbe weibliche Stimme handelte. Nur dass sie jetzt länger sang, auch wenn ich kein Wort verstand.
Die Müdigkeit wich aus meinem Körper, ich schlug die Augen auf und blickte durch mein großes Fenster, das mir bei Tageslicht eine atemberaubende Sicht über grüne Wiesen und das endlose Meer bescherte. Mittlerweile war es dunkel geworden – was normalerweise bedeutete, dass nicht das kleinste Licht die Finsternis durchbrach.
Doch heute war es anders. Ich strich mir eine nervige Haarsträhne aus der Stirn und richtete mich auf, robbte näher an das Fenster heran und stützte mich auf der Bank davor ab.
Ich blinzelte mehrmals, weil ich mir nahezu sicher war, dass das, was sich vor meinen Augen ausbreitete, nur eine Illusion sein konnte.
Von der kleinen Insel, die sich mitten im Meer befand und von den Einwohnern liebevoll Bláth, Blüte, genannt wurde, strahlte ein Licht zu mir herüber, das mich blinzeln ließ. Abertausende helle Partikel brachen sich in meinem Sichtfeld, bewegten sich hastig von links nach rechts, bis sie an Ort und Stelle verharrten und ein Muster ergaben, das ich erst auf den zweiten Blick erkannte.
Womöglich, weil es kein Muster, sondern ein Gebäude war. Ein Schloss mit spitzen Türmen und einer Fahne am höchsten Punkt, umgeben von den Lichtern, die die Finsternis erhellten.
Ich fuhr mir über die Augen, war mir mittlerweile sicher, dass mein Verstand mit mir durchging und der Tag einfach eine Nummer zu viel für mich gewesen war.
Doch so oft ich auch blinzelte und eine logische Erklärung für das, was vor mir geschah, suchte, das Schloss verschwand nicht.
Schon auf den ersten Blick war mir bewusst, dass es sich um jenen Palast handelte, der auf die Münze geprägt war. Die Münze, die nun unten bei Niall lag – was mir aus einem unerfindlichen Grund nicht mehr richtig erschien.
Auf einmal fühlte ich mich getrieben – hektisch, so als dürfte ich keine Zeit mehr verlieren und vor allem: keine Fehler begehen.
Wie von einer fremden Macht getrieben, stand ich vom Bett auf, schlüpfte in meine karierten Hausschuhe, die auf dem Teppich standen, und verließ das Zimmer.
Hastig rannte ich die Treppe hinab und versuchte dabei, das Gleichgewicht zu halten. Es wäre nicht das erste Mal, dass mich die unterschiedlich großen Stufen zu Fall gebracht hätten.
Onkel Niall saß auf seinem Sessel und schaute sich einen Krimi im Fernsehen an. Überrascht hob er den Blick, als er mich sah – und jetzt, da ich unten angekommen war, erschien mir mein Vorhaben kindlich und übereilt.
»Die Münze«, stieß ich dennoch hervor. »Kann ich sie noch einmal sehen?«
Falls Niall überrascht war, ließ er es sich zumindest nicht anmerken. Er drosselte die Lautstärke des Fernsehers, stand vom Sessel auf und ging zu seiner schwarzen Ledertasche, die im Eingangsbereich stand und die er immer mit in den Laden nahm.
Wortlos reichte er mir die Münze, die er aus dem vorderen Fach gezogen hatte.
»Ich … ich will sie Peter zeigen.« Ich hatte das Gefühl, ihm eine Erklärung zu schulden.
Außerdem dachte Niall, ich wäre immer noch mit Peter befreundet. Das Lächeln auf seinen Lippen zeigte mir, dass er sich über mein Vorhaben freute.
»Nun dann, ich will dich nicht länger stören«, sagte ich und deutete auf den Fernseher.
Bevor mein Onkel eine wegwerfende Handbewegung machen und mich zum Bleiben überreden konnte, schlich ich an ihm vorbei und ging die Treppe hoch. Wie einen Schatz verbarg ich die Münze in meiner rechten Hand. Eine seltsame Wärme durchströmte mich, die ich nicht begriff, die mich allerdings auf unerklärliche Weise glücklich machte.
Vorsichtshalber schloss ich die Tür zu meinem Zimmer ab, weil ich nicht gestört werden wollte. Hastig kletterte ich auf mein Bett, doch spürte instinktiv, dass sich etwas geändert hatte. Die melodische Stimme von eben war verklungen.
Als ich aus dem Fenster blickte, gab es da kein Schloss mehr. Während der Zeit, die ich bei meinem Onkel verbracht hatte, mussten die Lichter ausgegangen sein. Zwar blickte ich immer noch auf Bláth, nur handelte es sich bei der Insel jetzt lediglich um einen Flecken Land in der Dunkelheit.
Perplex schaute ich auf die Münze in meiner Hand, so als hätte ich Angst, dass sie sich ebenfalls in Luft auflösen könnte. Aber das Geld war noch da – fest und sicher umschloss ich es. Wieso war das Schloss verschwunden? Vielleicht hatte es den Palast am Ende nie gegeben und die Lichter waren nur eine Sinnestäuschung gewesen – ein Farbenspiel des Mondes, der heute Nacht besonders hell strahlte.
Ein Teil von mir versuchte sich mit dem Gedanken anzufreunden, der andere wusste, was ich gesehen hatte – und dass es keine logische Erklärung dafür gab.
Mein Herz schlug schneller und ich kämpfte gegen eine Angst an, die mir neu war.
Auf einmal wirkte alles, was ich in meinem Zimmer sah, gespenstisch. Mein Kleiderständer warf schaurige Schatten auf den Boden, der Schrank wirkte wie ein wuchtiges Ungeheuer, und das Ticken meiner Wanduhr war mir nie lauter vorgekommen als in diesem Moment.
Bevor ich Gefahr lief, vollends den Verstand zu verlieren, robbte ich zum Fenster und ließ die Rollläden herunter. Die Münze legte ich auf meinen Nachttisch, dann verkroch ich mich unter der Decke und versuchte, Schlaf zu finden. Aber das Abbild des goldenen Palasts hatte sich bereits tief in meine Erinnerung gebrannt.
Kapitel 2 - Aurora
Als ich die Augen öffnete, wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Damit spielte ich nicht auf die kleinen Dinge an, die immer mal anders waren, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtete, sondern auf das große Ganze, das, worauf es am Ende ankam.
Es fuhr wie ein Ruck durch meinen Körper, als ich aufstand, in meine mit Perlen verzierten Hausschuhe schlüpfte und nach der Bürste griff, mit der ich mein goldblondes Haar entwirrte, das sich über Nacht in Knoten gelegt hatte.
Bislang war alles wie immer – wie in jedem Traum, den ich seit unzähligen Jahren hatte und der sich stets wiederholte. Ich wusste, dass ich mich gleich vor den Spiegel stellen, meine Kette umlegen und die Lippen schürzen würde – weil ich mit dem, was ich sah, nie ganz zufrieden war. Ich würde an meinem Nachthemd ziehen, weil es viel zu kurz war und mein Vater mich für meine Unsittlichkeit rügen würde. Doch ich mochte, wie sich der sanfte Stoff um meinen Körper legte und genau das an mir zeigte, was ich sehen wollte.
Nachdem ich mich im silbernen Glas des Spiegels gemustert hatte, würde ich mein Zimmer verlassen, nach der Türklinke greifen, in Gedanken an den Flur, der dahinterlag – bis mich eine fremde Macht zurückriss, mich brutal auf mein Bett schleuderte und mir wieder einmal deutlich machte, dass ich nicht mehr dieses Mädchen war. Dass ich es nie mehr sein würde und nur die Erinnerung mich Nacht für Nacht wach werden ließ.
Es gab kein Zurück in mein altes Leben. Denn aus Scherben ließ sich nicht immer etwas Schönes bauen, das hatte ich schmerzhaft lernen müssen.
Und dennoch wagte ich es wieder – Nacht für Nacht. Auf der einen Seite, weil man in seinen Träumen selten eigene Entscheidungen treffen konnte, und auf der anderen Seite, weil ein tiefer Drang es mir befahl. Vor allem aber, weil da heute dieses Gefühl in mir war. Dieses Gefühl, dass sich etwas geändert haben könnte.
Mit einem Kloß in der Kehle stellte ich mich also vor den goldumrahmten Spiegel und legte die Kette an, die ich in meinem Schmuckkästchen fand. Sie zog meinen Hals optisch in die Länge, was mir schon immer gefallen hatte, außerdem unterstrich sie meine Elfenhaftigkeit.
Abschätzend schürzte ich die Lippen, denn trotz allem war ich nicht zufrieden mit mir. Am Nachthemd jedoch lag es nicht – wie ich feststellte, als ich daran zog –, denn das betonte genau die richtigen Stellen meines Körpers.
Seufzend wandte ich mich vom Spiegel ab und wollte mein Zimmer verlassen. Auf leisen Sohlen ging ich bis zur Tür, umfasste die Klinke – und wusste, dass ich mich gleich auf meinem Bett wiederfinden und abermals aufwachen würde.
Ich öffnete die Tür einen Spalt – und ich schaute hinaus in den Flur, der zu der frühen Morgenstunde leer vor mir lag.
Mit klopfendem Herzen ließ ich mein Schlafzimmer hinter mir und schlüpfte in den Korridor. Meine Bewegungen fühlten sich linkisch an, ein bisschen so, als würden sie nicht zu mir gehören.
Als ich im Flur stand, wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte. Auf einmal hatte ich kein Ziel mehr. Ich wusste nur, dass ich seit Jahren denselben Traum träumte – jede einzelne Nacht – und ich darüber vergessen hatte, was ich im Flur eigentlich tun wollte, zu dem es mich so sehr gezogen hatte. Jedes Mal war mein Plan vereitelt worden, bis ich irgendwann vergessen hatte, worin dieser überhaupt bestand.
Nachdenklich sah ich mich um, blickte auf den goldenen Boden, der sich im Sonnenlicht, das durch die großen Scheiben schien, in Abertausenden Partikeln brach und schimmerte.
Kurz entschlossen ging ich auf die Fensterfront zu und drückte meine Nase an der Scheibe platt.
Genießerisch schloss ich die Augen. Ich wusste nicht, wann ich zum letzten Mal die Sonne gesehen hatte. Die echte, warme Sonne.
Aber stimmte das? Spielte sich dieser Moment tatsächlich in der Realität ab? Ich konnte es nicht glauben. Der alleinige Gedanke daran erschien mir so grotesk, dass ich mich nicht näher mit ihm beschäftigen wollte, dennoch krallte er sich in mir fest und ließ mich nicht mehr los.
Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus – ich war gefangen genommen von der Vorstellung, dass es dieses Mal für immer sein könnte. Dass es dieses Mal kein Traum war und ich in einem Leben aus Dunkelheit erwachen musste.
Es waren Schritte, die mich zusammenzucken ließen. Ich wandte mich von der Scheibe ab, öffnete die Augen und wirbelte herum.
Der Flur lag verlassen da, die Schritte jedoch wurden lauter, bis ich eine Gestalt am Ende des Korridors ausmachte.
Sie war schmal gebaut, trug ein silberfarbenes Kleid, das ihre Figur wunderschön umspielte. Und auf einmal wusste ich, wieso ich mein Zimmer verlassen und den Flur betreten wollte.
Weil ich auf sie wartete.
Mein Gott, ich hatte so lange auf sie gewartet!
Wie von selbst setzten sich meine Füße in Bewegung. Ich schlidderte über den blank polierten Boden auf meine Schwester zu, deren Augen sich weiteten, als sie mich erkannte. Ihr silbrig schimmerndes Haar fiel in sanften Wellen ihre Schultern hinab, doch mein Blick heftete sich auf ihr Lächeln.
Ihr wunderschönes Lächeln, das ich über zweihundert Jahre nicht mehr gesehen hatte.
Tränen rannen wie Sturzbäche meine Wangen hinab, weil ich nicht mehr an mich halten konnte. Weil mein Herz auf einmal eine Tonne wog und sich gleichzeitig alles so leicht anfühlte.
Mein Atem ging hektisch, als ich über den Flur rannte. Ich sah, dass auch Cyrena schneller wurde, die Arme nach mir ausstreckte und meinen Namen rief.
Wärme breitete sich in mir aus, gleichzeitig gipfelte meine Angst davor, aufzuwachen. Denn ich wusste nicht, ob ich die Hölle auch nur einen weiteren Tag ertragen würde, wenn ich Cyrena berührt hatte.
Kopflos blieb ich vor ihr stehen, holte schnaufend Luft und blickte in ihre dunkelblauen Augen. Augen, die mich immer an den Ozean erinnerten, so undurchdringlich waren sie. Es lagen Schönheit und Schrecken gleichermaßen in ihnen – eine Mischung, die mich nur mehr zu ihr zog.
»Aurora«, flüsterte sie. Cyrenas Unterlippe bebte. Sie hatte den Kopf schief gelegt, so als wüsste sie selbst nicht genau, ob sie ihren Augen trauen konnte.
Doch bevor die Skepsis in mir weiter wuchs, schloss ich sie in meine Arme. Spürte ihre Wärme, nahm ihren Frühlingsduft in mir auf und vergrub meinen Kopf in ihrem silbernen Haar.
Und in diesem Moment wusste ich, dass es echt war. Dass wir echt waren. Dieses Mal würden wir es schaffen.
Es funkelten Tränen in ihren Augen, als sie sich von mir löste. Erschrocken presste sich Cyrena die Hand vor den Mund. »Passiert das wirklich?«, fragte sie erstickt.
Ich konnte nur mit den Schultern zucken.
»Sind wir wach?«, fuhr sie fort, sah an mir vorbei, den Gang entlang und schließlich hinaus aus dem Fenster. »Jahrelang hatte ich diesen Traum …« Sie griff sich an die Stirn, doch ich kam ihr zuvor.
»Nicht nur du, Cyrena«, gestand ich ihr. Obwohl wir uns gegenüberstanden, fühlte ich mich ihr plötzlich meilenweit entfernt. »Jede Nacht träume ich, dass ich wach werde und mich in meinem alten Zimmer befinde. Dass ich nach Nysolis zurückgekehrt bin und alles nur ein Albtraum war. Ich will aufstehen und dich suchen gehen, aber ich habe es nie aus der Tür geschafft.« Ich räusperte mich. »Heute ist es mir gelungen.«
Aufmerksam betrachtete ich das ebenmäßige Gesicht meiner Schwester.
Ihre Stirn hatte sich in nachdenkliche Falten gelegt. »Ich erlebe etwas Ähnliches. Jede Nacht werde ich – wenn auch nur im Traum – von einer sonderbaren Melodie geweckt. Ich frage mich, woher sie kommt, bis mir bewusst wird, dass es sich um das Lied handelt, das Vater uns immer vorgesungen hat, als wir nicht einschlafen konnten. Es dauert einen Moment, bevor ich realisiere, dass du diejenige bist, die es singt … dann wächst der Wunsch in mir, dich zu sehen. Ich drehe am Knauf meiner Zimmertür …«
»Aber du wirst auf dein Bett zurückgeworfen, bevor du mich suchen gehen kannst«, beendete ich ihren Satz. Meine Schwester schloss den Mund und nickte. »Was ist heute anders?«, stellte sie mir die Frage, auf die ich selbst eine Antwort suchte.
Eine Möwe flog am Fenster vorbei. Wortlos griff ich nach Cyrenas Hand und zog sie an die breite Front, bis wir beide den Blick nach draußen gerichtet hatten.
»Es ist früh am Morgen«, hauchte sie. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass ihre Lippe bebte. »Wie ist das möglich?«
»Vielleicht …« Es kostete mich Mut, den Gedanken auszusprechen, weil er sich schon in meinem Kopf zu groß anfühlte. »Vielleicht ist das der Tag, auf den wir gewartet haben. Die … zweite Chance.« Meine Stimme wurde so leise, dass selbst ich mich kaum verstehen konnte. Aber Cyrena hatte jedes meiner Worte aufgenommen, das spürte ich.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust, als würde sie auf einmal frieren. Ein abwesender Ausdruck trat auf ihr Gesicht, den ich leider nur zu gut kannte. Ebenso wenig wie mir gelang es ihr, den Moment zu ehren und sich einzig darüber zu freuen, dass sie mich wiedersah.
Es steckte mehr dahinter, das wussten wir beide.
Zögernd streckte ich meine Hand nach ihrem Arm aus, berührte die Stelle, an der sich die feinen Härchen aufgerichtet hatten. Das Kleid, das sie trug, war ärmellos.
Cyrena drehte sich zu mir um, doch ihr Blick traf meinen nicht. »Es ist über zweihundert Jahre her«, murmelte sie. »Zweihundert Jahre.« Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie es selbst nicht glauben.
Ich trat einen Schritt näher an sie heran. Das Bedürfnis, sie zu berühren, wurde übermächtig. Mein Herz verzehrte sich nach ihr, sodass ich kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. »Ich will nicht mehr zurück«, raunte ich mit belegter Stimme. Gegen die Tränen, die sich wie selbstverständlich in meinen Augen sammelten, war ich machtlos. »Ich schaffe das keinen Tag länger.« Meine Hand ballte sich zur Faust.
Cyrena nahm mich stumm in den Arm, streichelte meinen Rücken, so wie sie es unzählige Male in meiner Kindheit getan hatte. Meine Schwester bedeutete Trost, Heimat und die Sicherheit, angekommen zu sein.
»Was, wenn das nur ein Trick ist?«, schluchzte ich, weil ich keinen Sinn darin sah, meine Empfindungen zu unterdrücken. »Eine weitere Strafe, der wir uns aussetzen müssen?«
Lange wartete ich auf eine Antwort, dachte schon, dass Cyrena sich weiter in Schweigen hüllen würde – doch dann schob sie mich sanft von sich.
Sie griff nach meiner Hand und nickte. »Lass uns nach draußen gehen.«
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ein Gefühl, angesiedelt zwischen Vorfreude und Panik, ergriff von mir Besitz.
Würde Cyrena mich nicht hinter sich herziehen, hätte mir der Mut gefehlt, ihr zu folgen.
Wir liefen durch den Flur, nahmen die stuckbesetzte Treppe nach unten und blieben in der Eingangshalle stehen. Im Palast war es gespenstisch still – ein Zeichen, dass wir noch nicht vollständig in der Realität angekommen waren. Ich beschloss, mich nicht auf die fehlenden Geräusche zu konzentrieren, sondern darauf, was meine Schwester mit mir vorhatte.
Meine Hand lag sicher in der ihren, ich vertraute ihr zu einhundert Prozent – dennoch konnte ich mich nicht fallen lassen. Meine Aufregung wurde unerträglich, als wir die goldverzierte Tür erreicht hatten, die nach draußen führte.
Zu so früher Stunde war sie verschlossen – doch würde sie sich überhaupt öffnen lassen?
Hin- und hergerissen schaute ich Cyrena an, die ebenfalls mit sich zu kämpfen schien. Doch sie straffte die Schultern, ließ meine Hand los und drückte die Tür auf.
Sonnenlicht schlug mir entgegen. Es war so grell, dass es mich blendete und ich die Augen schließen musste. Mehrmals blinzelte ich, konnte mich aber nur mit Mühe daran gewöhnen.
Beinahe blind folgte ich meiner Schwester nach draußen – und spürte, wie der Wind durch mein Haar glitt.
Wie von selbst breitete ich die Arme aus, drehte mich einmal um die eigene Achse. Anschließend nahm ich die sechs Stufen, die nach unten führten. Aus einem inneren Impuls heraus schlüpfte ich aus meinen Hausschuhen und vergrub die nackten Füße im warmen Sand.
Ein Seufzen entwich meinen Lippen – und endlich hatten sich meine Augen an das helle Licht gewöhnt.
Cyrena stand vor mir, den Kopf in den Nacken gelegt. Sie studierte einen Himmel, der hellblau war und auf dem nicht eine einzige Wolke stand. Es war ein warmer Morgen und bis auf das Rauschen des Meeres vollkommen still.
Das Meer.
Ich ging weiter nach vorn, durchquerte den Sandstrand, bis ich an der Stelle ankam, an der die Insel in das Meer überging.
Vorsichtig ließ ich mich auf die Knie sinken, streckte die Hand nach dem kühlen Nass aus und genoss den Moment, in dem die Wellen über meinem Arm zusammenbrachen.
Wie sehr ich dieses Meer hasste.
Wie unendlich ich es doch liebte.
Mit zitternden Beinen stand ich auf und drehte mich zu Cyrena um, auf deren Lippen ein zufriedenes Lächeln lag.
»Ob Traum oder nicht«, sagte sie und kam auf mich zu, »für diesen Moment hat es sich gelohnt, oder?«
Sie stellte sich neben mich, und zusammen schauten wir auf das Meer hinaus, das an diesem Morgen friedlich war.
Ich wusste aber zu genau, dass auch eine dunkle Seite in ihm lauerte und man es nicht unterschätzen durfte. Daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich schaute bis zur Küste, hinter der die Menschen lebten.
Was sich in den letzten zweihundert Jahren wohl geändert hatte?
Als hätte Cyrena meine Gedanken gelesen, meinte sie: »So viel Zeit ist vergangen und doch ist alles wie immer. Findest du nicht auch?«
Ich legte den Kopf schief, kniff die Augen zusammen und versuchte zu begreifen, worauf sie anspielte. Das Rauschen des Ozeans drang wie eine sanfte Melodie an meine Ohren.
Cyrena stellte sich dichter neben mich und legte mir den Arm um die Schultern. »Falls wir gleich zurückgeschleudert werden und sich dies alles vor uns auflöst, will ich dir sagen, dass ich dich unendlich liebe. Und dass mir alles so leidtut.«
Ich musste sie nicht ansehen, um zu wissen, wie ihr Gesicht aussah. Wie viele Emotionen sich darauf tummelten und wie schwer es ihr fiel, mir diese Wahrheit einzugestehen.
Kaum merklich nickte ich, dann drehte ich mich ihr zu. Der Hass hatte schon lange keinen Raum mehr in mir.
»Ich liebe dich auch«, raunte ich. »Über alle Zeiten, Dimensionen und Ewigkeiten hinweg. Vielleicht haben wir diesen Moment bekommen, um einander zu verzeihen.«
Cyrena lächelte mich lieb an. Uns trennte nur ein Jahr und obwohl sie die Ältere war, hatten sich meine Eltern dafür entschieden, dass ich die Herrschaft über Nysolis weiterführen sollte. Ich war das Mädchen aus Gold, sie die Prinzessin aus Silber. Nur zusammen konnten wir wahrhaft Großes vollbringen.
»Ich habe es hassen gelernt«, riss mich Cyrenas Stimme aus den Gedanken. »Ich habe es jede Nacht verteufelt und verflucht. Gedacht, dass all die Schönheit, die vor uns liegt, eine Illusion ist und wir uns die guten Seiten nur eingebildet haben.« Ihr Blick war auf das Meer gerichtet, ihre Hand fest mit meiner verschränkt.
Auch ich betrachtete das sanfte Spiel der Wellen, die unendliche Weite des Ozeans.
»Mir geht es nicht anders. All das habe ich einmal so geliebt – und ich tue es auch jetzt, wenn ich mir das Meer anschaue. Dennoch …« Ich schluckte, bewusst darüber, dass ich den Satz nicht zu Ende führen wollte. Nicht jetzt, da die Sonne über uns schien und uns vorgaukelte, dass es einen Ausweg aus der ewigen Nacht gab.
Cyrenas Griff um meine Hand verstärkte sich. »Kannst du dich noch daran erinnern, wie du schwimmen gelernt hast?«, fragte sie und drehte ihren Kopf mir zu. Ein Lächeln lag auf ihren Lippen, doch ihr Blick war von Nostalgie durchdrungen. »Du hast viel länger gebraucht als ich, dich vor dem Wasser gefürchtet und wolltest es nicht berühren.«
»Ich hatte Angst, dass es mich in die Tiefe reißt«, erklärte ich mit belegter Stimme. Vor meinem inneren Auge sah ich mein fünfjähriges Ich, das sich an die Hand seiner Mutter klammerte, weil es sich nicht bis zu der Stelle wagte, an der der Strand in das Meer überging. »Ich fand die Vorstellung schaurig. Den Boden zu verlassen und sich in das Unbekannte zu wagen. Das Meer hat mir Angst gemacht mit seinen hohen Wellen und den Tausenden Geheimnissen, die in seinen Tiefen lauern. Während du den Tag, an dem du endlich schwimmen lernst, kaum erwarten konntest, bin ich am Strand stehen geblieben und habe mich geängstigt.«
Eine Gänsehaut, deren Ursprung ich nicht ausmachen konnte, legte sich über meine Arme.
Das Lächeln meiner Schwester jedoch blieb bestehen. Ein sonderbares Funkeln trat in ihre Augen. »Vater hat dich irgendwann gezwungen«, murmelte sie und lachte angesichts der Erinnerung, die in mir immer noch ein Schaudern hervorrief. »Er hat dich gepackt, obwohl du gestrampelt und geschrien hast, und dich einfach in die Fluten geworfen.«
»Ich bin untergegangen, überall war Wasser … Es war so kalt und ich dachte, mein letztes Stündchen hätte geschlagen.« Ich schüttelte den Kopf. Obwohl das Ganze gut ausgegangen war, hatte ich meinem Vater nie wirklich verziehen. »Vater hat mich rausgeholt … aber er hat es wieder und wieder getan. Und mir jedes Mal erklärt, wie man schwimmt. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste es lernen.« Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper, weil ich zu frieren begann.
»Mutter dachte, dass du das Meer auf ewig hassen würdest, Vater hingegen war sich sicher, dass es klappen würde. Er hat dir das Schwimmen beigebracht und dich immer wieder gezwungen, dich deinen Ängsten zu stellen«, fuhr Cyrena fort.
Ich sah sie von der Seite an – meine stolze, wunderschöne Schwester. Früher hatte ich sie oft aufgrund ihres Aussehens beneidet, wollte ihre Ozeanaugen haben, die hohen Wangenknochen oder das spitze Kinn. Es hatte seine Zeit gedauert, bis ich erkennen konnte, dass auch ich wunderschön war, und die optischen Differenzen, die zwischen uns lagen, mich nicht weniger hübsch machten als sie.
»Ich habe meine Schwimmstunden gehasst«, erinnerte ich mich seufzend. »Sie haben mir eine Heidenangst eingejagt und jedes Mal habe ich nach einer Ausrede gesucht, nur keine gefunden. Vater ließ nicht locker.«
»Dennoch hast du das Meer irgendwann geliebt«, sagte Cyrena mit melodischer Stimme.
Ich lächelte leicht, dann schüttelte ich den Kopf. »Ich habe es nicht geliebt, weil Vater mich so unbarmherzig mit ihm bekannt gemacht hat, sondern weil ich angefangen habe, mich nachts aus dem Palast zu schleichen und mich selbst auf das Meer einzulassen. Ich wollte meine Angst vor ihm verlieren und wusste, dass das nur gelingen würde, indem ich es kennenlernte. Viele Nächte saß ich am Strand und habe die Wellen beobachtet. Erst zwei Wochen später bin ich hineingegangen … aber alles ging sehr langsam vonstatten. Ich wusste, dass ich meinen Plan zerstören würde, wenn ich etwas überstürzte.« Ich holte tief Luft, überwältigt von Erinnerungen, von Tagen und Momenten, an die ich schon sehr lange nicht mehr gedacht hatte. »Ich habe das Meer lieben gelernt, weil ich mich selbst dafür entschieden habe. Auf eine leise, intensive Art und Weise. Als ich erkannte, dass das Wasser auch mein Freund sein konnte … beschloss ich, ihm zu vertrauen.«
Ein leichtes Gefühl durchströmte mich, das mich an Schwerelosigkeit erinnerte. Doch ein Blick auf das Gesicht meiner Schwester ließ mich erstarren. Cyrenas Lächeln war eingefroren, ihre Augen zu Schlitzen verzogen. Sie starrte geradeaus, danach wandte sie sich mir zu. Alle Wärme war aus ihrem Blick gewichen.
Sie wirkte um Jahre älter, als sie sagte: »Wie sehr wir uns haben täuschen lassen. Das Meer ist nicht unser Freund – und wird es niemals sein.«
Kapitel 3 - Finlay
Jeden Morgen klingelte mein Wecker um 6:45 Uhr. Jeden Morgen wurde ich aus meinen Träumen gerissen. Jeden Morgen spielte ich mit dem Gedanken, die Schule zu schwänzen, die Stadt zu verlassen und irgendwo neu anzufangen. Und jeden Morgen verwarf ich das Vorhaben wieder, weil es Niall das Herz brechen würde.
Also streckte ich die müden Glieder und schwang mich aus dem Bett. Lustlos schlurfte ich ins Bad, um mich zu waschen und mir die Zähne zu putzen.
Irgendwann hatte ich einmal darüber nachgedacht, den Spiegel abzuhängen, doch es brachte nichts, die Augen vor der Wahrheit zu schließen, denn sie änderte sich dadurch nicht. Und meine verbrannte Wange, mein schiefes linkes Auge und die Lippe, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden war, verschwanden nicht, nur wenn ich sie nicht betrachtete.
Das Schicksal hatte mir übel mitgespielt, da es mir meine Makel mitten im Gesicht – auf den ersten Blick erkennbar – verpasst hatte. Ein deformiertes Knie hätte ich verstecken können, ebenso wie ein paar Narben am Bauch, aber meine Hässlichkeit sah man mir quasi an der Nasenspitze an.
Grummelnd lief ich in mein Zimmer zurück, zog mir die Schuluniform über, die aus einem weißen Hemd, einer schwarzen Krawatte und einer grauen Stoffhose bestand, und griff nach meinem Rucksack.
Ein langer Tag lag vor mir: acht Stunden Unterricht, von denen ich fünf in unmittelbarer Nähe von Connor verbringen würde. Nicht zu vergessen die Pausen, in denen er praktisch überall war, obwohl ich mir immer Mühe gab, ihm aus dem Weg zu gehen.
Ich nahm die Treppe nach unten und zog verwirrt die Augenbrauen zusammen, als ich bemerkte, dass Niall noch da war. Normalerweise verließ er das Cottage früh, um den Laden rechtzeitig aufzumachen. Heute saß er allerdings auf seinem Sessel vor dem Fernseher, starrte angestrengt auf den Bildschirm und reagierte auch nicht, als ich ihm einen guten Morgen wünschte.
Ich ließ meinen Rucksack auf den Boden fallen und zog mir einen Stuhl zurecht, um mich zu Niall zu setzen.
Da wurde er auf mich aufmerksam, doch der Blick, den er mir zuwarf, war voller Sorge. »Man hat schon wieder jemanden gefunden«, verkündete er mit belegter Stimme.
Ich warf einen Blick auf den Fernseher, auf den schmalen Sandstreifen, der gezeigt wurde mit dem rauschenden Meer dahinter. Ich musste mich nach vorn beugen, um den geschändeten Männerkörper erkennen zu können, der wie eine Opfergabe am Strand lag und auf dessen Kopf eine Möwe saß. Mich schauderte es, allerdings nicht so sehr wie beim ersten Mal.
Niall musterte mich bedeutungsschwer. »Der Mann war nur ein paar Jahre älter als du, Fin«, sagte er mit Nachdruck. »Es ist heute Nacht passiert, direkt an der Küste. Ich will nicht, dass du dich abends so lange allein noch herumtreibst, hörst du?« Er zog seine Brille hoch und blickte mich streng an.
Ich ließ die Schultern hängen. Gern hätte ich ihm zugestimmt, nur war das Meer momentan die einzige Medizin, die irgendwie bei mir einschlug, und wenn man sie mir vorenthielte, würde ich durchdrehen. Mein Mund öffnete sich zu einer Erwiderung, dennoch blieb ich stumm.
Niall seufzte und drehte den Sessel so, dass wir uns gegenübersaßen. »Ich weiß, wie viel dir das Meer bedeutet und wie gern du allein durch die Dünen streifst … Es ist ja auch nicht für immer.«
»Aber doch auf unbestimmte Zeit«, hielt ich dagegen und kam mir vor wie ein kleines, bockiges Kind. »Seit Monaten werden tote Männer gefunden und niemand hat eine Idee …« Ich schüttelte den Kopf.
»Mir ist einfach nicht wohl bei dem Gedanken, dass du dich nach Sonnenuntergang allein am Strand herumtreibst«, erklärte Niall. Die Sorge ließ seine Stimme traurig werden und erschwerte mir den Widerstand. »Wieso gehst du nicht einfach in die Innenstadt? Du könntest mit Peter mal wieder ins Crawley’s.« Er lächelte leicht. Seine Hand legte sich auf meine Schulter und drückte sie sanft.
Niall war normalerweise niemand, der sich etwas aus Berührungen machte. Wir verstanden uns gut, fühlten einander nah, zeigten es jedoch nicht körperlich. Vielleicht war das der Grund, wieso sich seine Hand wie ein Fremdkörper anfühlte.
Entschlossen stand ich vom Stuhl auf. »Weiß man denn nach wie vor nichts? Es muss doch eine Todesursache geben, irgendetwas.«
Ich ging zum Kühlschrank, um mir aus den Resten ein Frühstück zusammenzustellen. Viel mehr als zwei Bananen und einen Joghurt fand ich nicht. Seufzend griff ich danach, schnappte mir einen Löffel und setzte mich wieder zu Niall.
»Irgendeine Spur werden sie schon haben«, meinte er. »Die Polizei weiß immer mehr, als sie an die Medien weitergibt. Etwas Endgültiges scheint noch nicht festzustehen.«
»Und der Neue?« Ich hob das Kinn und deutete auf das Fernsehbild, das noch immer die Leiche des Mannes zeigte.
Mein Onkel verschränkte die Arme vor der Brust. »Es ist das Gleiche wie bei den Männern zuvor. Das Herz wurde ihm gewaltsam aus der Brust gerissen, abgesehen davon ist er unversehrt. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Falls ein Mensch dahintersteckt …« Er hob die Arme und sah mich überfragt an.
»In der Schule reden sie ständig darüber«, sagte ich und tauchte den Löffel in den Joghurt. »Die Lehrer haben uns verboten, das Thema weiter auszuschlachten, doch es ist schwierig, darüber zu schweigen. Vor allem, wenn es bei uns in der Nähe passiert.«
Niall nickte. Entschlossen griff er nach der Fernbedienung und schaltete das Gerät aus. »Ich hoffe nur, dass es bald ein Ende hat. Bislang kannte ich die Männer nicht, aber es kann jeden treffen. Deswegen möchte ich, dass du vorsichtig bist.« Er bedachte mich mit einem langen Blick.
»Versprochen.« Ich leerte den Joghurt und entschied mich, die Bananen mit in die Schule zu nehmen. »Bis später, und viel Spaß im Laden.« Geräuschvoll schob ich den Stuhl nach hinten und hob die Hand zum Gruß.
»Viel Spaß in der Schule, Fin!«
Spaß in der Schule. Ich wusste nicht, wann ich den zum letzten Mal gehabt hatte. Die letzten Jahre waren ein Kontinuum aus Ausgrenzung, Hänseleien und körperlichen Übergriffen gewesen. Ich hatte noch nie zu den Beliebten gehört – und auch nicht das Bestreben, dies eines Tages zu ändern –, die Pubertät schien meine Missbildung im Gesicht für die anderen allerdings nur deutlicher zu machen und einen hervorragenden Anlass abzugeben, mich auszuschließen.
Meine Hände waren zu Fäusten geballt, als ich mich auf den Weg in die Schule begab. Chatair war eine kleine Stadt, was unweigerlich bedeutete, dass ich meine Mitschüler bereits seit dem Kindergarten kannte und wir selten jemand Neuen begrüßen durften.
Ich hatte mir immer gewünscht, an einer großen Schule untertauchen zu können oder an einem Ort lernen zu dürfen, an dem es niemanden kümmerte, wie ich aussah, wo ich herkam oder für was ich mich interessierte. Doch das war ein ferner Traum, der sich so schnell nicht erfüllen würde.
Es gäbe einen Bus, der mich bis vor die Schule brächte. Bis zur Haltestelle dauerte es nur wenige Minuten. Dennoch hatte ich mich vor einigen Monaten dagegen entschieden. Bus zu fahren, bedeutete, Connor, Brian und Henry früher über den Weg zu laufen und ihre dummen Sprüche schon vor Schulbeginn über mich ergehen zu lassen. Deswegen stand ich eher auf, ging den Weg zu Fuß und redete mir ein, dass es ohnehin besser war, frische Luft zu schnappen.
Ich ging an Wiesen und Feldern vorbei, während meine Gedanken unaufhaltsam um die Schule kreisten. Seufzend versuchte ich, mich auf die Musik in meinen Kopfhörern zu konzentrieren, doch ich schaffte es nicht, das, was vor mir lag, auszublenden.
Ich ließ den Blick über eine Schafherde schweifen, passierte eine Scheune und nahm den Hügel nach oben, von wo aus man auf die Stadt schauen konnte.
Bereits mein ganzes Leben lang wohnte ich in Chatair, weswegen es mir schwerfiel zu sagen, ob der Ort ein Platz war, den man landläufig als schön bezeichnete. Ich mochte die roten Dächer der Wohnhäuser und die Tatsache, dass es für jedes Anliegen – Kleidung, Hunger, Zahnschmerzen – meist nur eine Anlaufstelle gab. Was ich nicht mochte, war die ewige Routine. Die Tatsache, dass jeder Tag wie der vorherige war und sich nichts je änderte. Nun … bis auf die Männer, die tot am Strand gefunden worden waren.
Energisch schob ich den Gedanken beiseite und lief den Waldweg entlang, der in die Stadt führte. Schon von Weitem konnte ich die Schule sehen, sie war eines der höchsten Gebäude Chatairs.
Früher hatte es mich nicht gestört, morgens aufzustehen und die Hälfte meines Tages dort zu verbringen, jetzt konnte ich regelrecht spüren, wie sich mein Körper dagegen sträubte, den grauen Kasten zu betreten, und mir schlecht wurde. Früher war da jemand gewesen, mit dem ich die Pausen verbringen konnte. Heute gab es nur noch mich.
Automatisch drosselte ich mein Tempo, auch wenn ich wusste, dass das gar nichts ändern würde. Die Zeit war in diesem Fall nicht auf meiner Seite, sondern arbeitete kontinuierlich gegen mich. Ich schulterte meinen Rucksack und lief weiter.
Vor dem Eingangstor blieb ich stehen. Ich war früh – früh genug, um Connor nicht zu begegnen, der erst kurz vor Beginn der Stunde da sein würde.
Mit gesenktem Blick schlich ich mich in das Gebäude, nahm die Treppe in den ersten Stock und ging zu meinem Spind, in dem ich meine Bücher aufbewahrte. In der ersten Stunde hatte ich Englisch bei Mrs O’Brien – ein Fach, das ich mal gemocht hatte. Nun hoffte ich einfach, dass die Zeit schnell verging.
Ich fischte das Englischbuch aus dem Spind, verschloss ihn und ging den Flur entlang bis zu unserem Klassenzimmer, das glücklicherweise nicht verschlossen war. So konnte ich mich auf meinen Platz in der letzten Reihe setzen und mich unsichtbar machen.
Ich atmete erleichtert aus, als ich erkannte, dass außer mir niemand hier war. Wie immer verlor ich mich in der Hoffnung, dass Connor krank sein oder sich zumindest verspäten würde.
Ein paar Monate noch, dann hatte der Spuk ein Ende. Ein paar Monate noch stark sein, das würde ich schaffen!
Ich zog Mäppchen und Block aus meinem Rucksack und schlug die Seite im Buch auf, auf der wir stehen geblieben waren. Das Lernen hatte mir noch nie Probleme bereitet, doch in letzter Zeit war mein Kopf so voll, dass es mir schwerfiel, mich auf banale Themen wie Ulysses von James Joyce zu konzentrieren.
Seufzend lehnte ich mich im Stuhl zurück und schaute aus dem großen, schmutzigen Fenster in den trüben Tag.
»Hilfe!«, ließ mich eine Stimme zusammenzucken. Fragend legte ich den Kopf schief und spitzte die Ohren.
»Hilfe!«, erklang es erneut, lauter dieses Mal. Die Stimme war weiblich – ich hatte keine Ahnung, zu wem sie gehörte.
Perplex stand ich von meinem Stuhl auf, durchquerte den Klassenraum und schielte in den Korridor, der verlassen dalag.
»Ist denn hier niemand? Sie wollen mir wehtun!«
Panik durchdrang mich. Ich lief den Flur entlang, folgte der unbekannten Stimme und blieb schließlich vor den Toiletten stehen, aus denen ich die Schreie vermutete.
»Hallo?«, rief ich. »Wo bist du?«