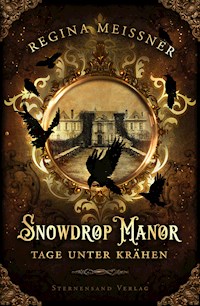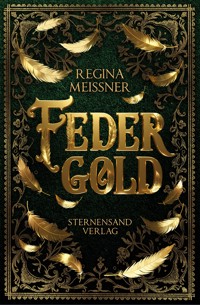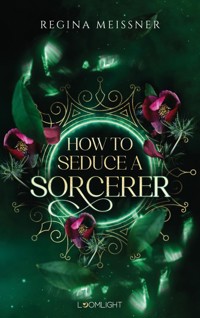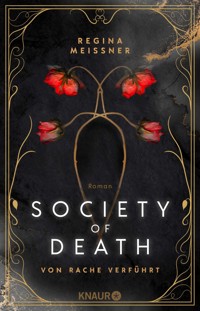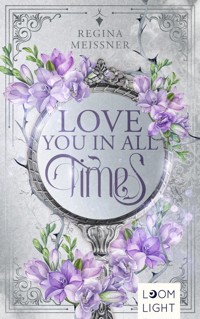Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das versunkene Reich Nysolis
- Sprache: Deutsch
Finlay möchte Prinzessin Aurora helfen, das Königreich Nysolis zu retten und damit den Fluch zu lösen, der über sie und ihre Familie gesprochen wurde. Daher willigt er ein, die Prinzessin auf eine waghalsige Reise durch das Meer zu begleiten, die unzählige Gefahren birgt und sie an ihre Grenzen bringt. Nicht nur er muss über sich hinauswachsen, sondern auch Aurora, die ein düsteres Geheimnis vor ihm verborgen hält. Je näher sie dem Ziel ihrer Aufgabe kommen, desto stärker drängen sich allerdings Fragen auf. Was ist der Preis für die Rettung eines Volkes? Und sind Aurora und Finlay tatsächlich gewillt, diesen am Ende zu bezahlen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Kapitel 1 - Finlay
Kapitel 2 - Aurora
Kapitel 3 - Finlay
Kapitel 4 - Aurora
Kapitel 5 - Finlay
Kapitel 6 - Aurora
Kapitel 7 - Finlay
Kapitel 8 - Aurora
Kapitel 9 - Finlay
Kapitel 10 - Aurora
Kapitel 11 - Finlay
Kapitel 12 - Aurora
Kapitel 13 - Finlay
Kapitel 14 - Aurora
Kapitel 15 - Finlay
Kapitel 16 - Aurora
Kapitel 17 - Finlay
Kapitel 18 - Aurora
Kapitel 19 - Finlay
Kapitel 20 - Aurora
Kapitel 21 - Finlay
Kapitel 22 - Aurora
Kapitel 23 - Finlay
Kapitel 24 - Aurora
Kapitel 25 - In den Tiefen des Ozeans
Kapitel 26 - Aurora
Kapitel 27 - Aurora
Nachwort
Regina Meißner
Das versunkene Reich Nysolis
Band 2
Fantasy
Das versunkene Reich Nysolis (Band 2)
Finlay möchte Prinzessin Aurora helfen, das Königreich Nysolis zu retten und damit den Fluch zu lösen, der über sie und ihre Familie gesprochen wurde. Daher willigt er ein, die Prinzessin auf eine waghalsige Reise durch das Meer zu begleiten, die unzählige Gefahren birgt und sie an ihre Grenzen bringt. Nicht nur er muss über sich hinauswachsen, sondern auch Aurora, die ein düsteres Geheimnis vor ihm verborgen hält.
Je näher sie dem Ziel ihrer Aufgabe kommen, desto stärker drängen sich allerdings Fragen auf. Was ist der Preis für die Rettung eines Volkes? Und sind Aurora und Finlay tatsächlich gewillt, diesen am Ende zu bezahlen?
Die Autorin
Regina Meißner wurde am 30.03.1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren, in der sie noch heute lebt. Als Autorin für Fantasy und Contemporary hat sie bereits viele Romane veröffentlicht. Weitere Projekte befinden sich in Arbeit.
Regina Meißner hat Englisch und Deutsch auf Lehramt in Gießen studiert. In ihrer Freizeit liebt sie neben dem Schreiben das Lesen und ihren Dackel Frodo.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Juli 2021
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021
Umschlaggestaltung: Sternensand Verlag GmbH | Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Korrektorat 2: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick Illustration S. 423: Laura Battisti |The Artsy Fox
Satz: Sternensand Verlag GmbH
Druck und Bindung: Smilkov Print
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-199-4
ISBN (epub): 978-3-03896-200-7
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für die grüne Insel.
Du bietest mehr Inspiration, als zwischen zwei Buchdeckel passt.
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Kapitel 1 - Finlay
Das Bett unter mir fühlte sich fremd an. Fremd, weil ich seinen Geruch nicht kannte, der Lattenrost quietschte, wenn ich mich drehte, und ich in der Matratze regelrecht versank. Es fühlte sich fremd an mit seiner dicken weißen Blumendecke und den sechs Kissen, von denen ich die Hälfte schon auf den Boden geworfen hatte, um ein bisschen mehr Platz zu finden.
Es fühlte sich fremd an – und doch genau richtig.
Denn es war ihr Bett. Es waren ihre Kissen, ihre Matratze und ihre Blumendecke.
Auf die Frage hin, wo ich die Nacht verbringen sollte, hatte Aurora mich mehr oder weniger kommentarlos in ihr Zimmer gezogen und mir verdeutlicht, dass sie selbst im Bett ihrer Schwester schlafen wollte, um deren Gegenwart nicht zu verlieren. Sie hatte mich in ihrem Zimmer stehen gelassen und mich schal angelächelt.
Seitdem lag ich auf ihrem Bett und jagte sinnlosen Gedanken nach, die mich vom Einschlafen abhielten.
Aurora hatte unseren Kuss mit keinem Wort kommentiert, doch irgendetwas sagte mir, dass sie ihn nicht bereute. Dass sie ihn genossen hatte – denn das konnte ich aus ihren Bewegungen lesen, ihrem Seufzen und der Tatsache, dass sie schnell die Kontrolle an sich gerissen hatte, sodass nicht mehr ich sie küsste, sondern sie mich.
Dennoch stand er jetzt zwischen uns – dieser Kuss, der aus einem inneren Bedürfnis heraus gewachsen war und schnell ein Eigenleben entwickelt hatte.
Ich drehte mich auf die Seite, zum Fenster hin, und kickte das vierte Kissen auf den Boden. Obwohl es hier drinnen eigentlich nicht kalt war, fror ich – und das schon eine ganze Weile. Mein Kopf war voll mit Gedanken, die ich nicht abschütteln konnte.
Aurora und ich hatten uns darauf geeinigt, die Aufzeichnungen ihres Bruders erst morgen anzusehen. Ein langer Tag lag hinter uns, unsere Konzentration war so gut wie nicht mehr vorhanden – und eine überstürzte Sichtung half uns nicht.
Ob sie schlafen konnte? Fand sie sich in lebhaften Träumen wieder oder jagte sie genauso unruhig wie ich im Bett Hirngespinsten nach? Dachte sie an mich? An unseren Kuss? Oder galten ihre Gedanken einzig Pehlon und unserer Mission?
Mit meinem Brief hatte ich die menschliche Welt und alles, was mit der Existenz von Finlay O’Sullivan zusammenhing, hinter mir gelassen. Ich hatte mich verabschiedet von einer schwierigen sozialen Situation, der nagenden Frage nach der Zukunft und von Connor, Henry und Brian, die in der Schule jeden Moment ausnutzten, um mich zu terrorisieren.
Aber ich hatte auch von Niall Abschied genommen. Von meinem Onkel, dem einzigen Menschen, der mir wirklich etwas bedeutete und dem ich jetzt Sorgen bereitete, obgleich ich doch nur das Beste für ihn wollte.
Wenn Niall meinem Brief Glauben schenkte, hatte ich die Stadt verlassen, um meine Bestimmung im Leben zu finden, um zu erfahren, wer ich wirklich war und wo meine Talente lagen. Obwohl ich so kurz vor meinem Abschluss stand.
Ich wusste nicht, ob er meine Worte vielleicht jetzt schon anzweifelte. Mit großer Sicherheit hatte ich ihm das Herz gebrochen.
Müde rappelte ich mich im Bett auf und ging zu der großen Fensterfront. Ein funkelnder Sternenteppich, begleitet von einem schimmernden Mond, sorgte dafür, dass der Raum noch immer erhellt war, auch wenn die Mitternacht längst hinter uns lag. Ich hätte die Vorhänge zuziehen und für Dunkelheit sorgen können, nur gefiel mir der Blick nach draußen.
Obwohl ich fror, öffnete ich das Fenster und streckte den Kopf in die frische Luft. Kurz schloss ich die Augen, bevor ich sie dem Himmelsspektakel zuwandte.
In meiner Kindheit hatte ich unzählige Sternschnuppen gesehen und die lächerlichsten Wünsche an sie vergeudet, doch jetzt, da ich eine dringend gebrauchen konnte, schenkte mir der Himmel keine.
Ich verlor mich in der hellen Fassade des Mondes und fragte mich, ob er auch eine dunkle Seite hatte. Denn nichts war ausschließlich gut oder böse – und auch Aurora hatte mich vor ihren Geheimnissen gewarnt. Ich kannte die Prinzessin von Nysolis erst wenige Tage, trotzdem bildete ich mir ein, eine Menge über sie zu wissen, was schlicht und einfach nicht wahr sein konnte.
Dennoch versank ich gern in ihren smaragdgrünen Augen, in der Sicherheit, dass ich einige ihrer Mysterien bereits ergründet hatte.
Als der Wind heftiger wurde, schloss ich das Fenster.
Das Meer war dunkel und wild – eine gefährliche Mischung, die mir den Gedanken an die nächsten Tage erschwerte. Aurora und ich würden uns in die Tiefen des Ozeans begeben, auf der Suche nach dem ewigen Licht, welches nicht nur ihre Familie, sondern auch ein ganzes Unterwasservolk zurückbringen sollte.
Ich schluckte schwer. Die größte Schwäche unseres Plans bestand wohl darin, dass wir kaum etwas über den tiefen Teil des Meeres wussten. Hoffentlich waren Pehlons Aufzeichnungen ergiebig. Immerhin hatte er mehr als zweihundert Jahre Zeit gehabt, um alle wichtigen Informationen zusammenzutragen.
Noch immer konnte ich Auroras Bruder nicht richtig einschätzen. Auf der einen Seite hatte er sich mir gegenüber immer freundlich verhalten und schien große Hoffnungen in mich zu setzen. Auf der anderen Seite war er für den Untergang von Nysolis verantwortlich, weil er sein eigenes Wohl über das seines Volkes gestellt hatte und in die Menschenwelt gegangen war.
Aurora konnte ihm nicht verzeihen, sosehr sie es auch versuchte. Pehlons Verrat wog schwer.
Ich ging an dem langen, schmalen Spiegel vorbei, in dem ich mich nicht betrachten wollte, und stahl mich hinaus auf den Korridor, der diffus von Kerzen erhellt wurde. Das Schloss lag in völliger Stille da, Aurora und ich waren die Einzigen, die hinter seinen hohen Mauern Zuflucht suchten.
Mein Herz hämmerte in der Brust, als ich die Treppe nach unten nahm und den Eingangsbereich des Palasts erreichte.
Aurora hatte die Türen, die nach draußen führten, verschlossen, bevor wir schlafen gegangen waren, doch ich wusste, wo sie den Schlüssel aufbewahrte.
Mit geschickten Handbewegungen schloss ich auf und schlüpfte ins Freie, wo mich eine eiskalte Nacht begrüßte.
Ich schlang die Arme um den Oberkörper und verfluchte mich dafür, dass ich nur ein T-Shirt trug und mir der Gedanke, eine wärmere Jacke mitzunehmen, gar nicht erst gekommen war. Aber ich wollte ohnehin nicht lange hierbleiben.
Meine nackten Füße versanken im Sand, ich lief so weit, bis das Wasser meine Beine umspielte. Eine Muschel wurde neben mir an Land getragen, gefolgt von Algen, die im fehlenden Licht glitschig erschienen und mich ekelten.
Nachdenklich betrachtete ich das Spiel der Wellen, die sich stürmisch an den Felsen brachen.
Irgendwo dort draußen im Meer befand sich Auroras Schwester Cyrena, die in ein Seeungeheuer verwandelt worden war. Während Cyrena jetzt ihren animalischen Trieben nachgab und ihr Verlangen stillte, fürchteten wir, sie für immer verloren zu haben.
In Chatair häuften sich die Todesfälle, für die die Polizei keine Ursache fand. Männer wurden mit aufgerissenem Brustkorb ohne Herzen am Strand vorgefunden, ohne dass es den kleinsten Hinweis auf den Täter gab.
Anfangs hatte ich an einen Perversen gedacht – dass in Wahrheit Auroras Schwester dahintersteckte, schockierte mich heute noch. Ebenso wie alles, was mit Magie zusammenhing.
Magie.
Wie aufs Stichwort versteifte sich mein Körper, und eine eisige Kälte ergriff von mir Besitz, die sich bis in die Nervenenden meiner Fingerspitzen schlich.
Magie war der Grund, wieso ich Auroras Schloss erst verlassen hatte. Weil ich mich in seinen weitläufigen Hallen und Sälen, auch wenn diese leer waren, beobachtet fühlte. Weil ein Teil von mir die Wahrheit noch immer nicht akzeptierte.
Denn ich war längst nicht mehr nur Finlay O’Sullivan – der Sohn eines Toten und einer Prostituierten. Ich war ein Nachkomme von Auroras Bruder Pehlon, der sich in eine Menschenfrau verliebt und mit ihr einen Sohn gezeugt hatte. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich der Stammbaum weiter, bis er schließlich in mir seinen Höhepunkt fand.
Dabei erschien mir der alleinige Gedanke, zaubern zu können, so grotesk, dass ich ihn immer noch verdrängen wollte.
Jedoch wusste ich längst, dass Pehlon recht hatte – und die drei Male, in denen ich bereits Magie gewirkt hatte, waren auch nicht von der Hand zu weisen. Dennoch hatte ich nach wie vor keine Ahnung, wie meine Kräfte funktionierten.
Als Erstes war es mir gelungen, das Wetter zu ändern, beim zweiten Mal hatte ich die Magie in einem uralten Felsen gespürt, doch erst beim dritten Versuch war ich mir annähernd bewusst darüber geworden, was ich tat.
Deutlich erinnerte ich mich an den Moment, in dem sich eine Druckwelle aus meiner Hand gelöst und Connor, Henry und Brian in die Luft geschleudert hatte. Mir kam es vor, als läge das Ereignis mehrere Monate zurück, in Wahrheit hatte es sich erst vor wenigen Stunden zugetragen.
Ich schaute auf meine Hände hinab.
Nun, da ich mit Sicherheit wusste, dass da eine übernatürliche Kraft in mir ruhte, wollte ich herausfinden, wie mit ihr umzugehen war.
Ich zog meine Füße aus dem kalten Wasser und ging zum Strand zurück. Mit Blick auf das Meer streckte ich die rechte Hand aus, so wie ich es heute Morgen auch bei Henry, Brian und Connor getan hatte.
Ich schloss die Augen und kniff die Lippen zusammen. Lautlos zählte ich bis zehn und wartete darauf, dass sich etwas tat oder sich etwas in mir regte. Doch da war nichts – außer der Überzeugung, dass ich mich gerade ziemlich zum Affen machte.
Enttäuscht öffnete ich die Lider.
Auf die Frage hin, wie sich Magie anfühlen würde, hatte Aurora mir gesagt, dass sie zunächst ein tiefes Vibrieren in der Brust wahrnahm, das schnell stärker wurde, gefolgt von einem warmen Gefühl, welches den ganzen Körper in Beschlag nahm und das von dem Verlangen, aktiv zu werden, etwas zu tun, abgerundet wurde.
Neugierig horchte ich in mich hinein, doch da war nichts, was auch nur im Entferntesten ihren Beschreibungen glich. Vielleicht musste sich Magie aber auch gar nicht immer so anfühlen. Vielleicht äußerte sie sich bei jedem Wesen anders.
Bevor ich Gefahr lief, aufzugeben, hob ich erneut die Hand.
Egal, wie weit der Mond von der Erde entfernt war, man konnte ihn stets mit ein paar Fingern überdecken.
Ich nahm die zweite Hand dazu, positionierte sie vor der ersten und konzentrierte mich ein zweites Mal.
Unterbewusst wartete ich darauf, dass etwas geschah, doch ich hatte mich nie menschlicher gefühlt als in diesem Augenblick.
Mir kam der Gedanke, dass das Problem vielleicht an einer ganz anderen Stelle lag, denn ich wusste zwar, dass ich zaubern wollte, aber nicht was.
Nachdenklich schaute ich mich am Strand um, bis mein Blick wieder an der kleinen Muschel hängen blieb.
Vielleicht könnte ich sie zum Schweben bringen – das durfte ja nicht so schwer sein. Wenn es mir gelang, drei Menschen durch die Luft zu schleudern, sollte ich es schaffen, eine Muschel anzuheben, ohne die Finger zu benutzen.
Ich sank auf die Knie und betrachtete das weiße Exemplar, das an den Rändern unschöne Kerben aufwies.
Während ich mich auf die Macht in meinem Inneren besann, streckte ich die Hand abermals aus und formte sie zur Faust, um mehr Kraft auszuüben.
Doch je angestrengter ich auf die Muschel schaute, desto unmöglicher kam es mir vor, sie zum Schweben zu bringen.
Entnervt schnipste ich sie mit dem Finger weg.
Brauchte man für so etwas vielleicht einen Zauberspruch? Worte in einer fremden Sprache, durch die sich der Bann erst entfaltete?
Wenn Aurora Magie wirkte, kam es mir natürlich vor, so als gehörten die übernatürlichen Kräfte ebenso zu ihr wie das lange goldene Haar und die Alabasterhaut. Auch Pehlon war geschickt im Umgang mit Zaubern – wieso gelang es mir nur nicht?
Ich zermarterte mir den Kopf nach allen Fantasyfilmen, die ich je gesehen hatte, in der Hoffnung, dort einen Anhaltspunkt zu finden. Vielleicht steckt ja in irgendeinem ein Funken Wahrheit.
Abermals erhob ich mich und streckte die Schultern durch.
Spontan war mir ein älterer Film in den Sinn gekommen, in dem die männliche Hauptperson zum Zaubern die Hände ineinander verschränkt hatte. Ich erinnerte mich, dass er mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen musste, um Magie zu wirken.
Neben mir lag ein kleiner schwarzer Stein. Vielleicht könnte ich diesen schweben lassen.
Ich vergrub die Füße im Sand, bemühte mich um einen festen Stand und verschränkte die Hände ineinander. Abwechselnd schaute ich den Stein an und zum Meer hinaus.
Ein Räuspern ließ mich zusammenzucken. Ertappt wirbelte ich herum und suchte den Strandabschnitt nach einem Eindringling ab, entdeckte aber niemanden. Mit mulmigem Gefühl wandte ich mich wieder dem Meer zu.
Erneut fiel mein Blick auf den kleinen Stein, den ich in die Hand nahm.
Vielleicht war Schweben der falsche Ausgangspunkt, vielleicht gestaltete sich der Prozess schwieriger, als ich dachte, und ich sollte es mit etwas Einfacherem versuchen.
Nachdenklich drehte und wendete ich das Steinchen in den Händen.
Mir kam der Gedanke, dass ich ihn in einen anderen Gegenstand verwandeln könnte – eventuell in eine Muschel oder eine Perle. Aber wäre das nicht viel komplizierter?
Wütend schnaubte ich und pfefferte den Stein in Richtung Meer, wo er mit einem lauten Platschen aufkam.
Es brachte ja doch nichts. Ich scheiterte schon an den Grundlagen. Hoffentlich stand in Pehlons Aufzeichnungen etwas, das mich weiterbrachte.
Genervt steuerte ich das Schloss an, als ich erneut auf ein Geräusch aufmerksam wurde, nur dass mir sein Ursprung jetzt erst klar wurde.
Mein Blick glitt die Palastfassade hoch, bis zu einem geöffneten Fenster, in dem ich eine weibliche Gestalt ausmachte. Auch in der Dunkelheit offenbarte sich Auroras goldenes Haar, das ihr in sanften Wellen die Schultern hinabfiel.
»Wie lange stehst du schon da?«, rief ich ihr zu, woraufhin sie die Mundwinkel in ein winziges Lächeln legte – zumindest soweit ich das in der Finsternis erkannte.
»Lange genug, um mich zu fragen, was du dort unten tust.«
Ich spürte, wie mir die Röte in die Wangen schoss.
Hatte sie all meine peinlichen Versuche mitbekommen?
»Kannst du auch nicht schlafen?«, wollte sie wissen.
Ich nickte. »Meine Gedanken drehen durch.«
»Mir geht es nicht anders.« Sie strich sich eine goldene Strähne hinters Ohr und beugte sich weiter nach vorn, sodass ihr Nachthemd an der Brust Falten schlug. »Ich wünschte, die Sonne wäre schon aufgegangen und wir könnten uns an die Arbeit machen. Aber dafür wäre ich gern ausgeschlafen – und das bekomme ich momentan einfach nicht hin.« Sie seufzte, dann verlor sie sich in der unendlichen Weite des Meeres. Etwas leiser fügte sie hinzu: »Ich vermisse meine Schwester so sehr, viel mehr als meine Eltern, denn bei ihr weiß ich zumindest, dass sie noch lebt. Obwohl sie wieder dieses Ungeheuer ist, fühle ich mich ihr noch nah.« Sie verschränkte die Hände vor der Brust und ließ ihren Blick kurz auf mir ruhen. »Ich würde ihr so gern helfen – noch bevor wir uns auf die Suche nach dem ewigen Licht machen. Aber ich habe keinen Anhaltspunkt – und bezweifle stark, dass Pehlons Aufzeichnungen mich in dieser Hinsicht weiterbringen werden.«
»Vielleicht fällt uns etwas ein, wenn wir uns morgen zusammensetzen.«
Aurora schaute in den Sternenhimmel, der sich wie ein funkelnder Teppich über uns spannte.
Auch aus der Entfernung machte ich ihre dichten Wimpernkränze aus und die vollen Lippen, die sich in diesem Moment öffneten.
»Wie auch immer. Wir sollten dringend versuchen zu schlafen.«
Ihre Vernunft gewann, als sie die Hand zum Abschied hob und das Fenster vor mir schloss.
Ich schaute ihr noch eine Weile hinterher, bis ich sicher sagen konnte, dass sie gegangen war. Dann begab auch ich mich auf den Weg ins Schloss.
Da ich nichts hatte, um meine nassen Füße zu trocknen, lief ich auf Zehenspitzen die Treppe hoch und wischte den Sand in Auroras Zimmer weg.
Ich ließ mich auf das weiche Bett fallen, das mir nicht mehr ganz so fremd erschien wie vor ein paar Stunden.
Unter größter Anstrengung verbannte ich alle negativen Gedanken aus meinem Kopf – und hatte ihr Bild vor meinen Augen, als ich einschlief.
Kapitel 2 - Aurora
Ich hatte unseren unerschöpflichen Vorrat an Nahrung nie infrage gestellt. Wenn ich hungrig war, ging ich in die Küche, öffnete einen der großen Schränke – in der sicheren Aussicht, dort etwas zu finden, das mich satt machte. Der Inhalt füllte sich wie von Zauberhand immer wieder auf, auch wenn ich das magische Konzept, das dahintersteckte, noch nicht verstanden hatte.
Als ich jetzt in der geräumigen Küche stand und Teller aus den Schränken holte, um sie mit Köstlichkeiten für ein Frühstück für Finlay und mich zu füllen, fragte ich mich, wer für all den Zauber in meinem Leben verantwortlich war. Wer das Volk der Nyha, meine Familie und die Nyonen erschaffen hatte.
Ich wusste, dass auch die Menschen sich mit der Frage nach dem Ursprung beschäftigten, dass sie an einen Gott, eine höhere Macht oder auch an nichts glaubten, aber niemand sicher sagen konnte, wie er entstanden war.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um den Schrank zu erreichen, der etwas höher hing als die anderen.
Über die Jahre hinweg hatte Cyrena herausgefunden, dass er sich stets mit Süßspeisen füllte, während die anderen beiden deftiges Essen herbeizauberten. Dann gab es noch einen vierten, in dem sich Getränke befanden.
Ich öffnete die Tür des Schränkchens und linste neugierig hinein. Auf einem Teller in der Mitte lagen frische Zimtschnecken, die einen herrlichen Duft verströmten, daneben ein hellblauer, länglicher Kuchen, von dem ich schon einmal probiert hatte.
Bereitwillig griff ich nach beiden Tellern und verstaute sie auf dem Tablett vor mir. Da ich mit der Auswahl noch nicht ganz zufrieden war, schloss ich den Schrank und öffnete ihn erneut. Glücklich nahm ich die beiden Schüsseln mit Pudding zur Kenntnis, eine dicke Schicht Zimt auf der Oberfläche.
Aus dem Schrank mit dem deftigen Essen zog ich mehrere Scheiben Brot mit verschiedenen Aufstrichen, drei Eier und dunkle Brötchen. Schnell brauchte ich ein zweites Tablett – mir war bewusst, dass ich maßlos übertrieb. Allerdings kannte ich Finlays Geschmack noch zu wenig, um mich auf eine kleinere Auswahl zu beschränken.
Eine Karaffe mit frischem Wasser und zwei Tassen heiße Schokolade rundeten das Frühstück ab, das ich nach unten in den Eingangsbereich balancierte.
Mit meiner Familie hatte ich unsere Mahlzeiten immer im Speisesaal eingenommen. Schon zu fünft war er mir zu groß vorgekommen, weswegen ich auf einen kleineren Raum auswich, in dem sich nicht mehr als ein Tisch mit vier Stühlen und ein kleines Sofa befanden.
Als ich die leeren Tabletts zurück in die Küche bringen wollte, traf ich auf Finlay, der die Treppe hinunterging. Beinahe schüchtern hob er die Hand, sobald er auf mich aufmerksam wurde.
Ich grinste ihn an, ließ den Blick über seine Aufmachung gleiten – und verglich sie instinktiv mit meiner.
Selbst einem Außenstehenden wäre aufgefallen, dass wir aus verschiedenen Welten stammten, die keinerlei Berührungspunkte besaßen. Während Finlay eine etwas ramponierte Hose trug, die an den Knien Löcher aufwies, und er sich für ein weites ausgeleiertes Oberteil entschieden hatte, schmiegte sich ein enges fliederfarbenes Kleid mit schwarzen Perlen und aufwendigem Kragen an meinen Körper.
Doch die Unterschiede zwischen uns störten mich nicht. Mir war es gleichgültig, was er trug – viel spannender fand ich die Tatsache, dass Finlay sich anscheinend dazu entschieden hatte, sich einen Bart wachsen zu lassen. Zumindest ließen das die Stoppel um sein Kinn vermuten.
Für einen Moment legte ich den Kopf schief, versuchte mir vorzustellen, wie er mit Bart aussehen würde – und mit etwas längerem Haar, denn das hatte mir an Männern immer gut gefallen.
»Hätte ich gewusst, wie lange du mich musterst, hätte ich mir mit meinem Aussehen mehr Mühe gegeben«, meinte Finlay in diesem Moment.
Ich lächelte ihn fahrig an. »Äh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen?«
Er grinste. »Nicht sehr lange und nicht sehr tief. Aber es geht mir gut.«
»Ich … habe Frühstück für uns. Dort hinten in der kleinen Kammer steht es.« Ich machte eine ausschweifende Handbewegung. »Ich bring die Tabletts schnell in die Küche zurück, dann komme ich zu dir.«
»Du hättest nicht extra etwas kochen müssen«, sagte Finlay.
»Das habe ich nicht. Nysolis versorgt uns – das war vor und nach dem Untergang der Fall.«
Ich schob mich an ihm vorbei und ging hoch in die Küche, wo ich die Tabletts auf der Anrichte abstellte.
Als ich zurückkam, wartete Finlay noch immer auf der Treppe, weswegen ich ihn in die Kammer führte, wo er auf einem der Stühle Platz nahm.
Ich setzte mich ihm gegenüber und schmunzelte angesichts seines erstaunten Blicks.
»Ich habe lange nicht mehr so ein gutes Frühstück gesehen.«
»Noch hast du es nicht probiert«, erinnerte ich ihn. »Vielleicht trifft es ja gar nicht deinen Geschmack.«
Übertrieben schüttelte Finlay den Kopf. »Dann würde es nicht so gut riechen«, meinte er und griff nach einem Stück des hellblauen Kuchens, das er auf seinem Teller landen ließ. »Zu Hause frühstücke ich öfter gar nicht – in unserem Kühlschrank ist auch nicht immer etwas Essbares.« Finlay nippte an seiner heißen Schokolade.
Ich entschied mich für den Zimtpudding. Anscheinend aßen wir morgens beide gern süß – das würde ich mir für die kommenden Tage merken.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie Finlay seinen Kuchen aufaß und sich anschließend ein Brot schmierte. Obwohl ich ihn jetzt schon ein paar Tage kannte, hatte meine Faszination für ihn nicht nachgelassen. Ich spülte das seltsame Gefühl mit einem eiskalten Glas Wasser hinunter.
Finlay rutschte auf seinem Stuhl unruhig hin und her, wusste offenbar nicht, was er sagen sollte – und auch ich tat mich schwer, ein Thema zu finden. Auf der einen Seite wollte ich mit ihm über alles und nichts reden, auf der anderen erschien mir nichts passend. Hinzu kam, dass wir seit dem Kuss gar nicht mehr wirklich miteinander gesprochen hatten und dieser eine Moment, so intensiv und schön er auch gewesen war, nun zwischen uns hing.
Fahrig ließ ich den Blick durch den Raum gleiten. Über Finlays Kopf hing ein Bild, das unseren Gezeitenball zeigte, den wir gefeiert hatten, als Cyrena und ich noch klein gewesen waren.
Mein Vater hatte einen talentierten Nyonen als Maler engagiert, der während der Veranstaltung anwesend war und die schönsten Momente in sein Gemälde einfließen ließ. Deswegen zeigte das Bild nicht nur eine Szene, sondern mehrere Augenblicke, die sich über die gesamte Nacht zogen und geschickt auf einer Leinwand zusammengestellt waren.
Sehnsüchtig beobachtete ich die Gäste, die über die Tanzfläche schlitterten, ihre Körper im Takt der Musik bewegten und die ausgefallensten Kleider trugen.
Meine eigenen Erinnerungen an den Ball waren nur noch in Bruchstücken vorhanden, ich war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt gewesen. Cyrena und ich befanden uns in der Ecke des Gemäldes, schauten begeistert auf die Tanzfläche, auch wenn unsere Eltern uns in so jungen Jahren noch nicht erlaubt hatten, uns unter die Gäste zu mischen. Meine Mutter legte seit jeher viel Wert auf Perfektion, und durch unsere linkischen Tanzschritte hätten wir das Gesamtbild nur ruiniert.
In der ursprünglichen Version des Bildes stand Pehlon neben mir und Cyrena, doch mein Vater hatte ihn stümperhaft mit blauer Farbe übermalt, nachdem er in die Menschenwelt übergesiedelt war.
»Wie hat es sich angefühlt, in diesem Schloss groß zu werden?«, fragte Finlay.
»Ich kannte es nicht anders«, erwiderte ich, »und habe es deswegen vielleicht nicht so zu schätzen gewusst, weil es für mich Normalität war. Aber ich kann dir sagen, dass ich eine glückliche Kindheit hatte und es mir an nichts gefehlt hat. Cyrena und Pehlon waren immer um mich, auch wenn ich mir teilweise ein bisschen mehr freie Zeit gewünscht hätte.« Ich nahm mir ein Stück des Kuchens und ließ es auf meinen Teller wandern.
Finlay hatte seine heiße Schokolade bereits ausgetrunken.
Mit nachdenklichem Blick sagte er: »Ich wäre gern mit Geschwistern groß geworden. Das ist etwas, das ich überhaupt nicht kenne. In der ersten Hälfte meines Lebens waren es immer nur mein Vater und ich – und in der zweiten dann Niall und ich.«
Die Erinnerung an seinen Vater förderte ein Stechen in meiner Brust zutage, gegen das ich sofort ankämpfte.
»Dafür war eure Bindung sicherlich viel enger als die, die ich zu meinen Eltern hatte. Versteh mich nicht falsch, ich liebe die beiden, nur waren sie vor allem immer Respektspersonen für mich, was natürlich auch mit ihren Rollen als König und Königin zusammenhängt.«
»Hast du sie mit Majestät angeredet?«, erkundigte sich Finlay, was mir ein Lachen entlockte.
»Nein, so schlimm war es nicht. Doch unser Umgang miteinander war schon ein anderer als der, den ich mit meinen Geschwistern pflegte. Wenn ich Probleme hatte oder jemandem ein Geheimnis anvertrauen wollte, bin ich immer zu Cyrena und Pehlon gegangen, nie aber zu meinen Eltern. Da war eine natürliche Distanz, die ich nicht durchbrechen konnte.« Ich holte tief Luft. »Manchmal frage ich mich, ob sie mich wirklich kennen oder ob sie nur das Bild von mir sehen, das ich ihnen zeige.«
Mir entging nicht, dass ich von meinen Eltern in der Gegenwart sprach, auch wenn sie nicht mehr hier waren. Bloß wenn ich mich mit ihrem Verschwinden – ihrem möglichen Tod – auseinandersetzte, würde ich durchdrehen. Und gerade jetzt sollte ich nicht mehr Schwäche als unbedingt nötig zeigen. Dennoch war ich dankbar, dass Finlay mich nicht korrigierte.
Er sammelte die Krümel auf seinem Teller zusammen, während er philosophierte: »Kann man einen anderen Menschen wirklich kennen, wenn man sich selbst kaum durchdrungen hat? Eigentlich glaube ich zu wissen, wer ich bin, trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen ich vollkommen anders handele, als ich es von mir erwarte.«
»Vielleicht geht es gar nicht darum, sich immer einschätzen zu können. Vielleicht darf man sich von Zeit zu Zeit selbst überraschen.«
Finlay dachte eine Weile über meinen Einwurf nach, dann nickte er. »Nur ist dir schon mal aufgefallen, dass wir uns bei jedem Menschen ein bisschen anders verhalten? Dass wir nie zweimal derselbe Mensch sind? Ich meine … ich erlebe mich auf eine Weise, wenn ich mit Niall rede, auf eine andere, wenn ich bei dir bin. Und wenn ich allein für mich bin, bin ich schon wieder eine andere Person.«
»Eventuell steckt da gar kein Widerspruch drin. Vielleicht … sind wir ja genau das. Tausende Facetten und Gesichter, die in der Summe uns als Mensch … oder was auch immer ergeben.«
Anhand seines Lächelns erkannte ich, dass ihm der Gedanke gefiel. »Dennoch wäre ich nie in der Lage, die Frage ›Wer bist du?‹zufriedenstellend zu beantworten.«
»Wie gut, dass das ohnehin niemand von dir verlangt. Ich finde, dass wir viel zu komplex aufgebaut sind, um unsere Existenz in Worte zu fassen. Wären wir die Figuren aus einem Bilderbuch, könnte ich dir problemlos sagen, wer ich bin und ob ich auf der guten oder bösen Seite stehe. Aber das echte Leben ist nicht so, und jeder, der eindeutig zwischen schwarz und weiß unterscheidet, wird damit nicht weit kommen.«
Finlay nickte. »Ein bisschen Dunkelheit schadet nicht.«
Ich legte den Kopf schief. »Wie meinst du das?«
Er nahm sich eines der Brötchen und schnitt es schief in der Mitte auf. Dann sah er mich kurz an, nur um wieder den Blick auf seinen Teller zu senken. »Wer interessiert sich schon für die Perfekten? Für die, die keine Fehler begehen und immer nur dem Guten nachjagen? Schwächen machen das Ganze doch erst spannend. Ein bisschen Dunkelheit.«
Nicht, wenn die Dunkelheit deinen Vater umgebracht hat.
Ich schluckte gegen den Kloß in meiner Kehle an, bevor ich hektisch das Thema wechselte: »Ich bin sehr gespannt auf das, was Pehlon herausgefunden hat. Wir sollten anfangen.«
Wenn Finlay mein abrupter Themenwechsel auffiel, ließ er es sich zumindest nicht anmerken.
»Wir räumen das Geschirr später weg«, entschied ich.
»Wie gehen wir vor?«, fragte Finlay, woraufhin ich die Schultern zuckte.
»Das kann ich dir sagen, wenn ich mir einen Überblick über seine Aufzeichnungen verschafft habe. Wenn wir Pech haben, ist gar nichts Brauchbares dabei und wir sind nicht schlauer als vorher.«
»Das will ich mal nicht hoffen«, meinte Finlay verdattert.
Ich erhob mich von meinem Stuhl. »Du kennst Pehlon nicht gut genug. Er hat schon öfter große Reden geschwungen, die uns im Endeffekt nichts genutzt haben.«
»Er hatte zweihundert Jahre lang Zeit. Da muss irgendwas bei rumgekommen sein.« Er zog die Augenbrauen hoch.
In Wahrheit wünschte ich mir natürlich auch, dass Pehlons Aufzeichnungen uns helfen würden, dennoch wollte ich mir nicht zu viele Hoffnungen machen.
Ich verließ den kleinen Saal nach Finlay und scheuchte ihn die Treppe hoch. In einem der Zimmer, die wir damals für gesellschaftliches Beisammensein genutzt hatten, hatte ich Pehlons Notizen bereits auf dem Tisch ausgebreitet.
Finlay nahm auf dem grünen Sessel Platz, auf dem sonst immer meine Mutter saß, und griff nach dem Stapel Pergamentpapier.
Ich ließ mich auf das Sofa sinken, welches mit einem hässlichen Muschel-Bezug überzogen war, den ich seit meiner Kindheit abgrundtief gehasst hatte. Undamenhaft verschränkte ich die Beine übereinander, während ich an meinem Kleid zog, das durch die ungünstige Position hochgerutscht war.
Glücklicherweise schaute Finlay nicht auf mich, sondern auf die Blätter in seinen Händen. Für menschliche Augen waren sie komplett unbeschrieben – und auch ich hatte ihnen auf den ersten Blick nichts entnehmen können, doch je länger ich sie in der Hand gehalten hatte, desto deutlicher war mir bewusst geworden, dass sie sehr wohl über Informationen verfügten, die durch Magie dem gewöhnlichen Auge verborgen blieben.
Finlay blätterte durch die Seiten, bevor er sie schnaubend auf den Tisch knallte. »Also, wenn auch nur das kleinste Fünkchen von Magie in mir ist, habe ich keine Ahnung, wie ich sie einsetzen soll.«
»Das ist nicht verwunderlich, wenn du nie gelernt hast, sie zu kontrollieren. Ich bin mit meiner groß geworden und habe sie von klein auf gelernt. Jemand, der den Großteil seines Lebens als Mensch verbracht hat, dem wird es schwerfallen, seine Kräfte zu verstehen.«
»Wie soll ich auf sie zugreifen?«, hakte Finlay nach. »Ich habe keinen Anhaltspunkt und kann nicht mal eine verdammte Muschel zum Schweben bringen.«
Ich zog verwirrt die Augenbrauen zusammen. »Wieso solltest du eine Muschel schweben lassen wollen?«
Zerknirscht sah er mich an. »Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Gestern Nacht am Strand.«
»Oh.« Ich zählte eins und eins zusammen. »Das war es also, was du dort getrieben hast.«
Unter Anstrengung verkniff ich mir ein Lächeln, als ich mich an seine bemühten Bewegungen erinnerte. »Ich glaube, du hast das Konzept unserer Magie noch nicht verstanden.«
»Wie sollte ich auch?« Von einer auf die andere Sekunde wirkte er genervt. »Mir sagt ja niemand was.«
»Weil wir noch nie darüber gesprochen haben – und überhaupt ist Magie etwas, das sich sehr langsam entwickelt. Vor allem, wenn man seine Kräfte erweitern will, erlebt man öfter Rückschläge, als dass man vorankommt. All das gehört dazu und ist vollkommen normal.«
Finlay beugte sich über den Tisch zu mir. »Darum geht es mir ja gar nicht«, verdeutlichte er. »Ich will meine Kräfte nicht ausbauen, ich will überhaupt erst mal lernen, auf sie zuzugreifen. Wenn wir noch mal die Muschel als Beispiel nehmen.«
»Fin, ich kann auch keine Muscheln schweben lassen«, unterbrach ich ihn, woraufhin er mich verwirrt musterte.
»Ist das denn so kompliziert?«, wollte er wissen, und ich schluckte das Seufzen hinunter.
Ich musste Geduld mit ihm haben, er fing bei null an und verfügte über keine nennenswerten Vorkenntnisse.
»Es geht weniger darum, ob so etwas kompliziert ist, eher darum, dass es nicht unserer Art von Magie entspricht. Gut möglich, dass es irgendwo auf der Welt ein Volk gibt, das Muscheln schweben lässt, aber unser Zauber funktioniert anders. Wir benutzen selten Sprüche oder Stäbe und mit den Hexen und Feen aus den alten Märchen darfst du uns auch nicht vergleichen. Unsere Macht ist oft an magische Gegenstände geknüpft, die wir zu Hilfe nehmen. Wir sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, zu heilen, unsere Sinne sind ausgeprägter und das Atmen unter Wasser gehört sicherlich auch dazu.«
»Das heißt …« Finlay räusperte sich. »Dass ich mich zum Beispiel nicht einfach dazu entscheiden kann, einen Gegenstand herbeizuzaubern … oder zu fliegen oder …«
Ich schüttelte den Kopf. »Das, was du da beschreibst, lässt mich an Allmacht denken und davon sind wir weit entfernt. Was auch gut so ist, die alleinige Vorstellung bereitet mir Angst.« Nachdenklich blickte ich auf Pehlons Aufzeichnungen hinab. »Nein, so funktioniert das Ganze nicht. Es ist möglich, unsere Fähigkeiten zu erweitern, aber niemals werden wir so mächtig, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Es gibt immer Grenzen – auch wenn die bei jedem woanders liegen. Wo sich deine befinden, weiß ich nicht, denn du bist … ein Mischlingswesen und das bedeutet entweder etwas Gutes oder Schlechtes.«
Finlay verzog den Mund. »Was meinst du damit?«
»Wenn man den Worten meines Bruders Glauben schenkt – und das tue ich in diesem Fall – bist du das erste Mischlingswesen. Wahrscheinlich waren deine Vorfahren allesamt gewöhnliche Menschen und nur auf dich ist die Magie übergegangen. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Als Wesen zwischen den Welten erfüllst du eine besondere Rolle, weswegen ich mir vorstellen kann, dass deine Kräfte entweder sehr stark oder sehr schwach sind.«
Finlay nickte nachdenklich. »Pehlons Aufzeichnungen«, fiel ihm da ein, »er meinte, dass du die Wörter sichtbar machen kannst. Bin ich dazu auch in der Lage? Was muss ich dafür tun? Ist es schwierig?«
Ich betrachtete die Zettel genauer. Es gab verschiedene Möglichkeiten, Informationen auf Papier zu verstecken, und noch wusste ich nicht, welche Pehlon genutzt hatte.
Vorsichtig strich ich über die raue Oberfläche und spürte, wie es in meinen Fingerspitzen zu kribbeln begann. Ich schloss die Augen, hob das Papier vor mein Gesicht und konzentrierte mich auf die Macht, die darin verborgen lag. Mein Herz schlug schneller, während sich wie in einem Rausch Buchstaben vor meinen geschlossenen Lidern bildeten.
Doch da war noch so viel mehr.
Überrascht öffnete ich die Lider und suchte Finlays Blick. Ohne auf seine Fragen von eben einzugehen, sagte ich: »Es sieht ganz so aus, als hätten wir Glück. Pehlon hat uns deutlich mehr mit auf den Weg gegeben als nur ein paar Blatt Papier.«
Finlay zog die Augenbrauen zusammen. »In der Tasche war sonst nichts. Da bin ich mir sicher.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das meine ich nicht. Es ist alles hier drin … nur ist da nicht bloß Papier. Pehlon hat Gegenstände im Pergament versteckt. Wir müssen sie befreien.«
»Klingt nach einem Kinderspiel«, kommentierte Finlay sarkastisch, nahm mir das Papier dennoch aus der Hand. Angestrengt schaute er sich die einzelnen Seiten an, bevor er wieder meinen Blick suchte. »Und wie mach ich das?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Wenn ich Magie in mir trage, muss ich doch irgendetwas tun können. Wie wirst du vorgehen?«
»Das ist alles nicht so leicht.« Ich zog die Ärmel meines Kleides weiter hinunter und verschränkte die Arme vor der Brust. »Meistens schließe ich die Augen, um mich besser zu konzentrieren. Dann greife ich auf die Magie in meinem Inneren zu und übertrage sie auf das Blatt. Ich …« Da ich seinen verzweifelten Gesichtsausdruck nicht noch intensivieren wollte, hörte ich auf. Ich wusste ja selbst, dass ich ihm nicht weiterzuhelfen vermochte.
Trotzdem schloss er die Augen. Finlays Stirn legte sich in Falten, aber ich ahnte bereits, dass er damit nichts erreichen würde.
Vielleicht war die Art von Magie, die in ihm verborgen war, gar nicht dazu in der Lage, solche Dinge zu vollbringen.
Als sich nach einer geschlagenen Minute noch immer nichts getan hatte, seufzte er und gab mir die Blätter zurück. »Zeig es mir«, forderte er mich auf.
»Ich werde zunächst die Schrift sichtbar machen und mich danach um die zweite Ebene kümmern.«
Sauber breitete ich die Blätter nebeneinander auf dem Tisch aus, bis das Holz komplett bedeckt war. Dann schloss ich kurz die Augen, konzentrierte mich auf das warme Gefühl in meinem Inneren und hob die Hände über das Papier.
Finlay klappte die Kinnlade hinunter, als sich unzählige schwarze Buchstaben aus meinen Fingern lösten und langsam auf die Blätter segelten, wo sie Wörter und Sätze ergaben. Einige Illustrationen waren auch dabei – im dritten Durchgang ergaben sich eine Landkarte und ein Gedicht in einer fremden Sprache.
»Wie soll ich so etwas jemals schaffen?«, fragte Finlay mich, sobald alle Seiten beschriftet waren.
»Vielleicht musst du das gar nicht. Vielleicht wird deine Aufgabe eine andere sein – und ich kümmere mich um den Kleinkram.«
Ich grinste, er erwiderte mein Lächeln allerdings nicht. Stattdessen sah er frustriert aus.
»Du hast eben von einer zweiten Ebene gesprochen«, erinnerte er mich. »Wie soll ich mir das vorstellen?«
»Altes Papier eignet sich hervorragend dazu, um Geheimnisse in ihm zu verstecken. Dabei muss es sich nicht nur um das geschriebene Wort handeln, man kann, wenn die Kräfte es zulassen, auch größere Dinge in ihm verbergen und später wieder sichtbar machen.«
»Pehlon steckt da aber nicht selbst drin, oder?«
Verwirrt zog ich die Augenbrauen zusammen. »Das wäre in mehr als einer Hinsicht verstörend, außerdem glaube ich nicht, dass so etwas möglich ist.«
»Was weiß ich schon?« Finlay hob die Hände. »Das alles … ist so neu für mich. Ich habe …«
»Ganz ruhig.« Ich sah ihm fest in die Augen. »Ich zeige dir jetzt, wie ich es mache – vielleicht nimmst du daraus etwas für dich mit, und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Magie ist, wie ich schon gesagt habe, eine komplexe Angelegenheit und eventuell sind deine Fähigkeiten anders als meine.«
Finlay schlang die Hände um sein Knie und nickte.
Ich stand vom Sofa auf und ging zu dem kleinen Schränkchen, das sich an der linken Seite des Raums befand und mit etwas Glück genau das beherbergte, was ich brauchte.
Cyrena hatte sich immer darum gekümmert, dass es mit dem Nötigsten gefüllt war, und als ich die Schublade aufzog und ein kleines Fläschchen mit glitzerndem Sand entdeckte, dankte ich ihr im Stillen.
»Was ist das?« Finlay reckte den Kopf, ehe ich mich auf dem Sofa niederließ.
Ich löste den Pfropfen der Flasche und streute hellblauen Sand über das ausgebreitete Papier. Dabei musste ich nicht jede Seite einzeln treffen, weil sie miteinander zusammenhingen.
Neugierig beugte sich Finlay über den Tisch, hatte den Mund schon zu einer Frage geöffnet, doch ich legte den Zeigefinger vor meine Lippen.
Er sollte einfach zusehen.
Der schimmernde Sand blieb eine Weile auf dem Papier liegen, bevor er sich zu bewegen begann, in die Höhe stieg und die Formen von drei Gegenständen annahm, die ich noch nicht erkannte.
»Greif danach«, forderte ich Finlay auf, der mich verwirrt ansah, die Hand jedoch nach einem der Sandgebilde ausstreckte.
Er zuckte zusammen, als es sich unter seinen Fingern in einen echten Gegenstand verwandelte – in einen Kompass.
»Wow«, machte er. »War ich das? Habe ich gerade gezaubert?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, das ist der Wirkstoff des schimmernden Sandes, dafür musst du keine Magie beherrschen.«
Ich schaute auf den Kompass in seinen Händen, der auf den ersten Blick nicht weiter ungewöhnlich schien. Es war seine Veredelung, die ihn teuer wirken ließ.
Finlay betrachtete ihn nur kurz, interessierte sich mehr für die anderen Gegenstände. Er wartete meine Zustimmung nicht ab, sondern griff nach dem zweiten Sandgebilde, das sich nach seiner Berührung in eine perlmuttfarbene Muschel verwandelte.
»Eine Muschel?« Er runzelte die Stirn.
»Sicherlich nicht nur eine Muschel«, erwiderte ich und nahm sie ihm aus der Hand. Sie bestand aus zwei gleich großen Hälften, die ich mühsam auseinanderklappte.
Ein Sirren erklang in meinen Ohren – dann blickte ich direkt in Pehlons stahlblaue Augen.
»Was zur Hölle«, murmelte ich.
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Finlay vom Sessel aufstand und zu mir kam.
»Ist das Pehlon?«, erkundigte er sich überflüssigerweise.
»Aurora und Finlay«, begrüßte uns mein Bruder, dessen Antlitz uns aus der oberen Muschelhälfte entgegenstrahlte. »Ich habe mich schon gefragt, wie lange ihr braucht, um die Muschelpost zu finden.«
»Muschelpost?« Ich legte den Kopf schief.
»Die Muschelpost ist eine Möglichkeit, um jederzeit mit mir in Kontakt zu treten. Wenn ihr Fragen habt oder meine Hilfe braucht, klappt ihr die Muschel auf und ich stehe euch zur Verfügung.«
»Das ist … ziemlich cool«, kommentierte Finlay neben mir, aber ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.
»Wie weit seid ihr gekommen?«, fragte Pehlon.
Ich legte die Muschel auf dem Tisch ab.
»Wir sind dabei, deine Aufzeichnungen zu entschlüsseln«, brachte Finlay ihn auf den Stand der Dinge. »Es ist … wahnsinnig spannend, was du alles gefunden hast, ich …«
Kurzerhand klappte ich die Muschel zu. Ich hatte keine Lust, jetzt mit Pehlon zu sprechen. Weiterhin ertrug ich sein Gesicht nur schwer, weil schon der kleinste Blick in seine Augen jene Vergangenheit wieder lebendig machte, die ich zu vergessen versuchte. Und ich hatte ihm immer noch nicht verziehen. Ich wollte es unbedingt allein schaffen, auch wenn das bedeutete, dass wir länger brauchten.
»Wir werden ihn um Hilfe bitten, wenn wir nicht mehr weiterkommen«, stellte ich klar. »Jetzt schauen wir uns erst mal die Notizen weiter an. Außerdem gibt es noch einen dritten Gegenstand.«
Finlay nickte, wirkte aber weiterhin verwirrt. Er nahm mir gegenüber auf dem Sessel Platz und tippte das letzte Sandgebilde an, das sich in eine Flasche verwandelte, in der sich eine durchsichtige Flüssigkeit befand.
»Was ist das?«, murmelte er.
»Ich hoffe, dass das in Pehlons Notizen steht.«
»Wollen wir ihn fragen?« Er schielte in Richtung der Muschel, doch ich schüttelte entschieden den Kopf. Mein Leben lang hatte ich mir von Pehlon aus der Patsche helfen lassen, jetzt war es an der Zeit, dass ich selbst etwas vollbrachte.
»Lass uns erst alles sichten, vielleicht ergibt es sich dann von selbst.« Ich stellte die Flasche neben Kompass und Muschel.
Finlay rieb die Hände aneinander. »Fangen wir also an.«
»Ich will ganz sichergehen, dass wir nichts vergessen haben. Manchmal wird beim ersten Durchgang nicht alles sichtbar.«
Noch einmal streute ich den funkelnden Sand über das Papier – und nachdem eine Weile nichts geschehen war, bildete sich ein letzter Gegenstand, den Finlay sichtbar machte.
Ein hölzernes Kästchen kam zum Vorschein, in dem sich sternförmige Kekse befanden.
»Kennst du die?«, erkundigte sich Finlay, was ich verneinte.
Danach stapelte ich das Papier aufeinander, schloss die Augen und klopfte mit der Hand dreimal darauf, in der Hoffnung, dass sich die Blätter ordnen würden.
Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, dass ein Brief an oberster Stelle lag, der an uns beide adressiert war.
»Darf ich?« Finlay nahm das Papier an sich. Mit stockender Stimme trug er vor:
»Liebe Rona, lieber Finlay,
ich freue mich, wenn es endlich so weit ist und ihr diesen Brief lest. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, bis er in eure Hände gelangt, aber ich kann den Tag, an dem mein Wissen endlich auf euch übergeht, kaum erwarten.
Ihr habt euch dazu entschieden, den dunkelsten Teil des Meeres aufzusuchen, um dort das ewige Licht zu finden. Ganz so, wie ich es in meinen Visionen gesehen habe. Mit deiner Hilfe, Finlay, werden die Nyonen wiedergeboren und wir dürfen unser altes Leben wieder aufnehmen.
Ich glaube an euch – vor allem an dir, Aurora, habe ich nie gezweifelt. Vielleicht habe ich dir nicht oft genug gesagt, wie viel ich von dir halte – wie stark du bist. Du kannst alles schaffen.
Diese Aufzeichnungen beinhalten das Wissen, das ich in den letzten zweihundert Jahren zusammengetragen habe. Es wird euch auf eure Reise vorbereiten. Die Nyonen selbst haben nie etwas über das ewige Licht festgehalten, weswegen es nicht einfach war, verlässliche Informationen zu bekommen.
Neben meinen schriftlichen Notizen lege ich euch einen Kompass bei, der euch auch im tiefsten Gewässer den Weg in den dunkelsten Teil weisen wird. Außerdem eine Muschelpost, über die ihr jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen könnt. Ihr seid allein unterwegs, aber das bedeutet nicht, dass ich euch nicht helfen möchte. Klappt die Muschel auf und ich werde so schnell wie möglich für euch zur Verfügung stehen.
In der Flasche befindet sich ein Serum, das eure Wunden heilt, wenn euch unter Wasser etwas passiert. Es hilft allerdings nicht gegen die schweren Verletzungen.
In dem Kästchen liegen Kekse, die einen Menschen unter Wasser atmen lassen. Finlay, du wirst dich mit meiner Schwester in den Ozean begeben müssen. Die Kekse werden dir helfen, wenn du noch nicht selbst atmen kannst, doch ihre Wirkung ist begrenzt. Ihr solltet sparsam mit ihnen umgehen, sie waren in der Herstellung sehr aufwendig und ich werde euch keine weiteren schicken können.
Meine Aufzeichnungen sprechen für sich, weswegen ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen werde. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wie ihr mich erreicht.
Zum Schluss bleibt mir nur, euch viel Glück zu wünschen. Ich weiß, dass ich fast Unmögliches von euch verlange, aber mein Vertrauen in euch ist grenzenlos – vor allem in dich, Aurora.
Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.
Pehlon.«
Kapitel 3 - Finlay
Ich legte den Brief beiseite und sah Aurora aufmerksam an. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, Tränen in ihren Augen schimmern zu sehen, aber sie blinzelte sie eilig weg und wandte sich stattdessen den Aufzeichnungen zu, die vor ihr lagen. Sie nahm sich die oberste Seite und reichte mir die zweite.
»So kommen wir schneller voran«, meinte sie. »Ich schlage vor, dass wir jeder die Hälfte der Seiten lesen und uns danach austauschen.«
Ihre Stimme zitterte kaum merklich, doch ich beschloss, sie nicht darauf anzusprechen. Ich wusste, wie sehr ihr Bruder sie aufwühlte und wie kompliziert ihre Gefühle für ihn waren.
Deswegen nickte ich und blickte auf das Papier in meinen Händen, das eine Landkarte zeigte.
Mit roter Farbe hatte Pehlon unseren Weg aufgezeichnet. Das Schloss befand sich auf der linken unteren Seite. Mit den Fixpunkten, die Pehlon markiert hatte, konnte ich nichts anfangen.
Ein freudloses Lachen löste sich von meinen Lippen.
Ich war nicht im Geringsten auf diese Reise vorbereitet. Noch immer fühlte ich mich wie ein gewöhnlicher Mensch – und würde meinen Tod in den Fluten finden, wenn ich nicht schleunigst meine Magie beherrschen lernte.
Ich legte die Landkarte beiseite und griff nach der nächsten Seite, die doppelt beschrieben war und in allen Details Pehlons Träume und Visionen beschrieb.
Hier erfuhr ich nichts Neues, überflog, dass er einen Jungen am Strand gesehen hatte, der das ewige Licht in den Händen hielt und dadurch Nysolis zurückbrachte. Neben dem Volk der Nyha kamen auch die Nyonen wieder, die den Ozean bevölkerten und ihm zu früherer Schönheit verhalfen.
Seufzend griff ich nach der dritten Seite; Aurora hatte denselben Plan. Unsere Finger berührten sich über den Tisch hinweg, nur für einen Wimpernschlag – und doch sah ich, dass sich Auroras Wangen in einem zarten Rosaton färbten.
»Du zuerst«, sagte sie mit rauer Stimme, woraufhin ich das Papier an mich nahm.
Scheu drehte sie sich auf dem Sofa von mir weg und senkte den Blick auf die Seite.
Ich beobachtete die Prinzessin noch eine Weile, sah sie im Profil und hoffte, dass sie es nicht mitbekam.
Erst dann widmete ich mich wieder dem Papier in meiner Hand, das sich mit Legenden und Geschichten rund um den dunklen Teil des Meeres beschäftigte.
In einem Vorwort erklärte Pehlon, dass er selbst nie dort gewesen sei, aber die Nyonen ihm viel darüber erzählt hätten. Er wisse nicht, welche Geschichten der Wahrheit entsprachen, doch er habe es für nötig gehalten, sie alle für uns niederzuschreiben, damit wir vorbereitet waren. Mir war es ein Rätsel, wie er sich an so viel erinnern konnte, immerhin hatte er die Nyonen vor über zweihundert Jahren befragt.
Die einzelnen Legenden bestanden teilweise nur aus wenigen Zeilen und bei den meisten genügten mir die Überschriften, um mich in einen Zustand der Furcht zu versetzen und die Härchen auf meinen Armen aufzurichten.
»Im dunkelsten Teil des Meeres befindet sich eine giftige Schlange, die jeden, der ihr in die Augen blickt, verzaubert und bei lebendigem Leib verspeist«, murmelte ich mit ängstlicher Stimme und schüttelte den Kopf. »Nichts, was du dort unten findest, ist so, wie es scheint. Nirgendwo ist die Täuschung deutlicher als im dunkelsten Teil des Meeres. Verlass dich auf deinen Instinkt, nie aber auf das, was du siehst oder spürst.« Ich seufzte. »Das sind ja tolle Voraussetzungen«, zischte ich und sah, wie Aurora den Kopf hob.
Sie musterte mich eine Weile, bis sich ihre Lippen in ein vorsichtiges Lächeln legten. »Belastet dich das Ganze auch so?«, fragte sie mich. »Ständig wird mir bewusst, wie unmöglich unser Plan ist, und mir fallen hundert gute Gründe ein, hierzubleiben. Das ist sehr frustrierend.« Sie blies sich eine Strähne ihres goldenen Haares aus dem Gesicht und legte das Papier, das sie in der Hand gehalten hatte, zurück auf den Tisch. »Lust auf eine Pause?«
»An was hast du gedacht?«
Nun wurde ihr Grinsen breiter. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du Bekanntschaft mit dem Meer machst. Auch wenn du noch nicht von dir aus unter Wasser atmen kannst, würde ich vorschlagen, dass wir einen von Pehlons Keksen einsetzen und gemeinsam schwimmen gehen.«
Ich blickte an ihr vorbei aus dem Fenster. Das Meer sah ruhig und friedlich aus, daher nickte ich. »Aber erwarte keine Höchstleistungen von mir.« Ich klopfte mir den Staub von der Hose und stand auf.
»Das ist kein Wettbewerb, Fin. Wir gehen einfach etwas schwimmen.« Sie lächelte. »Wir treffen uns in zehn Minuten unten.« Damit rauschte sie an mir vorbei.
Fieberhaft durchwühlte ich in ihrem Zimmer meine Reisetasche.
Ich wusste, dass ich im Eifer des Gefechts eine Badehose mitgenommen hatte, nur als ich sie jetzt in der Hand hielt, kam sie mir albern und mindestens eine Nummer zu klein vor. Ich war schon seit einiger Zeit nicht mehr schwimmen gewesen – zumindest nicht freiwillig.
Hoffentlich passte mir die Badehose noch, auch wenn ich ihre hellblaue Farbe und die wilden Paisley-Muster mittlerweile peinlich fand.
Dennoch schlüpfte ich aus meiner Kleidung und zog die Hose über, die am Bund etwas eng geworden war, sonst aber passte.
Widerwillig stellte ich mich vor Auroras Spiegel und musterte meinen Körper. Meiner blassen Haut war es zu verdanken, dass ich nie richtig braun wurde, mir dafür allerdings umso schneller einen Sonnenbrand einfing. In den letzten Jahren hatte ich vor allem am Bauch ein bisschen zugelegt, alles in allem sah ich jedoch passabel aus.
Das dachte ich zumindest so lange, bis ich Aurora entdeckte, die in der Eingangshalle auf mich wartete und um deren Körper sich ein fliederfarbenes Schwimmkleid schmiegte, das all die Stellen, die ich besonders anziehend an ihr fand, betonte und sie einfach zauberhaft aussehen ließ.
Hatte ich in einem Leben ohne sie schon mit Komplexen zu kämpfen, wurden sie in diesem Moment übermächtig. Gegen sie wirkte ich wie ein Häufchen Elend und wieder wurde mir bewusst, wie unterschiedlich die Welten waren, aus denen wir kamen – wie unterschiedlich wir beide waren.
Doch Aurora sah über meinen Aufzug hinweg – vielleicht fiel er ihr nicht einmal auf.
Stattdessen griff sie nach meiner Hand und zog mich nach draußen. Ihr goldenes Haar trug sie in einem geflochtenen Zopf, der ihr sanft den Rücken hinabfiel und während des Laufens hin- und herschwang.
Helle Sonnenstrahlen begrüßten uns, als wir die Treppen nach unten nahmen. Der Himmel war stechend blau, keine einzige Wolke bedeckte das Firmament.
Während Aurora auf das Meer zuging, war mein Blick auf die Küste gerichtet, hinter der Chatair lag.
Ich konnte nichts gegen das ungute Gefühl ausrichten, das mich schlagartig befiel.
Mit großer Sicherheit hatte Niall mein Fehlen bereits bemerkt und den Abschiedsbrief gefunden. Hatte er die Polizei informiert, die sich schon auf der Suche nach mir befand? Oder vertraute er mir und ließ mir die Zeit, um die ich ihn gebeten hatte?
»Es wird kein Abschied für immer sein«, kam es von Aurora, fast als hätte sie meine Gedanken gelesen. Sie warf mir einen aufmunternden Blick über die Schulter zu und winkte mich zu sich heran.
»Und doch habe ich ein schlechtes Gewissen«, entgegnete ich. »Wir haben keine andere Möglichkeit.« Meine Hand ballte sich zur Faust, während das Wasser um meine Füße spielte.
Aurora griff in die Tasche ihres Schwimmkleides und zog einen von Pehlons Keksen heraus. »Ich bin gespannt, wie lange ihre Wirkung anhält.«
Ich nahm ihr den Keks aus der Hand und roch an dem sternförmigen Gebäck.
Aurora nickte mir aufmunternd zu, während ich ein Stück abbiss und nachdenklich darauf herumkaute. Zu sagen, dass mir die staubige Masse schmeckte, die mich prompt zum Husten brachte, wäre eine Lüge.
Ich aß den Rest vom Keks und sah Aurora fragend an.
»Spürst du eine Veränderung?«, wollte sie wissen, doch ich zuckte nur mit den Schultern.
»Dann kommt jetzt wohl die Probe aufs Exempel.«
Sie stupste mich sanft in den Rücken, rannte an mir vorbei und auf das Wasser zu. Sekunden später hatte sie die Oberfläche so weit durchbrochen, dass nur noch ihr Kopf zu sehen war.
Da die Sonne noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte, bekam ich eine Gänsehaut, sobald das Wasser auf meinen nackten Bauch traf. Dennoch lief ich weiter, bis ich bei Aurora angelangt war.
»Wohin schwimmen wir?«, fragte ich sie.
Ich war schon einmal mit ihr im Meer gewesen, allerdings nicht in der Realität. Durch ihre Erinnerung, die in einer Kugel gespeichert war, waren wir in die Vergangenheit gereist.
»Ich möchte dir einige meiner Lieblingsplätze unter Wasser zeigen«, sagte Aurora. »Zuerst müssen wir ausprobieren, ob die Kekse funktionieren. Komm mit.« Sie beugte den Kopf nach links, danach tauchte sie unter.
Aus Reflex holte ich Luft, bevor ich ihr folgte.
In den ersten Sekunden war meine Sicht verschwommen, was an meinen schlechten menschlichen Augen lag, aber bald besserte sich mein Sehvermögen, und ich erkannte Aurora, die sich direkt vor mir aufhielt.
Ihr Mund öffnete sich, doch ich verstand sie nicht. Gleichzeitig merkte ich, wie meine Luft immer knapper wurde.
Auffordernd sah sie mich an, weswegen ich den Mund ebenfalls öffnete und tief einatmete. Ich spürte, wie Wasser in meine Lunge drang, und das Bedürfnis, zurück an die Oberfläche zu schwimmen, wurde übermächtig. Dann aber merkte ich, dass dieses Gefühl nur meiner Panik geschuldet war, denn wie auf magische Weise schien sich das Wasser in meinem Mund in Sauerstoff zu verwandeln.
Langsam nahm meine Lunge ihre ursprüngliche Arbeit wieder auf und ließ mich sanft atmen.
»Wahnsinn«, flüsterte ich und sah die Blasen, die vor meinem Mund entstanden.
»Also hat es geklappt«, kam es von Aurora.
Überrascht hob ich den Kopf, fragte mich, wieso ich sie problemlos verstand.
»Wie fühlt es sich an?«, erkundigte sie sich.
»Ungewohnt. Ein Teil von mir ist begeistert, der andere will nach oben paddeln und Luft holen.«
Aurora nickte. »Komm mit«, sagte sie, drehte sich nach links und schwamm weiter nach unten.
Sie bewegte sich sicher und grazil durch das Wasser und obwohl sie nicht sonderlich schnell unterwegs war, hatte ich Mühe, mich ihrem Tempo anzupassen. Was vielleicht auch daran lag, dass ich nur schwer den Blick von der Umgebung lassen konnte.
In meiner Kindheit war ich öfter im Meer tauchen, aber Aurora schwamm rasch tiefer und erreichte Stellen, zu denen ich nie vorgedrungen war.
Ich war hin- und hergerissen zwischen dem Unbehagen, dass ich eigentlich nicht in der Lage sein sollte, unter Wasser zu atmen, und der Faszination für das, was ich sah.
Je tiefer wir tauchten, desto größer wurde die Fischpopulation. Eine Makrele schwamm an uns vorbei, weiter hinten drehten drei Heringe ihre Kreise.
Ich musste mich darauf konzentrieren, Aurora nicht aus meinem Sichtfeld zu verlieren. Immer wieder warf sie mir einen Blick über die Schulter zu, um sich zu vergewissern, dass ich noch da war.
Wir kämpften uns bis zum sandigen Grund vor. Aurora verharrte an Ort und Stelle und deutete nach links, wo sich ein farbenfrohes Korallenriff vor uns erstreckte.
Obwohl ich nur Pehlons Keks zu mir genommen hatte, kam es mir so vor, als hätte sich mein Sehvermögen deutlich verbessert. Ich war diffuse Schemen gewohnt, verwackelte Bilder und verschwommene Konturen, doch alles, was sich vor mir auftat, war gestochen scharf. Beinahe so, als würde ich mir einen Film über die Unterwasserwelt anschauen und nicht wirklich Teil von ihr sein.
Aurora wartete im Korallenriff auf mich, das in Blau- und Lilatönen strahlte.
Mich machte das Lächeln auf ihrem Gesicht glücklich. Vor ihren Füßen streckte sich eine rosafarbene Blumenart aus, die ich nicht kannte und perfekt mit ihrem goldenen Haar harmonierte.
»Ist das nicht wunderschön?«, fragte sie und meinte das bunte Korallenriff.
»Das ist es«, antwortete ich und meinte sie.