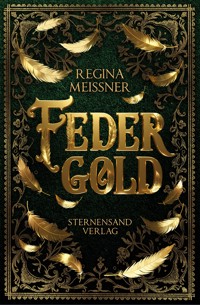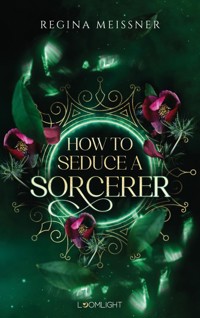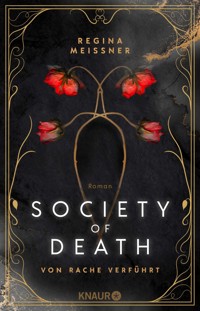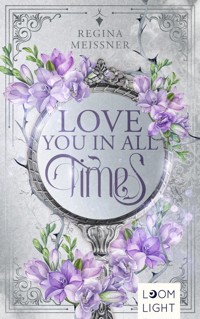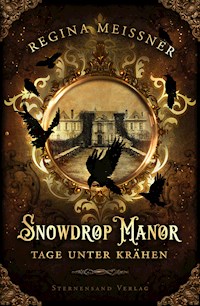
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lausche dem Krächzen der Krähen, aber sieh ihnen nicht in die Augen. Denn was du dort erblickst, könnte dich in die Dunkelheit ziehen. Ein schwerer Schicksalsschlag zerstört von einem Tag auf den anderen das Leben der zwanzigjährigen Lauren. Sie ist plötzlich auf sich allein gestellt – in einer Gesellschaft, in der Frauen es schwer haben, auf eigenen Beinen zu stehen. Als ein Fremder auftaucht und sich als ihr Onkel ausgibt, ist sie zunächst misstrauisch. Aber Wesley Cunningham ist alles, was sie noch hat, also folgt sie ihm auf das Anwesen Snowdrop Manor. Doch in dem alten Herrenhaus ist nichts so, wie es scheint, und Lauren sieht sich bald Geheimnissen und Intrigen gegenüber, die ihr erneut den Boden unter den Füßen wegzureißen drohen. Und dann wäre da noch der charismatische Lord Beaufort, der mehr über Magie weiß, als sie sich jemals vorgestellt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
Dank
Regina Meissner
Snowdrop Manor
Tage unter Krähen
Dark Fantasy
Snowdrop Manor: Tage unter Krähen
Lausche dem Krächzen der Krähen, aber sieh ihnen nicht in die Augen. Denn was du dort erblickst, könnte dich in die Dunkelheit ziehen.
Ein schwerer Schicksalsschlag zerstört von einem Tag auf den anderen das Leben der zwanzigjährigen Lauren. Sie ist plötzlich auf sich allein gestellt – in einer Gesellschaft, in der Frauen es schwer haben, auf eigenen Beinen zu stehen. Als ein Fremder auftaucht und sich als ihr Onkel ausgibt, ist sie zunächst misstrauisch. Aber Wesley Cunningham ist alles, was sie noch hat, also folgt sie ihm auf das Anwesen Snowdrop Manor. Doch in dem alten Herrenhaus ist nichts so, wie es scheint, und Lauren sieht sich bald Geheimnissen und Intrigen gegenüber, die ihr erneut den Boden unter den Füßen wegzureißen drohen. Und dann wäre da noch der charismatische Lord Beaufort, der mehr über Magie weiß, als sie sich jemals vorgestellt hat.
Die Autorin
Regina Meißner wurde am 30.03.1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren, in der sie noch heute lebt. Als Autorin für Fantasy und Contemporary hat sie bereits viele Romane veröffentlicht. Weitere Projekte befinden sich in Arbeit.
Regina Meißner hat Englisch und Deutsch auf Lehramt in Gießen studiert. In ihrer Freizeit liebt sie neben dem Schreiben das Lesen und ihren Dackel Frodo.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, März 2020
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2020
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König
Korrektorat Druckfahne: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-117-8
ISBN (epub): 978-3-03896-118-5
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für das dreizehnjährige Mädchen, das zu träumen wagte.
Danke, dass du nicht aufgegeben hast.
EINS
»Du wirst nicht glauben, was mir heute passiert ist!«, ereiferte sich meine Schwester Amelia und sah mich mit ihren durchdringenden blauen Augen an, in denen ein Funkeln verborgen lag.
Ich beobachtete, wie sich ihre rechte Hand um die Tischplatte schloss und sie nur darauf wartete, dass ich Nachfragen stellte und mich nach ihrem Nachmittag erkundigte.
»Setz dich gerade hin, Amelia«, schallte die Stimme meiner Mutter über den Tisch, woraufhin meine Schwester sich grummelnd aufrichtete. »Wenn du weiterhin eine solch schlechte Haltung hast, wirst du einen Buckel bekommen, bevor du dreißig bist, und dann hat Mister Ventis sicherlich kein Interesse mehr an dir.« Die Lippen in ihrem teigigen Gesicht waren fest aufeinandergepresst, die Wangen trugen eine sanfte Rötung davon – wie immer, wenn sie sich aufregte.
Mister Ventis? Ich spitzte die Ohren und legte meine Gabel auf dem Tisch ab. Neugierig sah ich meine Schwester an, die endlich die Aufmerksamkeit bekam, nach der sie sich so sehr sehnte. Ein selbstgefälliges Lächeln erschien auf ihren Lippen, das ihre Augen strahlen ließ. Amelia war mit ihren lockigen blonden Haaren und den hohen Wangenknochen eine echte Erscheinung. Ihr Körper besaß an genau den richtigen Stellen Rundungen, war weniger dürr als meiner und wusste das andere Geschlecht zu beeindrucken.
»Ich habe ihn heute in der Stadt getroffen, Lauren«, quietschte sie und streckte mir über den Tisch ihre Hände entgegen, die ich zögernd ergriff.
Amelia war der einzige Mensch, der ausnahmslos immer warme Hände hatte, gleich wie kalt es draußen war. Gedankenverloren strich ich über ihre Finger.
»Es war rein zufällig«, erzählte meine jüngere Schwester mit aufgeregter Stimme. »Aber ich glaube, genau das war es, was es so besonders gemacht hat.«
Ich ließ ihre Hände wieder los.
»Besonders?«, schnaubte mein Vater und sah Amelia über den Rand seiner Zeitung an. Da er den ganzen Tag auf der Arbeit war, fand er meist nur abends Zeit zum Lesen. Seine dunkelbraunen Haare, die am Hinterkopf schon graue Stellen aufwiesen, wirkten immer etwas wild und durcheinander. »Was soll an einem bloßen Aufeinandertreffen besonders gewesen sein?« Seine runde Brille rutschte ihm beinahe von der Nase.
Desinteresse lag im Klang seiner Stimme verborgen, aber Amelia schien es nicht zu registrieren, sondern sie erzählte munter weiter: »Vielleicht hat uns das Schicksal zusammengeführt. Das Schicksal oder eine göttliche Fügung. Wie ihr es auch nennen wollt, da ist etwas zwischen uns.«
Mein Vater und ich setzten gleichzeitig zu einer Erwiderung an, aber ich ließ ihm den Vorzug und behielt meine ohnehin nicht sehr freundlichen Gedanken für mich.
»Amelia, dabei geht es nicht um Schicksal und der liebe Gott hat damit nichts zu tun. Abgesehen davon, dass er sicher nicht erfreut wäre, wenn sich ein Mädchen aus der Mittelschicht in der falschen Klasse verirrt.« Auf seiner Stirn standen tiefe Falten, um seinen Mund lag ein strenger Zug.
Meine Schwester seufzte und sah unsere Mutter flehentlich an, die nur einen abfälligen Blick für ihren Mann übrighatte.
»Die Zeiten ändern sich, Isaac«, sagte sie. »Ich habe Amelia und Lauren zu großartigen Töchtern herangezogen. Was spricht dagegen, dass sie sich in einer höheren Schicht nach einem Partner umsehen?« Sie reckte die Brust, strich sich eine Strähne ihres langen hellbraunen Haares aus dem Gesicht und blickte meinen Vater beinahe auffordernd an, was diesen dazu brachte, seine Zeitung im Zorn auf den Tisch zu knallen.
»Wer hat dir diese Flausen eingetrieben?«, grollte er. »Ich war es sicherlich nicht. Ein Vermischen der Schichten hat schon immer zu einem Skandal geführt und auch dieses Mal wäre es nicht anders. Wir haben wundervolle Töchter, ja, aber sie haben dennoch nichts in der Oberschicht verloren.«
Meine Mutter rümpfte die Nase und schnitt eine dünne Scheibe des Rinderbratens ab. Für gewöhnlich endeten Diskussionen jener Art an dieser Stelle. Heute aber wollte meine Schwester nicht klein beigeben. Ich sah, wie sie unruhig mit ihrer Gabel herumspielte.
»An unserem Treffen war absolut nichts Unschickliches«, verteidigte Amelia sich. »Wir sind uns vor Mistress Mercos Nähstube über den Weg gelaufen. Ich habe endlich ein Kleid für die Tanzveranstaltung im Madison House gefunden und wollte es zur Kutsche bringen. Mister Ventis schnitt mir den Weg ab und wünschte mir einen guten Tag.« Amelias Blick wurde sehnsüchtig.
Mein Vater blies abfällig die Wangen auf, offenbar hatte er der Angelegenheit nichts mehr hinzuzufügen und seine Meinung bereits deutlich genug zum Ausdruck gebracht.
Sein Schweigen deutete Amelia allerdings als Aufforderung, fortzufahren. Dem Blick meiner Schwester haftete etwas Schwärmerisches an, während sie weitererzählte. »Er hat blaue Augen, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Sein Lächeln ist diskret, aber warm. Außerdem habe ich von Leslie erfahren, dass er noch ungebunden, einer Frau aber nicht abgeneigt ist.«
In ihrer Stimme lag etwas Herausforderndes, das meinen Vater in die Höhe trieb. Wutschnaubend stand er vom Stuhl auf und schaute auf Amelia herab. »Bin ich eben nicht deutlich genug gewesen?«, ereiferte er sich. Seine rechte Hand war zur Faust geballt. »Du wirst diesen Mister Ventis vergessen, und zwar sofort! Ich dulde nicht, dass eine so kopflose Schwärmerei diese Familie ruiniert!« Er bedachte erst Amelia, dann meine Mutter mit einem bösen Blick.
Letztere wurde auf ihrem Stuhl immer kleiner. Schüchtern griff sie nach der Karaffe, in der sich Traubensaft befand, und schenkte sich ein Glas ein.
Schnaubend nahm mein Vater wieder Platz.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich meine Schwester, die missmutig die Arme vor der Brust verschränkt hatte und aus dem Fenster blickte. Selbst wenn sie wütend war, sah sie mit ihren großen Augen und den sanften Zügen wunderschön aus. Sie trug immer einen frischen, blumigen Duft davon – im Gegensatz zu mir, der es zu aufwendig war, sich mit Parfüm einzusprühen.
Missmutig presste sie die Lippen aufeinander. Ihre Schwärmerei für Mister Ventis hielt sich hartnäckig, und das schon mehr als zwei Monate. Ein solches Verhalten war ungewöhnlich für sie. Sie hatte schon für über ein Dutzend Männer Gefühle gehegt, aber diese waren meistens nach wenigen Tagen verflogen.
Ihr Seufzen drang zu mir herüber. Und während sie nach draußen schaute und die Flocken betrachtete, die sanft vom Himmel fielen und den Winter ankündigten, fragte ich mich, ob sie sich tatsächlich Chancen ausrechnete. Zwar existierten nicht mehr so viele Klassen wie noch vor zweihundert Jahren und hatte sich die Gesellschaft auch etwas dem Fortschritt geöffnet, aber Mister Ventis gehörte zu den reichsten und wohlhabendsten Personen aus ganz Newbarn. Der alleinige Gedanke, dass er für Amelia mehr als bloße Freundschaft empfand, war absurd.
Ich trank einen Schluck Traubensaft und starrte gedankenverloren auf die Erbsen auf meinem Teller. Eisiges Schweigen hatte sich breitgemacht und schließlich war es mein Vater, der es brach. Mein Vater, der rasch wütend wurde, aber dem seine Ausbrüche genauso schnell leidtaten.
Er beugte sich über den Tisch. »Amelia, sieh mich an«, bat er mit sanfter Stimme und wandte sich meiner Schwester zu, die sich schließlich zu ihm umdrehte und ihm einen langen Blick schenkte. »Ich möchte dich nicht verletzen und dir ganz sicher nicht dein Glück verwehren. Als Vater liegt mir nichts ferner, als dich traurig zu sehen.« Er strich sich über sein Kinn. »Dennoch leben wir in einer Gesellschaft, die mit bestimmten Regeln einhergeht und in der Normen und Werte herrschen, an die wir uns halten müssen. Diese Regeln sind nicht zufällig erschaffen worden, sie haben ihren Sinn und Zweck. Ich zweifele nicht daran, dass Mister Ventis ein gut erzogener Gentleman ist, der seiner künftigen Ehefrau sicherlich treu zur Seite stehen wird. Aber dennoch wird er sich niemals für dich entscheiden.«
Seine Worte trafen meine Schwester, auch wenn Vater sie vorsichtig ausgesprochen hatte.
»Wir gehören der Mittelschicht an, ja«, hielt Amelia dagegen und rückte mit ihrem Stuhl näher an den Tisch heran. »Aber wir bewegen uns nicht irgendwo in der Mittelschicht, sondern im oberen Drittel. Vielleicht …«
Mein Vater hob seine Hand, um Amelia zu unterbrechen. Der Blick, der seinem Gesicht anhaftete, duldete keinen Widerspruch.
»Dennoch werden wir nie der Oberschicht angehören«, sprach er die Worte, die er gefühlt schon tausendmal gepredigt hatte. Das Thema war für keinen von uns neu, dennoch musste er es wieder und wieder zur Sprache bringen, da Amelia nicht aufhörte, ihre Gefühle an Männer zu verschenken, die gesellschaftlich über uns standen. »Einen Adelstitel erwirbt man nicht über Nacht. Und auch wenn ich ein hart arbeitender Mann bin, werde ich niemals auch nur in Reichweite des Vermögens kommen, das ein Angehöriger der oberen Schicht in Newbarn genießt.«
Meine Schwester schürzte die Lippen.
»Kleines, versteh mich nicht falsch«, meinte er etwas versöhnlicher. »Ich möchte dich nur davor bewahren, die falsche Entscheidung zu treffen und dein Herz an einen Mann zu verlieren, der nicht damit umzugehen weiß.« Er lächelte sie aufmunternd an. »Du bist mit deinen sechzehn Jahren noch sehr jung. Du musst dich nicht sofort entscheiden, du hast Zeit, jemanden kennenzulernen und dich in ihn zu verlieben.«
»Aber was, wenn das schon geschehen ist?« Vielsagend zwirbelte Amelia eine Strähne ihres blonden Haares. »Was, wenn mein Herz bereits Mister Ventis gehört und ich es nie wiederbekomme?«
Ihre falsche Theatralik ließ mich räuspern. »Amelia, ihr habt bisher doch kaum miteinander gesprochen. Ich bin mir sicher, dass du ihn vergessen wirst, wenn erst der Richtige kommt.«
Meine Schwester zog die Augenbrauen hoch, scheinbar verwundert darüber, dass ich mich am Gespräch beteiligt hatte. »Na, du musst das natürlich wissen«, pfefferte sie mir entgegen. »Weil du ja schon so viele Erfahrungen gesammelt hast und das so gut einschätzen kannst.«
Ich wollte nicht wütend auf sie sein, sie tat das nur, weil sie verletzt war. Dennoch konnte ich nicht leugnen, dass ihre Worte mich trafen und die Mauer, die ich mühsam um mich errichtet hatte, zum Bröckeln brachten.
»Rede nicht so mit deiner Schwester!«, fuhr mein Vater Amelia an. Die Ader auf seiner Stirn pochte verräterisch. »Nicht jeder hat das Glück, so ein einnehmendes Wesen zu besitzen wie du!«
Mein Blick heftete sich auf die Tischplatte, weil ich wusste, dass drei Augenpaare auf mich gerichtet waren. Ich verabscheute es, wenn das Thema in diese Richtung driftete, und normalerweise wusste ich es geschickt zu umgehen.
»Auch Lauren wird einen Mann finden, wenn es an der Zeit ist«, hörte ich meine Mutter, die gar nicht daran zu denken schien, das Thema fallen zu lassen. »Bei manchen dauert es eben etwas länger als bei anderen.« Ihr ausfallender Bauch stieß gegen die Tischplatte. Obwohl sich ihre Figur in den letzten Jahren verändert hatte, trug sie noch immer die Kleider einer jungen Frau, die vor allem an Taille und Hüfte viel zu eng saßen.
Meine Wangen begannen zu glühen. In Situationen wie diesen wünschte ich mir ein wenig mehr Schlagfertigkeit. Angestrengt schaute ich auf meine Fingernägel und biss mir so fest auf die Unterlippe, dass es wehtat.
»Genau aus diesem Grund werden wir ja auch die Veranstaltung in Madison House besuchen«, fuhr meine Mutter fort. »Die Mädchen haben die Möglichkeit, sich zu zeigen, vorzustellen und einen Partner zu finden.«
Aus den Augenwinkeln sah ich meinen Vater nicken. Er schob sich seine Brille zurück auf die Nase.
»Amelia hat sich ihr Kleid heute Morgen ausgesucht und mit Lauren werde ich in den nächsten Tagen eines finden. Nicht wahr, Liebes?«
Mein Kopf schoss hoch. Schnell nickte ich, aber da hatte mich der Blick meiner Mutter schon gestreift.
»Mach dir keine Gedanken, auch wenn es nun schon so lange dauert. Wir finden jemanden für dich.«
Ich konnte ihren mitfühlenden Blick nicht ertragen. Überhaupt wollte ich nicht über dieses Thema reden, es trieb mich in den Wahnsinn. Wahrscheinlich wäre es mir selbst nicht einmal sauer aufgestoßen, dass ich bisher keinen Mann gefunden hatte, wenn meine Familie mich nicht in regelmäßigen Abständen immer wieder darauf hingewiesen hätte.
Nur mit Mühe konnte ich ein Schnauben unterdrücken.
»Auch aus deinem Gesicht kann man etwas machen, Lauren«, fing nun auch noch meine Schwester an. Nachdenklich legte sie den Kopf schief und beäugte mich wie ein wildes Tier im Zoo. »Ich habe dir schon oft angeboten, dass ich mich um deine Haare kümmere. Ich bin auch gern dabei, wenn du dir das Kleid aussuchst. Ein bisschen Farbe würde dir gut stehen.«
Sie alle wollten mir helfen, mich unterstützen und mir zur Seite stehen. Aber ich ertrug die ewige Diskussion um mein Äußeres und die damit einhergehenden schlechteren Chancen auf dem Heiratsmarkt nicht mehr.
Ich war nicht hässlich, aber im direkten Vergleich mit Amelia wirkte ich unscheinbar und etwas farblos. Mein Körper glich eher dem eines Jungen als dem einer Frau, sämtliche Kurven, die meine Weiblichkeit hätten unterstreichen können, fehlten mir gänzlich. Während Amelia die Grazie einer Elfe besaß und jeden möglichen Heiratskandidaten in Windeseile um den Finger wickelte, war es mir gerade einmal vergönnt, mich einigermaßen koordiniert zu bewegen. Mir fehlten ihre Schlagfertigkeit und ihr Charme. Außerdem strahlten meine Augen weniger als ihre, wenn ich lächelte. Ich wäre mit meinem Äußeren zurechtgekommen, wenn meine Familie mich nicht dauernd darauf hingewiesen und dadurch meine Minderwertigkeitskomplexe geschürt hätte.
Ich räusperte mich, ließ den Blick unruhig durch den Raum schweifen und blieb abermals am Fenster hängen. »Wie es aussieht, ist der Winter endlich da«, kommentierte ich das wilde Flockengetümmel vor der beschlagenen Scheibe.
Erleichtert nahm ich wahr, wie meine Eltern sich dem Fenster zuwandten. Nur Amelias Blick blieb an mir hängen.
»Was erwartest du, es ist Ende November«, meinte mein Vater. »Wenn der Schnee jetzt nicht kommt, wann dann?«
»Ich verabscheue diese nasse, matschige Pampe«, schimpfte meine Mutter und seufzte tief. »Die Sommer werden immer kürzer und die dunkle Zeit kommt jedes Jahr früher.«
»Das bildest du dir nur ein«, hielt Vater dagegen. »Aber auch meine Freude über den Winter hält sich in Grenzen.« Er fuhr sich über seinen Bartansatz.
Von Amelia kam zustimmendes Gemurmel. »Mir ist immer schrecklich langweilig, wenn es kälter wird. Man kann nicht mehr nach draußen und sitzt drinnen fest.«
Ich wollte einwerfen, dass es durchaus möglich war, im Schnee spazieren zu gehen, aber das würde meine Schwester nicht hören wollen. In Wahrheit ging es ihr nämlich nicht um die Kälte, sondern darum, dass sie nicht mehr mit ihren Freundinnen auf der Wiese picknicken und Besuch von jungen Männern bekommen konnte. Stattdessen war sie gezwungen, die Mädchen zu uns einzuladen, was damit einherging, dass männlicher Besuch von vornherein ins Wasser fiel.
Ich selbst mochte den Winter, war er doch eine Zeit, in der man zur Ruhe kommen und den Wahnsinn des Lebens für eine Weile vergessen konnte. Ich liebte die Stille, die Besinnlichkeit und die leeren Straßen.
Gedankenverloren schnitt ich mir ein Stück Braten ab und genoss den würzigen Geschmack im Mund. Mein Vater griff wieder nach seiner Zeitung, Mutter schaute weiterhin aus dem Fenster und Amelia schenkte sich Traubensaft nach. Stille Momente waren in unserer Familie selten, weswegen ich sie umso mehr schätzte.
Dennoch wollte es mir nicht gelingen, zu meiner guten Laune zurückzukehren, die ich am Anfang des Abendessens verspürt hatte. Das ewig gleiche Thema, das sich um das Finden eines Ehemannes drehte, lastete mir schwer auf der Brust.
Um Amelia machten sich meine Eltern keine Gedanken, war sie doch mit ihren sechzehn Jahren viel weiter als ich mit meinen zwanzig. Hinzu kam, dass unzählige Vertreter des männlichen Geschlechts empfänglich für ihr sanftes Gesicht, die großen Augen und die roten Lippen waren.
Missmutig beugte ich mich über den Tisch, um mein Antlitz im mittlerweile leeren Metallteller zu begutachten. Meine Haare hatten einen undefinierbaren Braunton, meine Wangen waren eingefallen, mein Kinn etwas zu spitz. Über meine Stirn zog sich eine hässliche Narbe, die ich mir bei einem Sturz in meiner Kindheit zugezogen hatte. Wahrlich kein umwerfender Anblick.
Zwei Stunden später lag ich auf meinem Bett und starrte die weiß gestrichene Decke über mir an. Auf meinem Nachttisch wartete ein Buch auf mich, eine Geschichte über eine junge Frau, die allen Widerständen zum Trotz das Haus ihrer Familie verließ und Ärztin wurde. Fortan lebte sie eigenständig und verdiente ihr eigenes Geld.
Gern hätte ich weitergelesen, aber im Moment konnte ich mich auf nichts konzentrieren. Das Gespräch meiner Eltern geisterte mir noch immer im Kopf herum. Erst das Klopfen an der Tür riss mich aus meinen düsteren Gedanken.
Bevor ich ein »Herein« rufen konnte, hatte Amelia sich in mein Schlafzimmer geschlichen. Sie trug ein knielanges weißes Nachthemd, das für die Jahreszeit viel zu dünn war. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Kerze.
»Kann ich reinkommen?«, fragte sie überflüssigerweise, denn sie hatte mein Bett bereits erreicht. Dennoch nickte ich, wartete darauf, dass sie die Kerze auf dem Nachttisch abstellte, und machte ihr neben mir Platz. Der alte Lattenrost quietschte, als Amelia sich zu mir legte.
Ich starrte weiterhin die Decke an, dennoch spürte ich den Blick meiner Schwester auf mir. Obwohl unsere Kindheit lange zurücklag und einem anderen Leben anzugehören schien, roch sie noch immer wie damals. Nach Unbeschwertheit und einem Sommer, der nie enden würde.
»Lauren, bist du böse auf mich?«, wollte sie wissen und ich bemerkte das Zittern in ihrer Stimme. »Falls ich mich beim Abendessen im Ton vergriffen oder etwas gesagt habe, das ich nicht sollte, dann tut es mir leid.«
Langsam drehte ich mich zu ihr um. Im Nachtkleid wirkte meine Schwester um Jahre jünger, was daran lag, dass sie keine Schminke mehr trug und ihre Lippen nicht länger kirschrot waren.
»Ich bin nicht böse auf dich«, erwiderte ich und sah sie lange an. »Ich mag es nur nicht, wenn das Thema immer wieder hervorgeholt wird. Uns kommen ja doch keine neuen Erkenntnisse.« Ich lächelte leicht und strich ihr durch das lockige Haar, so wie ich es früher immer getan hatte.
»Ich glaube, dass die Abendveranstaltung eine gute Möglichkeit ist, um jemanden kennenzulernen«, meinte Amelia. »Es werden so viele junge Männer anwesend sein. Irgendjemanden gibt es bestimmt, der dir gefällt.«
Ich konnte mir ein Seufzen nicht verkneifen. Sollte es nun ewig so weitergehen?
»Du bist zwar schon zwanzig, aber das bedeutet ja nicht, dass du keine Chancen mehr hast«, servierte meine Schwester mir die unbequeme Wahrheit auf einem silbernen Tablett. Sie rückte näher an mich heran und schien nicht zu spüren, wie sehr ich das Thema leid war. »Wie stellst du dir denn deinen Zukünftigen vor? Und … was ich dich schon länger mal fragen wollte …« Sie hielt inne und wich meinem Blick aus.
Verwundert runzelte ich die Stirn. Es passte nicht zu meiner Schwester, still und schüchtern zu werden. »Was ist los?«, erkundigte ich mich, woraufhin sie mich endlich wieder ansah.
»Ich frage mich manchmal, ob du deinen Zukünftigen nicht schon kennst.«
»Wie meinst du das?« Ich zupfte mein Nachtkleid zurecht, das eine unschöne Falte geschlagen hatte, und sah Amelia neugierig an. »Von wem sprichst du?«
In Gedanken ging ich die Männer durch, die ich in den letzten Jahren kennengelernt hatte, aber da diese an einer Hand abzuzählen waren, gab ich schnell auf.
»Ich rede von Francis«, meinte sie da und entlockte mir ein kleines Lächeln.
Sie war nicht die Erste, die die Vermutung äußerte, dass zwischen mir und Francis Waterstone mehr als bloße Freundschaft war. Ich kannte ihn bereits mein ganzes Leben lang. Wir waren zusammen aufgewachsen, weil unsere Eltern in engem Kontakt standen und wir gesellschaftlich in ähnlichen Kreisen verkehrten. Francis war die einzige Person, die nahezu alles über mich wusste, meine geheimsten Ängste kannte und immer zu mir hielt. Alles, was ihn betraf, fühlte sich vertraut an. Ich genoss es, in seiner Nähe zu sein, sein Lachen zu hören und mit ihm spazieren zu gehen – aber mehr als Freundschaft empfand ich ihm gegenüber nicht. Francis war der sichere Hafen, der Mensch, zu dem ich immer gehen konnte, wenn es mir schlecht ging.
»Weißt du, ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen, weil es das auch nie gegeben hat«, fing ich an und zwirbelte eine Strähne meines Haares, das aus der Schlafhaube hervorschaute. »Ich glaube, wenn er der Mann an meiner Seite wäre, hätte ich mich längst in ihn verliebt. Aber da sind keine Gefühle, zumindest keine, die über eine Freundschaft hinausgehen.«
Amelia sah beinahe enttäuscht aus. »Ich finde, ihr würdet gut zusammenpassen«, meinte sie, woraufhin ich sie zweifelnd ansah.
»Ach ja? Und woran machst du das fest?«
Sie dachte eine Weile nach und schon jetzt erkannte ich, dass ihr nichts einfiel. Weil es da nichts gab. Francis und mich verband eine enge Freundschaft, doch diese bot keinen Platz für romantische Gefühle.
»Vielleicht will ich einfach, dass du endlich glücklich wirst«, flüsterte meine Schwester so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte.
Es waren die Augen ihrer Kindheit, die mich ansahen und mich dazu brachten, sie in meine Arme zu schließen. Mütterlich strich ich ihr über den Rücken.
Als ich sie wieder losgelassen hatte, meinte sie kleinlaut: »Manchmal bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn sich ein Gentleman um mich bemüht. Mir kommt es dann vor, als dürfte ich ihn gar nicht bemerken, wenn du noch niemanden gefunden hast.«
Ihre kindliche Befürchtung brachte mich zum Lachen. Spielerisch kniff ich ihr in die Wange. »Du weißt schon, dass das dumm ist, oder?«, neckte ich sie. »Nur weil ich ein bisschen älter bin, bedeutet das doch nicht, dass du in allem auf mich warten musst.«
Amelia atmete aus, die Erleichterung war ihr anzusehen. »Danke, Lauren. Und ich bin mir sicher, dass du auch bald jemanden findest.«
Mein erster Impuls bestand darin, das Gespräch fallen zu lassen, aber weil ich die Sachlage nicht immer und immer wieder diskutieren wollte, fasste ich mir ein Herz. Ich setzte mich im Bett auf, lehnte mich gegen die kalte Steinwand und sagte: »Es muss komisch auf dich wirken, aber ich leide nicht so sehr darunter, keinen Mann an meiner Seite zu haben, wie du und unsere Eltern denken. Mich belastet es vielmehr, dass es immer wieder zur Sprache gebracht wird und ihr die Tatsachen nicht einfach akzeptiert.«
»Aber wir wollen dir doch helfen«, hielt meine Schwester dagegen.
»Das sehe ich und dafür danke ich euch auch. Dennoch … finde ich, dass es andere Dinge gibt, die genauso wichtig sind. Nur weil ich keinen Mann habe, heißt das nicht, dass …«
Amelia schüttelte den Kopf. »So meine ich das nicht. Aber wünschst du dir nicht auch einen starken Ritter an deiner Seite? Jemanden, der dich beschützt und für dich sorgt?«
Ihr Kommentar ließ mich an das Buch denken, das ich gerade las. »Weißt du, was ich wirklich schön fände?«, fragte ich daher und griff nach ihrer rechten Hand. »Ein Leben, über das ich selbst bestimmen kann. Ein Leben, in dem ich keine Rechtfertigung dafür abgeben muss, dass ich noch nicht verheiratet bin. Ich würde gern für mich selbst sorgen.«
»Für dich selbst sorgen?« Amelia riss die Augen auf und obwohl es mich traurig machte, war das genau die Reaktion, mit der ich gerechnet hatte. »Mutter und Vater wären davon sicherlich nicht angetan.«
Nein, das wären sie nicht. Weswegen ich den Wunsch auch immer in mir verborgen und nicht ausgesprochen hatte.
»Ist so etwas überhaupt möglich?«, wollte meine Schwester wissen, rollte sich auf den Bauch und stützte ihr Kinn auf den Handflächen ab.
Ich nickte. »Möglich ist es, wenn auch nicht einfach, und die Berufe für Frauen sind nach wie vor rar gesät.«
»Von welchen Berufen sprichst du, Lauren?«, erkundigte Amelia sich.
»Nun ja, man kann beispielsweise Gouvernante werden«, fing ich an, wollte die Berufswahl näher ausführen, aber meine Schwester unterbrach mich durch ihr lang gezogenes Seufzen.
»Davon gibt es doch momentan viel zu viele. Das hat Vater erst vor wenigen Tagen in der Zeitung gelesen. Außerdem bekommt man nur einen Hungerlohn und muss in Armut leben. Willst du das?« Ein stummer Vorwurf lag in ihren Augen.
»Natürlich will ich nicht in Armut leben«, meinte ich. »Und das ist auch gar nicht nötig. Man verdient zwar nicht viel, aber genug, um …«
»Ich weiß nicht«, fiel sie mir erneut ins Wort. »Mit einem Mann an deiner Seite könntest du es so viel einfacher haben. Dann musst du dir über die Arbeit keine Gedanken machen und kannst dein Leben so gestalten, wie du es willst.«
Ich wich ihrem Blick aus und schaute auf die Bettwäsche hinab, auf der sich Blumenranken tummelten. Sicherlich war es nicht meine erste Wahl, Gouvernante zu werden, aber ein Teil der Sorgen meiner Eltern schien auf mich übergegangen zu sein, weswegen ich mir schon jetzt Gedanken darüber machte, welche Möglichkeiten mir blieben, wenn es für mich keinen Mann gab.
Ich rang die Hände. »Das Ganze steht ohnehin in den Sternen«, tat ich das Thema ab. »Ich lese viel und das führt automatisch dazu, dass ich nachdenke.«
»Vielleicht solltest du mehr rausgehen«, schlug meine Schwester vor und knabberte auf ihrer Unterlippe herum. »Dich ein bisschen offenherziger zeigen.« Ihre warmen Augen strahlten.
»Ich fürchte … ich kann das nicht.« Es war schwer, mir diese Schwäche einzugestehen. »Ich bin nicht so positiv wie du. Nicht so lebensbejahend und optimistisch. Wenn du in einen Raum gehst, erfüllst du ihn mit Leben und alle drehen sich nach dir um. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Mich würde man nicht mal bemerken, wenn ich mit Weihnachtsdekoration behängt wäre.«
Der Vergleich entlockte meiner Schwester ein Grinsen. »Du machst das, was ich immer tue«, sagte sie. »Du überdramatisierst! Und du vergisst deine anderen Qualitäten.«
»Andere Qualitäten?« Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Nun ja.« Meine Schwester setzte sich neben mich, sodass ich ihr durch das seidige Haar fahren konnte. »Du bist klug. Wortgewandt. Belesen. Neben dir komme ich mir immer schrecklich dumm und einfältig vor.«
Ihre Worte brachten mich zum Lächeln. »Dennoch sind das nicht die Qualitäten, nach denen ein Mann in einer Frau sucht. Frauen, die zu viel lesen, gelten vielmehr als gefährlich. Und ich will nicht, dass mein Zukünftiger Angst vor mir bekommt.«
Gedankenverloren schaute ich an Amelia vorbei aus dem Fenster. Die Nacht hatte Einzug gehalten, der Schneefall bestand nur noch aus einzelnen Flocken, die verloren vor der Glasscheibe tanzten. Ein Gähnen entwich meinem Mund.
»Es ist schon spät, Ami«, sagte ich zu meiner Schwester und streckte meine müden Glieder. »Ich möchte noch ein bisschen Schlaf bekommen. Morgen werde ich mit Mutter in die Stadt gehen und nach einem Kleid Ausschau halten.«
Amelias Augen begannen zu funkeln. »Hast du dir schon überlegt, wie es aussehen soll? Nimm nicht wieder etwas Braunes, du brauchst ein bisschen Farbe.« Sie grinste schelmisch.
»Bisher habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht«, gab ich aufrichtig zu. Immerhin ging es hier nur um ein Kleid und nicht um eine Entscheidung fürs Leben. »Ich bin mir sicher, dass die Schneiderin mir helfen und das richtige finden wird.«
Meine Schwester sah nicht sonderlich überzeugt aus. »Lass dir bloß nichts aufschwatzen, was dir nicht gerecht wird. Nicht das Kleid trägt dich, sondern du trägst das Kleid.«
Ihre scheinbare Professionalität ließ mich schmunzeln. Meiner Schwester war die Liebe zur Mode in die Wiege gelegt worden. Mich selbst begeisterten Kleider nur gering. Es strengte mich an, mir über Stoffe und Muster den Kopf zu zerbrechen. Kleidung erfüllte für mich vielmehr einen praktischen Zweck.
»Ich bin mir sicher, dass wir etwas Gutes finden werden«, schloss ich daher das Gespräch und blickte zur Tür.
Amelia, die meinen stummen Appell richtig gedeutet hatte, richtete sich auf. »Ich hab dich lieb, Lauren«, sagte sie mit einer kindlichen Naivität, die mir das Herz zusammenschnürte.
Ich schloss sie fest in meine Arme und es fiel mir schwer, sie wieder loszulassen. Als sie aus der Tür gegangen war, die sie aus Gewohnheit einen Spalt offen ließ, schaute ich ihrem verlorenen Schatten noch eine Weile hinterher.
ZWEI
Ich hatte darüber gelesen, einige Male, doch schien mir die Situation so absurd und realitätsfern, dass ich sie niemals als glaubhaftes Szenario für mein Leben in Betracht gezogen hätte. Ich hatte nie darüber nachgedacht, was ich tun würde, wenn unser Haus in Flammen stand. Ich hätte es für einen Albtraum gehalten, für eine groteske Vision vielleicht, mich im Bett auf die Seite gedreht und die Augen wieder geschlossen.
Aber nichts von dem konnte ich tun, als ich schweißgebadet wach wurde und in das Flammenmeer blickte, das sich vor mir ausbreitete. Es dauerte einige Sekunden, bis ich realisierte, was geschehen war. Und selbst dann konnte ich es nicht glauben.
Reflexartig setzte ich mich im Bett auf und stieß die Decke von mir. Der Schweiß lief mir in Strömen über das Gesicht. Ich vergaß, wie man atmete, vergaß, wie man dachte, wie man fühlte. Wie gebannt starrte ich auf das Feuer, das längst in mein Zimmer gedrungen war und sich rasend schnell ausbreitete. Die Flammen fraßen sich über meine blütenweiße Gardine vor dem Fenster in die Höhe. Ich zuckte zusammen, als auch der Schreibtisch knisternd Feuer fing.
Mein Denkvermögen war wie lahmgelegt. Was tat man in einer Situation wie dieser?
Überfragt ließ ich den Blick durchs Zimmer schweifen – alles war rot.
Und dann hörte ich sie. Die Schreie, die so laut waren, dass sie auch von draußen an mein Ohr drangen. »Feuer!«, riefen sie. »Feuer! Rettet euch! Kommt aus dem Haus!«
Vielleicht war es diese direkte Aufforderung, die mich letztlich in die Höhe trieb. Mit der neu gewonnenen Kraft kam auch die Panik.
Blindlings kämpfte ich mich aus dem Bett und sah mich ängstlich um. Den Weg nach draußen auf den Flur würde ich nicht nehmen können, denn dort wüteten die Flammen am stärksten. Blitzschnell drehte ich mich zu der zweiten Tür um, die ins Wohnzimmer führte. Vielleicht könnte ich dort hindurchgehen, auf der anderen Seite in den Flur gelangen, die Treppe nach unten nehmen und …
Die Ernüchterung kam, als ich die Klinke heruntergedrückt hatte und in unser Wohnzimmer schaute, das nur noch in Grundzügen dem Raum ähnelte, in dem wir unser Abendessen eingenommen hatten. Das Feuer hatte den Tisch bereits vollständig verbrannt und machte sich nun über einen der Stühle her.
Vor Entsetzen presste ich mir die Hand vor den Mund. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich eingesperrt war und nirgendwohin konnte. Eine tiefe Panik breitete sich in mir aus, die kontinuierlich heranwuchs und mir Tränen in die Augen trieb.
Verzweifelt drehte ich mich zweimal um die eigene Achse, dann blieb mein Blick am Fenster hängen, das vielleicht mein einziger Fluchtweg war.
Ich rannte über den brennenden Holzboden. Mit Müh und Not erreichte ich das Fenster, auf das das Feuer noch nicht vollständig übergegriffen hatte. Ich drehte den Griff nach rechts, riss es auf und atmete gierig die frische Nachtluft ein.
»Feuer! Feuer!«, drangen die Rufe nun deutlicher an mein Ohr und ich blickte nach unten, wo sich eine Menschentraube versammelt hatte, die ängstlich nach oben schaute.
Während die Flammen in meinem Rücken immer heißer wurden und das Feuer sich rasant ausbreitete, sah ein Mann mich am Fenster stehen. »Miss!«, rief er, die Hand zu einem Trichter geformt, um gegen den Winterwind anzukommen. »Miss, Sie müssen sofort aus dem Haus raus! Das Feuer ist überall!«
Panisch blickte ich nach unten. Würde ich einen Sprung überleben? Wir hatten eine Wohnung in der ersten Etage gemietet, bis nach unten war es nicht sonderlich weit. Mit Glück konnte ich …
Ein Schrei ließ mich zusammenzucken. Verwirrt wandte ich den Kopf gen Himmel, der von dunklen Wolken bedeckt war. Mehrere Krähen zogen ihre Kreise am Firmament und spannten die Flügel aus. Ihr Krächzen durchbrach die Nacht. Instinktiv fragte ich mich, wie so viele von ihnen in die Stadt gekommen waren.
Aber es blieb keine Zeit, um weiter darüber nachzudenken. Eine Flamme traf meine rechte Hand, Schmerz pulsierte durch meine Finger. Der Weg nach hinten war mir versperrt, also blieb mir keine andere Wahl.
Entschlossen kletterte ich auf die Fensterbank und vermied den Blick nach unten, der mich schwindeln ließ. Dreimal atmete ich durch, dann sprang ich in die Tiefe, wohl wissend, dass dort unten genügend Menschen waren, die sich um mich kümmern konnten.
Ich kam auf den Knien auf – und obwohl ich mich mit den Armen abstützte, zuckte der Aufprall durch meinen ganzen Körper und ließ mich schmerzhaft aufstöhnen.
»Miss, geht es Ihnen gut? Miss Lauren, hören Sie mich?«, kam eine Stimme von rechts.
Mühsam verkniff ich mir ein weiteres Stöhnen und nickte. Schon jetzt wusste ich, dass ich keine schwerwiegenden Verletzungen davontragen würde. Vielleicht ein paar Abschürfungen oder Kratzer, aber nichts Weltbewegendes.
Ich griff nach der Hand, die mir entgegengestreckt wurde, und ließ mich von einem Mann mittleren Alters mit Schnauzbart hochziehen. Fragend sah er mich an – und ich nickte ihm zu, um ihm zu verdeutlichen, dass es mir gut ging. Zumindest so gut, dass ich keine medizinische Versorgung benötigte.
Ich klopfte mir den Ruß vom Nachthemd und schlang die Arme um den Oberkörper. Es war mitten in der Nacht und eisig kalt. Unaufhörlich schlugen meine Zähne aufeinander und eine Gänsehaut breitete sich auf meinem ganzen Körper aus.
»Hier, nehmen Sie meinen Mantel«, sagte der Mann, der mich hochgezogen hatte, und hielt mir eine dicke Jacke hin. Er selbst stand nur noch im Nachtgewand da, was ihm aber nichts auszumachen schien. Dankend nahm ich den Mantel entgegen und schlüpfte in seine warmen Ärmel.
In meinem Kopf herrschte ein heilloses Chaos, das es mir unmöglich machte, meine Gedanken zu ordnen. Erst als ich ein paar Schritte vom Haus wegtrat und den Kopf in den Nacken legte, wurde mir die Katastrophe wieder bewusst.
Das Feuer wütete noch immer, machte unsere Wohnung dem Erdboden gleich. Menschen liefen aufgeregt hin und her, Wassereimer in ihren Händen, die sie auf die brennende Fassade schütteten. Doch ihre Mühe war umsonst, das Feuer viel zu stark, um es mit solch laienhaften Methoden zu löschen.
Tränen traten in meine Augen, als ich erkannte, dass mein Zuhause im Begriff war, zu verschwinden. Ich hatte nicht einmal Zeit gehabt, etwas mitzunehmen. Etwas … oder …
Ich erstarrte, dann blitzten die Gesichter meiner Eltern und Amelias vor meinem inneren Auge auf.
»Wo ist meine Familie?«, schrie ich in die Menge. »Wo sind sie?«
Ich klang panisch, überfordert … genau so, wie ich mich fühlte.
Blindlings lief ich los, schälte mich durch die neugierige Menschenmenge, wich einem Eimer Wasser aus, der im Begriff war, über mich ergossen zu werden, und stieß einen gaffenden Mann unsanft zur Seite.
»Wo ist meine Familie?«, wiederholte ich, lauter dieses Mal. Aus den Augenwinkeln erspähte ich eine Frau, die mich mitleidig ansah.
Ich lief weiter, bis ich die Eingangstür erreicht hatte. Hier standen die Menschen besonders dicht, aber das würde mich nicht davon abhalten, mir einen Weg ins Innere des Hauses zu bahnen. Ich atmete tief durch, dann entdeckte ich einen kleinen Durchgang, durch den ich entwischen konnte.
Die Verbrennung an meiner Hand schmerzte heftig, aber ich biss die Zähne zusammen. Endlich hatte ich die Tür erreicht, auf die das Feuer noch nicht übergegangen war. Ich griff nach der Klinke, als mich jemand bestimmt bei der Schulter fasste und mich von meinem Vorhaben abhielt.
»Miss, Sie dürfen da nicht rein. Das Feuer wütet im ganzen Haus.«
Ich hob den Blick und sah in das graue Augenpaar eines Polizisten. Er trug eine dunkelblaue Uniform und einen grauen Hut, der mich entfernt an einen Zylinder erinnerte. Energisch schüttelte ich seine Hand ab. »Meine Familie …«, stammelte ich. »Ich muss da rein, sie schlafen vielleicht noch, ich kann …« Meine Stimme brach und ich blickte hinauf in die grellen Flammen.
»Sie haben im ersten Stock gewohnt, oder, Miss?«, fragte der Polizist, woraufhin ich widerwillig nickte. Dann schüttelte er den Kopf – und die Gewissheit, die in dieser Geste lag, machte mir Angst. »Es ist alles niedergebrannt«, sagte er. »Sie haben Glück, dass Sie es raus geschafft haben.«
»Aber hier geht es doch gar nicht um mich!«, schrie ich ihm entgegen und scherte mich nicht um meine Unverschämtheit. »Wo ist meine Familie? Wo sind meine Eltern? Meine Schwester?«
»Wir sind dabei, das Feuer zu löschen, Miss«, erklärte der Polizist.
Die Gleichgültigkeit in seiner Stimme trieb mich in den Wahnsinn. Wie konnte er so nüchtern bleiben? Nicht eine einzige Emotion tummelte sich in seinem Gesicht.
»Wo sind meine Eltern?«, fragte ich ihn wieder und merkte, wie Tränen mein Sichtfeld verschleierten. Eine grauenhafte Vorahnung machte sich in mir breit, eine Wahrheit, die ich noch nicht akzeptieren konnte.
Der Polizist verzog den Mund. »Das Feuer konnte noch nicht gelöscht werden. Es ist zu gefährlich, Sie können auf keinen Fall zurück in das Haus. Wir kümmern uns um alles Weitere.« Er wich meinem Blick aus, schwieg eine Weile, sah mich dann wieder an. »Es sieht allerdings nicht gut aus, Miss. Sie haben es rechtzeitig geschafft … aber wir wissen nicht, was mit Ihrer Familie ist, ob …«
»Nein …«, stammelte ich, bevor er seinen Satz beenden konnte. »Nein, es … geht ihnen sicherlich gut. Sie müssen nur ihr Bestes geben!« Ich lachte hysterisch, während ich merkte, wie meine Beine sich in Pudding verwandelten und unter mir nachgaben.
Der Polizist hielt mich ungelenk fest, aber ich kämpfte mich frei.
»Meine Familie kann gerettet werden!«, schrie ich ihm ins Gesicht, als ich die Haltung wiedererlangt hatte. »Sie haben keine Ahnung. Meine Familie … Amelia … sie sind bestimmt vor mir rausgekommen. Sie sind irgendwo … irgendwo hier …« Verwirrt blickte ich mich um, stolperte nach vorn, schob Männer zur Seite, sah mich nach einem bekannten Gesicht in der Menge um.
Mein Vater war ein rationaler, vernünftiger und hochintelligenter Mann. Sicherlich hatte er das Feuer rechtzeitig bemerkt und Mutter geweckt. Amelias Zimmer lag direkt neben ihrem. Gemeinsam waren sie geflohen, konnten die Treppe ins Erdgeschoss nehmen und hielten sich jetzt irgendwo in meiner Nähe auf.
Ich nickte. Verbissen suchte ich weiter. Sicherlich warteten sie auf mich.
Von neuer Kraft erfüllt, ließ ich die Menschenmenge hinter mir und bog in eine Seitengasse ein. Gut möglich, dass der Schreck meine Familie weg vom Geschehen getrieben hatte. Sie hatten Zuflucht in der Stille gesucht und genau dort würde ich sie finden.
Ich lief an einer Laterne vorbei, die schwaches Licht spendete, und schloss die hölzernen Knöpfe des dicken Mantels, den mir der Mann gegeben hatte. Unablässig setzte ich einen Schritt vor den anderen. Der Schnee drang in meine Hausschuhe ein, die meine Füße zum Glück so fest umschlossen, dass ich sie beim Sprung nicht verloren hatte.
Hoffentlich bewegte ich mich in die richtige Richtung.
Erneut hörte ich das Krächzen der Krähen. Ich warf einen Blick gen Himmel, an dem sich die schwarzen Vögel tummelten und Sinnbild für das Unheil waren, das tief in mir geschah.
»Amelia!«, rief ich, eine schwache Stimme im Lärm der Nacht. »Mutter, Vater, wo seid ihr? Mir geht es gut, ihr könnt euch zeigen!«
Ich wusste nicht, wie lange ich unterwegs war, wie viele Straßen und Plätze ich nach ihnen absuchte, aber irgendwann trieb mich mein Weg wieder zu unserem Haus. Vielleicht waren sie ebenfalls dorthin zurückgekehrt und hielten hier nach mir Ausschau. Ich sehnte mich nach der Wärme meiner Mutter, der Direktheit meines Vaters. Und nach Amelia. Meiner wundervollen, optimistischen Schwester, die mir ein Licht in dunklen Tagen war.
Meine Haare waren nass vom Schnee, die Schlafhaube hatte ich längst verloren. Ich zitterte am ganzen Körper.
Endlich hatte ich unser Haus erreicht. Und obwohl ich nicht weinen wollte, tat ich es doch, denn der Anblick des einst so stattlichen Gebäudes zwang mich in die Knie. Die beiden oberen Etagen waren vollständig abgebrannt, das Fundament des Hauses kam einer Ruine gleich.
Ich schluchzte und vergaß für einen Moment, wie man atmete. Zitternd stand ich vor dem Gebäude, das zwar nicht mehr brannte, aber auch nicht mehr gerettet werden konnte. Es war mir, als hätte man meine gesamte Existenz ausgelöscht. Als wäre mein ganzes Leben in den Flammen gestorben.
»Amelia!«, rief ich, verwundert darüber, wie viel Kraft in meiner Stimme lag. »Amelia, bist du hier irgendwo?«
Ich war mir der Blicke der Anwesenden bewusst, aber es kümmerte mich nicht. Irgendwann würde ich meine Familie finden, ich durfte nur nicht aufgeben.
»Hat jemand Mister und Mistress Cunningham gesehen?«, rief ich in die Menge.
Was ich erhielt, war Getuschel, aber keine Antwort, die mich weiterbrachte.
Vielleicht waren sie hinter dem Haus! Hatten dort Zuflucht gesucht! Ein Lächeln glitt über meine Lippen, begleitet von einer tiefen Erleichterung. Wieso war mir der Gedanke nicht früher gekommen? Bald würde ich sie wiedersehen, ich war nur noch wenige Meter von ihnen entfernt.
Eilig umrundete ich die Ruine des Hauses, als mich erneut jemand bei der Schulter fasste und zum Anhalten zwang. »Ich kann jetzt nicht …«, murmelte ich und wollte mich freikämpfen, aber sein Griff war so fest, dass ich nicht weiterlaufen konnte. Seufzend blieb ich stehen, drehte mich um … und sah Francis Waterstone, meinen besten Freund. Er blickte mich aus traurigen grauen Augen an. Sein aschblondes Haar war nass vom Schnee.
»Francis?«, murmelte ich verwirrt.
Seinem Gesicht haftete ein bekümmerter Ausdruck an. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch besann sich eines Besseren und schloss mich in die Arme. Zunächst wehrte ich mich gegen seine Berührung, die mir unpassend und zu intim vorkam, aber sein Geruch war mir so vertraut, dass ich es nicht schaffte, mich von ihm zu lösen.
»Es tut mir so leid, Lauren«, flüsterte er an mein Ohr. »So unendlich leid.«
Ich schluckte, wollte nicht, dass er weitersprach, aber er gab meinem Protest keinen Raum.
»Ich werde dir helfen. Zusammen schaffen wir das.«
»Ich muss meine Familie suchen«, hielt ich dagegen, mehr als Trotzreaktion als aus echter Überzeugung. Francis hielt mich ein bisschen fester. »Sie sind bestimmt irgendwo und machen sich Gedanken um mich. Ich muss …«
Dieses Mal versuchte ich ernsthaft, mich von ihm zu lösen, aber sein Griff war fest und bestimmt.
»Du kannst sie nicht mehr finden, Lauren«, sagte er. Die Sanftheit in seiner Stimme brachte mich um, sehr viel mehr als das, was er tatsächlich sagte. »Es ist zu spät. Ich habe eben mit einem Feuerwehrmann gesprochen. Es konnte niemand aus dem Haus gerettet werden. Es hat lange gedauert, das Feuer zu löschen, und da war es bereits zu spät.«
»Nein«, beharrte ich, schüttelte den Kopf, wieder und wieder. »Nein, sag so etwas nicht! Es ist gefährlich, wenn man so etwas behauptet und …«
»Lauren!« Francis ließ mich los, griff aber sogleich nach meiner unverletzten Hand und sah mir tief in die Augen. Ich nahm den Schmerz kaum wahr, fühlte mich wie taub.
Es lag so viel Liebe in Francis’ grauen Augen, dass ich es kaum ertrug.
»Du hast es als Einzige aus dem Haus geschafft«, eröffnete er mir und strich über meinen Handballen. »Deine Familie … lebt nicht mehr.«
Es war, als wäre ein Blitz direkt in mich eingedrungen und hätte meinen Körper in zwei Teile gespalten. Erschüttert schüttelte ich seine Hand ab und trat einen Schritt zurück. Auf einmal wollten das Verdrängen, das Leugnen und das Nicht-wahrhaben-Wollen nicht mehr funktionieren, auf einmal krachte die Wahrheit auf mich ein. Und sie begrub mich unter sich.
»Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt«, fuhr Francis fort, aber ich hörte ihm nicht mehr zu. Das Einzige, was in meinen Ohren widerhallte, war der Satz, der meine Welt zum Einsturz gebracht hatte.
Deine Familie lebt nicht mehr.
Deine Familie lebt nicht mehr.
Lebt nicht mehr.
Ich presste mir die Hand vor den Mund, da gaben meine Beine unter mir nach. Bevor Francis mich auffangen konnte, prallte ich auf den steinernen Boden. Schlang die Arme um meine Knie, rollte mich zu einer Kugel zusammen. Ich wollte nie mehr aufstehen.
DREI
Die nächsten Tage nahm ich wie in Trance wahr. Ich kam bei Mistress Whitefield unter, einer alten verwitweten Nachbarin, die ein Gästezimmer hatte, in das ich mich zurückziehen konnte. Ihre Wohnung war groß, aber leer. Mit dem Erbe ihres Ehemannes hatte sie offensichtlich nichts angefangen.
Ich schlief in einem kleinen Raum, der abgestanden roch und in mehr als einer Hinsicht unbequem war. Nachts war es so kalt, dass mich selbst eine zweite Decke nicht warm zu halten vermochte und ich am Morgen mit klappernden Zähnen aufwachte.
Ein Polizist hatte mir nach der Nacht des Feuers bestätigt, dass man die Überreste meiner Familie in unserem Haus gefunden hatte, dass es unmöglich gewesen war, jemanden von ihnen zu retten. Die Ursache für das plötzliche Feuer war weiterhin unbekannt – man tippte auf Brandstiftung, aber da wir keine Feinde hatten, kam mir der alleinige Gedanke, dass uns jemand so schaden wollte, abstrus vor.
Man hatte mir gesagt, dass ich froh darüber sein konnte, dass ich es unbeschadet aus dem brennenden Gebäude geschafft hatte und noch am Leben war.
Froh? Das bittere Lachen steckte mir noch immer in der Kehle fest. Zu ihm gesellten sich tausend ungesagte Worte, die nicht über meine Lippen kommen wollten.
Meine Hand war gut versorgt worden, sodass sie nur noch ein dumpfes Pochen davontrug. Ich hatte mir darüber hinaus eine Rauchvergiftung eingefangen, wurde aber nach zwei Tagen im Hospital wieder entlassen. Körperlich schien also alles in Ordnung zu sein. Und dennoch …
Ich konnte nichts essen, konnte kaum etwas trinken und das Einschlafen fiel mir schwerer denn je. Ja, ich selbst war glimpflich davongekommen, aber machte es das leichter?
Ich musste Mistress Whitefield zugutehalten, dass sie mich in Ruhe ließ. Dass sie nicht ständig in mein Zimmer kam, mich zu trösten versuchte, wo es keinen Trost gab, und mich mit ihrer Anwesenheit belästigte. Sie war diskret und wusste, dass ich Zeit für mich brauchte, welche sie mir auch gab. Im Gegensatz zum Großteil der anderen Nachbarn.
Gestern hatte es fünfmal an der Haustür geschellt – und ich hatte drei Mal den Fehler begangen, zu öffnen. Prinzipiell wusste ich, dass die Familien aus den umliegenden Häusern es nur gut meinten, aber ihre Fürsorge prallte an mir ab.
Zwei Tage später saß ich im Empfangssaal von Mistress Whitefields Haus und spielte nervös an meinen Händen herum. Direkt vor mir flackerte ein Feuer im Kamin, dennoch wollte es einfach nicht warm werden und meine Finger blieben klamm. In unregelmäßigen Abständen starrte ich zur Tür. Mistress Whitefield hatte mich gebeten, hier zu warten, dennoch zuckte die Aufregung wie ein Blitz durch meinen Körper. Ich rutschte unruhig auf der grünen Chaiselounge hin und her, während ich auf die große goldene Uhr starrte, die über dem Kamin hing.
Für drei Uhr nachmittags hatte sich Mister Jameson, der Notar unserer Familie, angekündigt, und die Zeit wollte nicht vergehen. Dieses Treffen war nicht nur wichtig, es war essenziell, weil meine ganze Zukunft davon abhing. Eine Zukunft, die sich um einhundertachtzig Grad gedreht hatte, als ich aus dem brennenden Haus gesprungen war.
Meine Handflächen waren schweißnass, mein Herz klopfte unregelmäßig und viel zu schnell. Mir war nach Weinen zumute, aber in den letzten Tagen waren genügend Tränen geflossen. Zumindest für dieses Treffen wollte ich stark sein.
Ich wusste, dass meine Eltern sich schon vor einigen Jahren um ihr Testament gekümmert hatten, um Katastrophen wie dieser vorzubeugen. Ich wusste auch, dass wir finanziell abgesichert waren und es für mich irgendwie weitergehen würde. Aber dennoch hatte ein ungutes Gefühl von mir Besitz ergriffen, das meinen ganzen Körper lähmte und jeden Atemzug erschwerte.
Als die Tür aufgerissen wurde, zuckte ich zusammen. Ich rechnete mit Mister Jamesons ausgemergeltem Gesicht, stattdessen schob sich Francis in den Raum. Ich atmete aus, Erleichterung durchströmte mich. Er war mir in den letzten Tagen die größte Hilfe gewesen und gleichzeitig der Einzige, mit dem ich reden konnte, der aber auch mein Schweigen verstand. Als ich bei Mistress Whitefield eingezogen war, hatte ich ihr verdeutlicht, dass ich keinen Besuch wollte, Francis aber die Ausnahme darstellte, weil es mir guttat, ihn zu sehen. Wenn ich in seine treuen Augen blickte, konnte ich mich für eine Weile in der Welt verlieren, die mir genommen worden war. Unzählige gemeinsame Erinnerungen zogen sich durch unser Leben – wir standen einander emotional so nahe, dass ich glaubte, dass er meinen Schmerz verstand.
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Francis mich an, um abzuschätzen, ob sein Besuch für mich in Ordnung war, dann ging er auf mich zu, nahm neben mir auf der Chaiselongue Platz und strich mit seinen schlanken Fingern über meinen Oberschenkel. »Ich habe mir gedacht, dass du seelische Unterstützung brauchst«, kommentierte er und lächelte sanft.
»Ich danke dir«, sagte ich leise.
»Wie geht es dir heute?«, erkundigte er sich vorsichtig und sah mich an. Seine aschblonden Haare waren noch nass vom Schnee, der durch die Wärme des Feuers schmolz, langsam seine Wangen hinabrann und von seinem schmalen Kinn tropfte. Ich vermisste die Grübchen, die sich um seine Mundwinkel legten, wann immer er lächelte.
Ich atmete aus. »Ein bisschen besser als gestern. Ich konnte ein paar Stunden schlafen.«
Francis nickte. Seine rechte Hand lag auf meiner Schulter. »Kannst du es mittlerweile begreifen?«, wollte er wissen und brachte mich dazu, den Blick abzuwenden und den dunkelblauen Teppich unter uns zu mustern.
»Es gibt nicht genügend Zeit, um zu realisieren, dass ein Feuer meine ganze Familie ausgelöscht hat und ich sie nie mehr sehen werde. Ich glaube, das ist einfach zu viel für mich.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich kann es hundertmal sagen, aber ich werde es nicht ein einziges Mal glauben.«
Als ich in Francis’ Augen schaute, war sein Blick einfühlsam.
»Ich bin für dich da, Lauren«, versicherte er mir.
Es war abermals das Knarren der Tür, das uns aus dem Gespräch riss. Mistress Whitefield betrat den Raum und ich wusste, dass die Zeit gekommen war.
»Lauren, Mister Jameson ist da, um mit dir das Testament deiner Eltern zu besprechen«, kündigte sie den Besucher an.
Ich nickte abwesend, mein Blick lag schon auf dem groß gewachsenen Mann, der hinter Mistress Whitefield durch die Tür trat und sich aus seiner schwarzen Jacke schälte.
»Guten Morgen, Lauren«, begrüßte er mich freundlich und nickte Francis zu. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.«
Ich nickte schnell, wusste nicht, ob ich aufstehen und ihm die Hand reichen oder auf dem Sofa sitzen bleiben sollte.
Mistress Whitefield nahm dem Notar die Jacke ab, ebenso wie den großen schwarzen Zylinder. »Nehmen Sie Platz«, bedeutete sie ihm und zeigte auf die Chaiselongue.
Ich rutschte ein Stück nach rechts, damit er sich setzen konnte, auch wenn das bedeutete, dass sich mein Oberschenkel an Francis’ Bein drückte. Es kam einem Affront gleich, wenn sich ein Mann und eine Frau so nahe kamen, ohne dass sie den Bund der Ehe eingegangen waren. Doch in Anbetracht der Umstände wollte ich nicht länger darüber nachdenken.
»Mister Waterstone?«, fragte der Notar und stellte seine Tasche auf dem Tisch vor uns ab. »Hätten Sie die Güte und würden Lauren und mich für eine Weile allein lassen?«
Ich sah das Missfallen, das sich auf dem Gesicht meines besten Freundes ausbreitete, und schüttelte schnell den Kopf. »Mister Waterstone ist mir eine seelische Stütze«, verriet ich dem Notar. »Es wird mir helfen, wenn er bei der Testamentsverkündung dabei ist.«
Der grauhaarige Mann zögerte kurz, dann nickte er. Er beugte sich nach vorn, öffnete seine schwarze Aktentasche und zog einen Stapel Papier heraus, den er auf seinem Schoß platzierte. Neugierig starrte ich darauf, wurde aber aus den Zahlen und Berechnungen nicht schlau. Besorgt sah ich Francis an, der mir ein aufmunterndes Lächeln schenkte.
»Lauren, Ihr Verlust tut mir unendlich leid«, begann der Notar.
Ich schaute ihm nicht in die Augen, blickte stattdessen auf die dürren Finger mit den viel zu langen Nägeln. In meiner Kindheit hatte ich mich vor ihm gefürchtet, er war mir wie eine Schreckensgestalt vorgekommen, die mich auch in meinen Träumen besuchte. Nun war seine Anwesenheit beinahe ein Trost für mich, weil sie mich an unbeschwertere Zeiten erinnerte.
Mister Jameson ordnete die Papiere auf seinem Schoß. »Ihre Eltern haben einvernehmlich entschieden, dass nach ihrem Tod alles Geld und jeglicher Besitz gleichmäßig zwischen Ihnen und Ihrer Schwester Amelia aufgeteilt wird. Hier haben Sie eine Abschrift des Testaments, die Ihr Vater erstellt hat.«
Er reichte mir ein etwas verblichenes Blatt Papier, das ich mit zitternden Fingern entgegennahm. Die krakelige Handschrift meines Vaters zu sehen, tat mir im Herzen weh.
»Sie können es später lesen«, meinte Mister Jameson, der offensichtlich bemerkt hatte, dass ich mit den Tränen kämpfte.
Francis griff nach meiner Hand, aber ich versicherte ihm mit einem Blick, dass ich es schaffen würde.
»Auf wie viel beläuft sich das Vermögen meiner Eltern?«, fragte ich den Notar, der sich bereits über eine weitere Seite gebeugt hatte. Er erwiderte meinen Blick nur kurz, doch es lag etwas in seinen Augen, das mir Unbehagen bereitete.
»Lauren …«, sagte er und verschränkte die Hände im Schoß. »Sie haben es zeit Ihres Lebens sehr gut gehabt und mussten sich keine Gedanken über Ihre Zukunft machen. In Ihren ersten Lebensjahren hat Ihr Vater monatlich einen Teil seines Lohns zurückgelegt, um Ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen. Leider …«
»Leider?«, kam es Francis über die Lippen. Ich sah, dass er die Augenbrauen zusammengezogen hatte.
Das ungute Gefühl in meinem Unterleib verstärkte sich und wurde auch durch Mister Jamesons unverfängliches Lächeln nicht abgemildert.
»Ich habe mich mit den Finanzen Ihrer Eltern auseinandergesetzt und leider sieht es nicht allzu gut aus.«
»Was bedeutet das – nicht allzu gut?«, kam es erneut von Francis.
Ich war froh, dass er das Gespräch für mich aufrechterhielt, denn ich selbst hatte genug mit meinem klopfenden Herzen zu tun, das sich nicht mehr beruhigen lassen wollte.
Mister Jameson zog sein Hemd glatt und räusperte sich. »Ihre Eltern haben über ihre Verhältnisse gelebt, vor allem in den letzten Jahren. Die Wirtschaftskrise hat vieles teurer gemacht, Ihre Eltern haben sich der neuen Preiskultur allerdings nicht angepasst.« Mister Jameson hüstelte. »Der ungeschickte Umgang mit Geld hat dazu beigetragen, dass das Erbe, das auf Sie und Ihre Schwester übergehen sollte, negiert wurde.«
»Negiert?«, hakte ich alarmiert nach. »Was bedeutet das?«
Francis neben mir spannte sich an.
Der Notar durchwühlte den Papierstapel und zog einen kleinen Zettel hervor, der beidseitig mit Ziffern beschrieben war. Mit sonorer Stimme erklärte er mir die Rechnung, doch ich war zu angespannt, um irgendetwas davon aufzunehmen. Eines jedoch verstand ich: Die roten Ziffern am unteren Rand des Papiers bedeuteten nichts Gutes.
»Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für Sie, Lauren«, sagte der Notar und sah mich ernst an. »Leider kann ich Ihnen kein Erbe zusprechen, sondern Ihnen nur alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft wünschen.« Er entzog mir das Blatt Papier.
»Was bedeutet das?«, hakte ich erneut nach. Dieses Mal ließ ich es zu, dass Francis nach meiner Hand griff und sie sanft drückte.
»Das Erbe, das Ihnen durch das Testament versprochen wurde, gibt es nicht mehr. Es ist alles aufgebraucht.« Bedauernd verzog der Notar den Mund, stapelte das Papier und verstaute es in seiner schwarzen Tasche.
»Es ist alles weg?«, hauchte ich. »Selbst das Vermögen meines verstorbenen Großvaters … alles wurde ausgegeben?« Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Mein Leben kam mir wie ein schlechtes Theaterstück vor.
»Es tut mir sehr leid«, meinte der Notar. »Und ich wünsche Ihnen von Herzen nur das Beste.«
Das war es also, was ich bekam? Von Herzen nur das Beste? Was sollte mir das nutzen, wenn ich kein Zuhause mehr hatte und niemanden, der sich um mich kümmerte?
Ich schluckte schwer, als ich erkannte, dass ich einen weiteren Schlag zu verkraften hatte. Nicht nur meine Familie war mir genommen worden, sondern auch mein vermeintliches Erbe. Ich stand mit leeren Händen da.
Eine tiefe Panik ergriff von mir Besitz, die mir den Atem raubte. Japsend rang ich nach Luft; Francis’ Griff um meine Hand wurde fester.
»Es gibt bestimmt eine Lösung«, versicherte mein Freund mir. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er den Notar ernst ansah, der seinen Blick betrübt erwiderte. »Ich habe Mister Cunningham stets als gut organisierten Geschäftsmann erlebt. Er hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er über seine Verhältnisse gelebt hat.« Francis’ Stimme war ruhig und trug dazu bei, dass ich mich ein kleines bisschen besser fühlte. »Es liegt sicherlich ein Fehler vor«, meinte er, woraufhin Mister Jameson den Kopf schüttelte.
Er zwirbelte an seinem Schnurrbart und räusperte sich. »Das Problem ist nicht bei Mister Cunningham zu finden«, begann er, »sondern eher bei seiner Frau. Es ist kein Geheimnis, dass Mistress Violet Cunningham den schönen Dingen des Lebens ein wenig zu sehr zugeneigt war.« Verlegen hüstelte er und ich erlangte endlich die Kontrolle über meinen Körper zurück.
»Wagen Sie es nicht, meine Mutter zu beleidigen!«, fuhr ich den Notar an und ballte unwillkürlich die Hand zur Faust. »Sie haben kein Recht, über ihren Lebensstil zu urteilen!«
Bevor ich mich weiter ereifern konnte, hob Mister Jameson die Hand und brachte mich zum Schweigen. »Ich erlaube mir kein Urteil, Lauren, ganz im Gegenteil. Ich wollte Ihnen nur die Tatsachen offenlegen und das habe ich getan.«
Er wischte sich den Staub von der grauen Stoffhose. Ohne einen weiteren Kommentar erhob er sich und ging zur Garderobe, an der sein Mantel hing. Er warf mir und Francis einen langen Blick zu, dann verschwand er.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es war, als hätten sich alle Worte so tief in mir vergraben, dass ich keinen Zugriff auf sie besaß. Sprachlos starrte ich Francis an, der nervös an seinen Fingern herumspielte. Er sah genauso fassungslos aus, wie ich mich fühlte.
»Wann wache ich aus diesem schrecklichen Traum auf?«, stammelte ich, schüttelte den Kopf und vergrub das Gesicht in meinen Händen. »Heute habe ich erfahren, dass mein Vater kein Geld mehr hatte. Was wird morgen geschehen?« Meine Stimme klang dumpf.
Das Nächste, was ich spürte, war Francis’ Hand, die über meinen Rücken strich.
»Ich finde eine Lösung, Lauren. Das verspreche ich dir.«
»Wie willst du das schaffen?« Ich richtete mich auf und sah ihn aus verweinten Augen an. »Hast du Mister Jameson nicht gehört? Das ganze Geld ist weg. Es ist nichts mehr für mich übrig.«
Der Inhalt meiner Worte förderte eine weitere Wahrheit zutage: Hätte ich doch nur auf meine Eltern gehört und mich beizeiten um einen Ehemann gekümmert! Auch wenn er nicht die Liebe meines Lebens gewesen wäre – falls es so etwas überhaupt gab –, würde ich nun zumindest nicht in einem staubigen Zimmer übernachten, das mir nicht einmal gehörte.
»Es gibt immer eine Lösung«, versuchte Francis, mich aufzumuntern.
»Es ist lieb von dir, dass du mir helfen möchtest«, schluchzte ich. »Aber du kannst nichts tun.«
Und dennoch hoffte ein Teil von mir, dass es etwas gab, an das ich nicht dachte. Wieso hatten meine Eltern mich nie über unsere finanzielle Situation aufgeklärt? Es hätte geholfen und mich auf diesen Moment vorbereiten können.