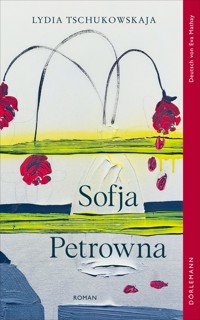
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Sohn Kolya ist Sofja Petrownas ganzer Stolz. Der Ingenieurstudent und überzeugte Kommunist steht am Beginn einer aussichtsreichen Karriere und wurde sogar auf der Titelseite der offiziellen Zeitschrift der Kommunistischen Partei abgebildet. Doch plötzlich ist die Rede von Verrat und nicht nur Sofjas Mitarbeiter beginnen im Zuge der Großen Säuberung zu verschwinden, auch ihr Sohn wird festgenommen. Während sie im bürokratischen Labyrinth der Sovjetunion verzweifelt, flüchtet sie sich in Fantasien von Kolyas Rückkehr. Mit einem Brief von ihrem Sohn kommt auch in Sofja wieder Hoffnung auf und sie stürzt sich ein letztes Mal in den Kampf um seine Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lydia Tschukowskaja
Sofja Petrowna
Roman
Aus dem Russischen von Eva Mathay
Dörlemann
Geleitwort der Verfasserin
Die Erzählung, die hiermit der Aufmerksamkeit der Leser empfohlen wird, ist vor zweiundzwanzig Jahren[1], im Winter 1939/40, in Leningrad entstanden. Ich habe darin versucht, die gerade erst von meinem Vaterland, meinen Nächsten und mir durchlebten Ereignisse festzuhalten. Nicht schreiben konnte ich nicht, aber ich hatte selbstverständlich keinerlei Hoffnung, meine Erzählung je gedruckt zu sehen. Ich wagte nicht einmal zu hoffen, dass das Schulheft, das meine Erzählung in Reinschrift enthielt, der Vernichtung entgehen und erhalten bleiben würde. Es war gefährlich, es in einem Fach meines Schreibtisches aufzubewahren; aber ich konnte mich nicht dazu entschließen, es zu verbrennen. Ich betrachtete meine Aufzeichnungen nicht so sehr als Erzählung denn als Zeugenaussage, die zu vernichten nicht zu verantworten gewesen wäre.
Der Krieg brach aus. Die Leningrader Blockade begann und ging vorüber. Die Leute, die das Heft aufbewahrt hatten, kamen ums Leben, aber es war erhalten geblieben. Da ich Leningrad einen Monat vor Kriegsbeginn verlassen hatte, verlebte ich die Jahre 1941 bis 1944 fern von meiner Heimatstadt, und erst bei Kriegsende kam mein Heft nach langer Trennung wie durch ein Wunder zu mir zurück.
Der Krieg war zu Ende. Stalin starb. Immer häufiger regte sich in mir die bisher unerfüllbar scheinende Hoffnung, dass eine Zeit kommen würde, da meine Erzählung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte.
Nachdem von der Tribüne des XX. und des XXII. Parteikongresses herab Worte ausgesprochen worden waren, die das Bild der Gegenwart erneuerten und die dunklen Seiten der Vergangenheit enthüllten, hatte ich mehr denn je den Wunsch, dass meine Erzählung vielen bekannt werde und damit der Sache diene, die ich für lebenswichtig halte: Für die Zukunft zur Klärung von Ursache und Wirkung der vom Volk durchlebten Tragödie beizutragen.
Ich zweifle nicht daran, dass die Literatur sich noch mehr als einmal der Schilderung der dreißiger Jahre zuwenden wird und Schriftsteller, die über eine weitaus größere Fülle von Tatsachen verfügen als ich damals, die eine größere Begabung für die Analyse und die Verallgemeinerung und eine größere künstlerische Gestaltungsgabe besitzen, das Bild dieser Epoche vollständiger und vielseitiger darstellen werden. Ich dagegen habe nach besten Kräften nur das zu schildern versucht, was ich selbst beobachtet habe.
Aber bei allen denkbaren Vorzügen werden spätere Erzählungen und Novellen doch schon in einer anderen Zeit geschrieben sein, Jahrzehnte nach 1937. Meine Erzählung hingegen nahm unter dem lebendigen Eindruck der eben erst geschehenen Ereignisse Gestalt an. Das wird sie von all den Werken, die den Jahren 1937/38 gewidmet sein werden, abheben, wann immer sie auch erscheinen mögen. Darin sehe ich ihre Berechtigung, die Aufmerksamkeit des Lesers anzusprechen.
Aus diesem Grunde nehme ich keinerlei Änderungen vor; ich habe lediglich eine nicht zur Sache gehörende Einleitung weggelassen. Mein Bericht möge wie eine Stimme aus der Vergangenheit klingen, wie die Aussage eines Augenzeugen, der gewissenhaft versucht, trotz der ungeheuren Verstümmelung der Wahrheit klar zu sehen und das aufzuzeichnen, was sich in seiner Gegenwart abgespielt hat.
Lydia Tschukowskaja
1
Nach dem Tode ihres Mannes besuchte Sofja Petrowna einen Schreibmaschinenkurs. Sie war gezwungen, einen Beruf zu ergreifen, denn Kolja würde wohl noch nicht so bald in der Lage sein, Geld zu verdienen. Nach Beendigung der Schule musste er, koste es, was es wolle, die Aufnahmeprüfung der Universität ablegen. Fjodor Iwanowitsch hätte es niemals zugelassen, dass sein Sohn ohne Hochschulbildung bliebe.
Das Maschineschreiben machte Sofja Petrowna keinerlei Schwierigkeit, und darüber hinaus war ihre Allgemeinbildung weit besser als die der jungen Mädchen von heute. So fand sie als hochqualifizierte Schreibkraft bald einen Arbeitsplatz in einem der großen Leningrader Verlagshäuser.
Das Berufsleben fesselte Sofja Petrowna ungemein. Nach einem Monat schon konnte sie nicht mehr begreifen, wie sie früher ohne Beruf hatte leben können. Zwar fiel es ihr nicht immer leicht, morgens in der Kälte und bei künstlichem Licht aufzustehen, und sie fröstelte, wenn sie inmitten unausgeschlafener, mürrischer Menschen auf die Straßenbahn wartete. Auch schmerzte ihr Kopf zuweilen gegen Feierabend vom langen Geklapper der Schreibmaschinen; doch all dies wurde durch ihre Begeisterung für die Büroarbeit aufgewogen. Wie sie schon als Mädchen gern das Lyzeum besuchte und weinte, wenn sie wegen einer Erkältung zu Hause bleiben musste, so entwickelte sie jetzt eine Vorliebe für das Büro.
Ihr Interesse und ihr Eifer, ihre freundliche und zurückhaltende Art fanden bald die Anerkennung ihrer Vorgesetzten; sie ernannten Sofja Petrowna zur Ersten Stenotypistin und damit zur Leiterin des Schreibbüros. Es befriedigte sie nun natürlich noch mehr, anstatt wie bisher Maschine schreiben zu müssen, fortan die Arbeit verteilen zu können, Seiten und Zeilen abzählen und Schriftstücke zusammenstellen zu dürfen. Wenn sie auf Klopfen den hölzernen Empfangsschalter öffnete, übernahm sie ohne viele Worte, doch verbindlich und sachkundig die Papiere; es waren Rechnungen, Pläne, Rechenschaftsberichte, amtliche Schreiben, Dienstanweisungen und manchmal auch das Manuskript eines zeitgenössischen Schriftstellers.
»In fünfundzwanzig Minuten ist es fertig«, bemerkte Sofja Petrowna gewöhnlich mit einem Blick auf die große Uhr. »Auf die Sekunde!«
Und wenn jemand einzuwenden versuchte, es sei dringend, unterbrach sie ihn mitten im Wort:
»Nein, in genau fünfundzwanzig Minuten, nicht eher!« Mit dieser Erklärung schloss sie gewöhnlich den Schalter, ohne sich auf weitere Gespräche einzulassen.
Nach kurzer Überlegung gab sie die Arbeit dann derjenigen Stenotypistin, die ihr hierfür am geeignetsten erschien. Kam die Sekretärin des Direktors mit einem Schreibauftrag, so betraute sie damit die schnellste, sachkundigste und gewissenhafteste Kollegin.
Wenn sie sich in jüngeren Jahren ab und zu gelangweilt hatte, wenn Fjodor Iwanowitsch – er war Arzt und hatte einen großen Patientenkreis – für längere Zeit zu Krankenbesuchen unterwegs war, hatte sie von einem eigenen Schneideratelier geträumt: Sie sah sich selbst in einem großen hellen Raum, wie sie den netten jungen Mädchen, die sich geschäftig über wallende Wogen von Seide beugten, neue Modelle zeigte oder elegante Damen bei der Anprobe mit mondänem Geplauder unterhielt.
Doch das Schreibbüro war vielleicht noch besser, irgendwie bedeutender. Sofja Petrowna fiel jetzt wiederholt die Aufgabe zu, als Erste ein neues Werk der Sowjetliteratur – eine Erzählung oder einen Roman – noch im Manuskript zu lesen. Obwohl die sowjetischen Romane und Erzählungen sie irgendwie langweilten, weil darin so viel von Traktoren, Werkabteilungen und Kämpfen, aber kaum von Liebe die Rede war, fühlte Sofja Petrowna sich doch geschmeichelt.
Sie begann ihre früh ergrauten Haare aufzudrehen, und damit sie nicht gelb wurden, fügte sie bei der Haarwäsche dem Wasser ein wenig Waschblau hinzu. In ihrem einfachen schwarzen Kittel, den sie mit einem Kragen aus echter alter Spitze herausputzte, mit einem gespitzten Bleistift in der Brusttasche kam sie sich sachlich, korrekt und doch elegant vor.
Die Stenotypistinnen fürchteten sich ein wenig vor ihr und nannten sie hinter ihrem Rücken »Klassenaufseherin«, aber sie gehorchten ihr. Sofja Petrowna wollte streng, aber gerecht sein. In der Arbeitspause unterhielt sie sich wohlwollend mit denjenigen unter ihnen, die sorgfältig und fehlerlos schrieben, sprach über die unleserliche Handschrift des Direktors und darüber, dass das Schminken durchaus nicht jeder stehe; aber diejenigen, die »Resoluzion« und »Kollektif« schrieben, behandelte sie etwas von oben herab.
Eine der Stenotypistinnen, Erna Semjonowna, ging Sofja Petrowna sehr auf die Nerven: Beinahe in jedem Wort machte sie Fehler, rauchte hemmungslos und schwatzte während der Arbeit. Erna Semjonowna erinnerte Sofja Petrowna dunkel an ein unverschämtes Dienstmädchen, das früher einmal bei ihnen gearbeitet hatte. Das Dienstmädchen hieß Fanny, es war frech zu Sofja Petrowna und kokettierte mit Fjodor Iwanowitsch … Warum nur behält man so eine?
Mehr als alle anderen Stenotypistinnen im Büro gefiel Sofja Petrowna Natascha Frolenko, ein bescheidenes, hässliches Mädchen mit grünlich grauer Gesichtsfarbe. Sie schrieb stets fehlerfrei, Rändereinstellung und Absatzeinteilung wirkten bei ihr erstaunlich kunstvoll. Wenn man ihre Arbeit betrachtete, so hatte man den Eindruck, sie sei auf irgendeinem besonderen Papier geschrieben und ihre Maschine sei wahrscheinlich besser als die anderen; in Wirklichkeit aber waren sowohl Nataschas Papier als auch ihre Schreibmaschine von ganz gewöhnlicher Art, und das ganze Geheimnis, so unglaublich es auch klingen mag, bestand tatsächlich nur in ihrer Sorgfalt.
Das Schreibbüro war mit dem übrigen Verlagsgebäude durch eine Tür mit einem eingebauten Schalter verbunden, der durch ein hölzernes braun lackiertes Schiebefenster zu verschließen war. Die Tür war ständig verschlossen, Gespräche wurden durch das Schiebefenster geführt.
In der ersten Zeit kannte Sofja Petrowna niemanden im Verlag außer ihren Stenotypistinnen und einer Botin, die die Schriftstücke verteilte; aber nach und nach wurde sie mit allen bekannt.
Es waren etwa zwei Wochen vergangen, als der korpulente, trotz seiner Kahlköpfigkeit jugendlich wirkende Buchhalter sie bereits im Korridor ansprach; wie sich herausstellte, hatte er Sofja Petrowna wiedererkannt – einst, vor etwa zwanzig Jahren, hatte ihn Fjodor Iwanowitsch erfolgreich behandelt. Der Buchhalter schwärmte für Wassersport und westeuropäische Tänze, und Sofja Petrowna fühlte sich geschmeichelt, als er ihr vorschlug, sich seiner Tanzgruppe anzuschließen.
Die höfliche ältliche Sekretärin des Direktors begann sie ebenfalls zu grüßen. Der Leiter der Personalabteilung ehrte sie mit einer Verbeugung, ebenso wie ein gut aussehender bekannter Schriftsteller mit graumeliertem Haar, der, eine mit Monogramm versehene Aktentasche unter dem Arm und eine Bibermütze auf dem Kopf, im eigenen Wagen zum Verlag kam.
Der Schriftsteller fragte sie sogar einmal, wie ihr das letzte Kapitel seines Romans gefallen habe. »Wir Literaten haben schon lange gemerkt, dass die Schreibdamen die unparteiischsten Schiedsrichter sind. Wirklich«, sagte er und zeigte beim Lächeln sehr ebenmäßige falsche Zähne, »sie urteilen unbefangen und werden nicht durch vorgefasste Meinungen beeinflusst wie die Genossen Kritiker oder Redakteure.«
Sofja Petrowna machte auch die Bekanntschaft des Parteiobmanns Timofejew, eines hinkenden, ungepflegten Menschen. Er war mürrisch, blickte beim Sprechen auf den Fußboden und flößte Sofja Petrowna etwas Angst ein. Bisweilen rief er Erna Semjonowna zum Schalter – er war dann in Begleitung des Verwalters –, Sofja Petrowna schloss die Tür auf, und der Verwalter trug Erna Semjonownas Schreibmaschine aus dem Büro in die »Spezialabteilung«. Erna Semjonowna folgte stolz erhobenen Hauptes ihrer Maschine. Sie war, so erklärte man Sofja Petrowna, »geheimermächtigt«, und der Parteiobmann berief sie in die Spezialabteilung, wo sie streng vertrauliche Parteiakten abzuschreiben hatte.
Nach kurzer Zeit schon kannte Sofja Petrowna alle im Verlag persönlich, mit ihren Familiennamen und ihrer Tätigkeit: die Rechnungsführer, Redakteure, technischen Redakteure und Botinnen.
Gegen Ende des ersten Monats ihrer Berufstätigkeit lernte Sofja Petrowna den Direktor kennen. In seinem Arbeitszimmer lag ein flauschiger Teppich, um den Tisch herum standen tiefe, weiche Sessel und auf dem Schreibtisch nicht weniger als drei Telefone. Der Direktor erwies sich als ein junger Mann von nicht mehr als fünfunddreißig Jahren, er war stattlich, sorgfältig rasiert, trug einen eleganten grauen Anzug mit drei Abzeichen am Rockaufschlag und hielt einen Füllfederhalter in der Hand. Etwa zwei Minuten unterhielt er sich mit Sofja Petrowna, aber in der kurzen Zeit klingelte dreimal das Telefon, und er sprach in das eine, während er den Hörer des anderen abnahm. Der Direktor rückte ihr eigenhändig einen Sessel heran und fragte höflich, ob sie nicht so freundlich sein könnte, heute Abend Überstunden zu machen. Sie solle selbst eine Stenotypistin bestimmen und ihr den Bericht diktieren. »Ich habe gehört, dass Sie meine barbarische Handschrift wunderbar entziffern können«, sagte er lächelnd.
Sofja Petrowna verließ das Arbeitszimmer des Direktors, beeindruckt von seiner Stellung und geschmeichelt durch das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Ein wohlerzogener junger Mann! Man erzählte von ihm, er sei vom einfachen Arbeiter bis zu dieser leitenden Stellung aufgestiegen; tatsächlich erschienen seine Hände klobig, aber sonst …
Die erste Generalversammlung der Verlagsangestellten, an der Sofja Petrowna Gelegenheit hatte teilzunehmen, erschien ihr langweilig. Der Direktor hielt eine kurze Rede über die Machtergreifung der Nazis und den Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin[2], worauf er den Verlag in seinem Ford verließ. Nach ihm sprach der Parteiobmann, Genosse Timofejew, dessen lange Pausen zwischen einzelnen Sätzen vermuten ließen, seine Ausführungen seien beendet. Dann sprach die Vorsitzende des Gewerkschaftskomitees, eine vollbusige Dame mit einer Kamee an der Brust. Während sie an ihren langen Fingern rieb und drehte, verkündete sie, dass es in Anbetracht alles Vorhergegangenen in erster Linie notwendig sei, das Tagessoll zu erhöhen und der Unpünktlichkeit erbarmungslos den Kampf anzusagen. Abschließend machte sie mit hysterisch klingender Stimme eine Mitteilung über Thälmann[3] und schlug allen Angestellten vor, der I.R.H.[4] beizutreten. Sofja Petrowna fiel es schwer, den Ausführungen zu folgen, sie langweilte sich und wollte fortgehen, aber sie fürchtete, dass sich das nicht gehöre, und blickte streng auf eine Stenotypistin, die sich davonstehlen wollte.
Doch allmählich begannen auch die Versammlungen Sofja Petrownas Interesse zu wecken. Auf einer dieser Versammlungen betonte der Direktor in einer Rede über die Planerfüllung, die hohen Produktionsziffern, die man unbedingt erreichen müsse, hingen von der verantwortungsbewussten Arbeitsdisziplin eines jeden Mitglieds des Kollektivs ab, und zwar nicht nur von dem Pflichtbewusstsein der Redakteure und Autoren, sondern auch von dem der Putzfrau, der Botin und jeder Schreibkraft. »Im Übrigen«, stellte er fest, »muss man anerkennen, dass das Schreibbüro unter der Leitung der Genossin Lipatowa gegenwärtig mit außergewöhnlicher Sorgfalt arbeitet.«
Sofja Petrowna errötete und wagte lange nicht, den Blick zu erheben. Als sie schließlich aufblickte, erschien ihr ihre Umgebung in verklärtem Licht, und sie verfolgte die Zahlen mit plötzlichem Interesse.
2
Alle ihre Mußestunden verbrachte Sofja Petrowna jetzt mit Natascha Frolenko.
Doch ihre freie Zeit wurde allmählich immer knapper. Überstunden, aber noch häufiger Sitzungen des Gewerkschaftskomitees, in das man Sofja Petrowna bald hineingewählt hatte, nahmen fast alle ihre Abende in Anspruch. Kolja musste sich immer häufiger sein Abendessen selbst aufwärmen und nannte Sofja Petrowna im Scherz »Aktivistenmama«.
Das Gewerkschaftskomitee hatte sie beauftragt, die Beiträge einzukassieren. Sofja Petrowna dachte kaum darüber nach, wozu eigentlich eine Gewerkschaft existiere, aber es befriedigte sie, die Papierbögen zu liniieren und in den einzelnen Spalten zu vermerken, wer schon für den laufenden Monat bezahlt hatte und wer nicht; es machte ihr Freude, die Marken aufzukleben und einwandfreie Abrechnungen an den Prüfungsausschuss abzuliefern. Es verschaffte ihr eine gewisse Genugtuung, jederzeit die geheiligten Räume des Direktors betreten zu können, um ihn scherzhaft an seinen viermonatigen Beitragsrückstand zu erinnern, worauf er sich zum Spaß bei den geduldigen Genossen aus dem Gewerkschaftskomitee entschuldigte, seine Brieftasche zog und bezahlte. Sogar den mürrischen Parteiobmann konnte sie ohne jedes Risiko an seine Schulden erinnern.
Am Ende des ersten Jahres ihrer Berufstätigkeit geschah etwas Außergewöhnliches in Sofja Petrownas Leben. Sie sollte auf der Generalversammlung der Angestellten im Namen aller parteilosen Mitarbeiter des Verlages sprechen.
Und das war so gekommen: Im Verlag erwartete man die Ankunft einiger leitender Genossen aus Moskau. Der Verwalter, ein wendiger junger Mann mit scharfgezogenem Scheitel, eilte tagelang durch das Verlagsgebäude, schleppte selbst auf seinem Rücken irgendwelche Rahmen umher und ließ im ungeeignetsten Augenblick das Schreibbüro bohnern. Inmitten dieser Betriebsamkeit trat der mürrische Parteiobmann im Korridor an Sofja Petrowna heran. »Die Parteiorganisation, in Übereinstimmung mit dem Gewerkschaftskomitee«, sagte er, indem er wie gewöhnlich zu Boden sah, »hat dich« – er verbesserte sich – »Sie dazu ausersehen, im Namen der parteilosen Aktivisten die feierliche Verpflichtung zu sprechen.«
Bis zur Ankunft der Moskauer Gäste gab es eine Menge Arbeit. Das Büro schrieb fortwährend irgendwelche Rechenschaftsberichte und Pläne. Beinahe jeden Abend machten Sofja Petrowna und Natascha Überstunden. Die Schreibmaschinen klapperten hohl in dem leeren Raum. Ringsum in den Korridoren und in den übrigen Arbeitsräumen war es dunkel.
Sofja Petrowna liebte diese Abende. Wenn die Arbeit getan war, blieben sie beide noch einige Zeit an ihren Schreibmaschinen sitzen und unterhielten sich, bevor sie aus dem hellen Raum in das Dunkel des Korridors hinaustraten. Natascha sprach wenig, verstand aber sehr gut zuzuhören.
»Haben Sie bemerkt, dass Anna Grigorjewna – die Vorsitzende des Gewerkschaftskomitees – immer schmutzige Fingernägel hat?«, fragte Sofja Petrowna. »Und dabei trägt sie diesen auffallenden Schmuck und dreht sich die Haare ein. Sie sollte lieber ihre Hände etwas gründlicher waschen. Erna Semjonowna geht mir entsetzlich auf die Nerven, sie ist so überheblich. Und ist Ihnen aufgefallen, Natascha, dass Anna Grigorjewna sich immer so ironisch über den Parteiobmann äußert? Sie mag ihn nicht …«
War dieses Thema erschöpft, sprach Sofja Petrowna über ihre Liebe zu Fjodor Iwanowitsch oder davon, wie Kolja im Alter von sechs Monaten unter einen Zuber fiel. Und was für ein hübsches Kind er war, auf der Straße drehten sich alle Leute nach ihm um. Sie kleideten ihn damals ganz in Weiß: weißes Mäntelchen und weißes Mützchen.
Natascha hatte eigentlich gar nichts zu erzählen, nicht eine einzige Liebesgeschichte. Kein Wunder bei solch einer Gesichtsfarbe, dachte Sofja Petrowna. In Nataschas Leben gab es nur Unerfreuliches. Ihr Vater, ein Oberst der zaristischen Armee, war im Jahre 1917 an einem Herzschlag gestorben, als Natascha gerade fünf Jahre alt war. Ihr Haus wurde beschlagnahmt, und sie waren gezwungen, zu einer gelähmten Verwandten zu ziehen. Ihre Mutter war eine verwöhnte, hilflose Frau, sie hungerten schrecklich, und Natascha musste schon seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr ins Büro gehen. Vor zwei Jahren war ihre Mutter an Tuberkulose gestorben, während die Verwandte an Altersschwäche verschieden war, sodass Natascha allein in der Welt stand. Sie sympathisierte mit dem Sowjetregime, aber als sie sich um Aufnahme in den Kommunistischen Jugendverband bewarb, nahm man sie nicht an.
»Sie müssen bedenken, mein Vater war Oberst und Hausbesitzer, und man glaubt mir nicht, dass meine positive politische Einstellung ehrlich ist«, sagte Natascha mit nervösem Augenzwinkern. »Vom marxistischen Standpunkt aus gesehen ist das vielleicht sogar richtig.«
Bei der Schilderung dieser Absage röteten sich fast immer ihre Augenlider, und Sofja Petrowna lenkte dann das Gespräch hastig auf ein anderes Thema.
Endlich war der große Tag gekommen. Lenins und Stalins Porträts bekamen neue Rahmen, die der Verwalter eigenhändig herbeigeschafft hatte, der Schreibtisch des Direktors war mit rotem Tuch verkleidet. Die Moskauer Gäste, zwei wohlbeleibte Herren in ausländischen Anzügen, ausländischen Krawatten und mit ausländischen Füllfederhaltern in der Brusttasche, saßen neben dem Direktor am Tisch unter den Porträts und zogen Akten aus ihren prall gefüllten ausländischen Aktentaschen. Der Parteiobmann, in Russenhemd und Jacke, wirkte daneben recht unscheinbar. Der wendige Verwalter und die Fahrstuhlführerin Marja Iwanowna trugen unablässig Tabletts mit Tee, belegten Broten und Obst herein, boten sie den Gästen und dem Direktor und dann erst den übrigen Teilnehmern an.
Sofja Petrowna war vor Erregung nicht imstande, den Reden zu folgen. Wie gebannt, ohne den Blick losreißen zu können, starrte sie auf das sich leicht bewegende Wasser in der Karaffe. Auf ein Wort des Vorsitzenden näherte sie sich dem Direktionstisch, wandte sich zuerst dem Direktor und den Gästen, dann den übrigen Anwesenden zu, stellte sich schließlich etwas seitlich und faltete die Hände in Taillenhöhe[5], wie man es ihr, als sie noch ein Kind war, beigebracht hatte, wenn sie französische Glückwunschverse aufsagen musste.
»Im Namen der parteilosen Mitarbeiter …«, begann sie mit unsicherer Stimme, und dann gelobte sie, zur Steigerung der Arbeitsleistung beizutragen, und führte all das aus, was sie gemeinsam mit Natascha aufgesetzt und auswendig gelernt hatte.
Nach Hause zurückgekehrt, ging sie noch lange nicht zu Bett. Sie wartete auf Kolja, um ihm von der Versammlung zu berichten. Kolja legte gerade seine letzten Schulprüfungen ab und verbrachte alle Abende bei seinem besten Schulkameraden, Alik Finkelstein, mit dem er gemeinsam lernte.
Sofja Petrowna räumte inzwischen das Zimmer etwas auf und ging in die Küche, um ihren Primuskocher anzuzünden.
»Wie schade, dass Sie nicht berufstätig sind«, sagte sie zu der gutmütigen Frau des Polizisten, die in derselben Wohnung lebte und gerade Geschirr abwusch. »Die verschiedenen Eindrücke geben einem so viel fürs Leben, besonders wenn die Tätigkeit in Beziehung zur Literatur steht.«
Endlich erschien Kolja, hungrig und durchnässt vom ersten Frühlingsregen. Sofja Petrowna setzte ihm einen Teller mit Kohlsuppe vor. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, sah sie Kolja, der ihr gegenübersaß, beim Essen zu und wollte ihm gerade von ihrem heutigen Auftreten berichten, als er ihr zuvorkam.
»Weißt du, Mama«, sagte er voller Stolz, »ich bin jetzt Jungkommunist, heute hat das Komsomolzenbüro meine Aufnahme bestätigt.«
Er stopfte sich den Mund mit Brot voll und platzte gleich darauf mit einer anderen Neuigkeit heraus:
»In der Schule hat es einen Skandal gegeben. Saschka Jarzew, dieser reaktionäre Idiot …«
»Kolja, ich mag es nicht, wenn du so grobe Ausdrücke gebrauchst«, unterbrach ihn Sofja Petrowna.
»Aber das ist doch jetzt gar nicht wichtig! Saschka Jarzew hat Alik Finkelstein ›dreckiger Jude‹ geschimpft. Wir haben heute in der Komsomolzelle beschlossen, ein Kameradengericht zur Warnung abzuhalten. Weißt du, wen sie zum öffentlichen Ankläger bestimmt haben? Mich!«
Nach dem Abendessen ging Kolja sofort schlafen, und auch Sofja Petrowna zog sich in ihre Schlafecke zurück. Im Dunkeln rezitierte ihr Kolja auswendig Verse von Majakowski.
»Ist das nicht genial, Mama?«, fragte er.
Und erst als er geendet hatte, kam Sofja Petrowna dazu, ihm von der Versammlung zu berichten.
»Du bist ein Prachtkerl, Mama«, sagte Kolja und schlief sofort ein.
3
Kolja hatte die Schule beendet; ein drückender Sommer war angebrochen, aber für Sofja Petrowna gab es noch immer keinen Urlaub. Sie erhielt ihn erst gegen Ende Juli. Bestimmte Reisepläne hatte sie nicht, vielmehr malte sie sich den ganzen Juli über sehnsüchtig aus, wie sie morgens ausschlafen und dann endlich einmal alle Hausarbeit erledigen könnte, für die sie durch ihre Berufstätigkeit nie Zeit fand. Sie träumte davon, sich von dem Hämmern der Schreibmaschinen zu erholen, den Maler zu bestellen, um die Tür neu streichen zu lassen, einen Übergangsmantel für Kolja zu kaufen und seine Socken zu stopfen und auf jeden Fall das Grab ihres Mannes auf dem Friedhof zu besuchen.





























