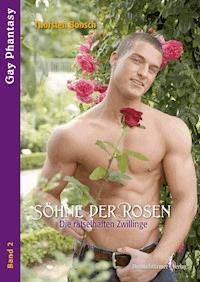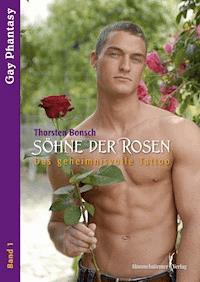
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julian Grifter wird direkt nach seinem Abschluss an der Highschool durch die Versetzung seines Vaters dazu gezwungen, seine Heimat in Nampa, Idaho zu verlassen und mit seinen Eltern nach Cape Orchid, California zu ziehen. In dem kleinen Ort an der Küste lernt er Alain Blanchard kennen, den Sohn seiner neuen Nachbarn, der scheinbar die meiste Zeit allein in der geheimnisumwitterten, alten Villa lebt. Julian verliebt sich in seinen neugewonnenen, seltsamen Freund, immer darauf bedacht, das langgehütete Geheimnis seiner Homosexualität nicht preis zu geben. Trotz vieler versteckter Andeutungen von Alain und den gemeinsamen, teilweise sehr intimen, sportlichen Aktivitäten, bleibt Julian unsicher, ob seine Gefühle erwidert werden. Weitere Rätsel geben Alains tätowierte Rosenranke auf, die nach jeder Begegnung der Jungen ein Stück größer wird. Und warum fühlt sich Julian - besonders Nachts - ständig beobachtet? Während sich unheimliche Geschichten um die Villa ranken, spitzt sich die heimische Situation zwischen ihm, seinem militanten Vater und seiner verständnisvollen Mutter unaufhaltsam zu, bis es zu einer lebensbedrohlichen Katastrophe kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Himmelstürmer Verlag, part of Production House GmbH
Kirchenweg 12, 20099 Hamburg
E-mail: [email protected]
www.himmelstuermer.de
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer, AGD, Hamburg
www.olafwelling.de
Coverfoto:© C.Schmidt www.CSArtPhoto.de
Das Model auf dem Coverfoto steht in keinen Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches und der Inhalt des Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Models aus.
2. Auflage, September 2008
E-book Auflage: August 2012
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
ISBN print: 978-3-934825-74-1
ISBN E-pub: 978-3-86361-251-1
ISBN pdf: 978-3-86361-252-8
Thorsten Bonsch
Söhne der Rosen
Ein schwuler Fantasy Roman
für Marco Canetto
Danke für die Gegenwart, in der ich das gebraucht habe, was du mir gegeben hast.
und für Sven Minne
Danke für die Vergangenheit, die ich heute noch hüte, wie einen einzigartigen Schatz.
1
Ich erinnere mich noch sehr genau, es war im Frühsommer 1997 als meine Eltern und ich nach Cape Orchid gezogen waren. Kurz nach meinem neunzehnten Geburtstag. Damals hatte Zeit noch eine Bedeutung.
Mein Vater hatte einen Versetzungsbefehl erhalten und nach seinen Aussagen war eine Weigerung unmöglich. Befehl ist Befehl – das war sein Standardsatz. Und was sein Vaterland ihm abverlangte, das übertrug er mit uneingeschränkter Selbstverständlichkeit auf seine Familie. Weder meine Mum noch ich hätten es jemals gewagt, etwas gegen die Versetzung zu sagen oder sie auch nur in Frage zu stellen. Schließlich war er General Ernest W. Grifter, im Dienst und im Privatleben.
Nachdem mein Vater uns von der Versetzung erzählt hatte, hatte meine Mum nachts in unserer spärlich beleuchteten Küche gesessen und leise geweint. Ich hatte sie gehört, weil ich selber nicht schlafen konnte. Der General hatte es zu unserem Glück nicht mitbekommen, er verfügte immer über einen kurzen, aber tiefen Schlaf. Im Gegensatz zu ihm hieß für uns sein Befehl, eine Menge Dinge und Menschen zurückzulassen, die uns viel bedeutet hatten. Meine Mum war Vorsitzende im Komitee zur Hilfe AIDS-infizierter Kinder, Mitglied bei dem M.H.S.Y.C. und sie traf sich jeden Mittwochabend mit ihren Freundinnen zum Pokern. Ich war zwar durch keine Vereine gebunden – dafür bin ich zu introvertiert – aber ich musste einige wirklich gute Freunde zurücklassen, deren Freundschaft bis zu fünfzehn Jahre überdauert hatte. Und ich weiß, dass eine Distanz von vierhundertachtzehn Meilen auch solche Freundschaften zerstören kann.
Trotzdem haben wir es in jener Nacht geschafft, uns gegenseitig ein wenig Trost zu spenden. Wir hielten uns im Arm, trocknende Tränen auf den Wangen, und witzelten über den Grund für die plötzliche Versetzung. Eine der ernsteren Überlegungen meiner Mum war, dass der General vielleicht mit einem frischen Rekruten auf der Männertoilette erwischt worden sei, als er dessen Kopf zur Abhärtung und zum eigenen Besten in der Kloschüssel wusch, und man ihn nun unauffällig abschieben wollte. Er war hart und nie zu Kompromissen bereit. Diese Eigenschaft hatte ihm vergleichsweise schnell den Posten eines Generals inklusive zweier Sterne eingebracht – mit siebenundvierzig Jahren war er jetzt nicht unbedingt einer der jüngsten Generäle in der Geschichte der Army, dafür allerdings einer der härtesten – aber vielleicht war es eben gerade auch diese Eigenschaft, die bestimmten Politikern unter der Regierung von Clinton nicht zusagte. Man konnte ihn nicht einfach kündigen, also ließ man ihn verschwinden, in ein kleines, unbedeutendes Nest.
Der Zeitpunkt hätte nicht ungünstiger sein können. Ich stand vor meinen letzten Abschlussprüfungen in der Highschool, hatte mich auf den Sommer gefreut und im Anschluss daran auf das College statt auf die Militärakademie, die meine Mum in wochenlanger Arbeit und mit Engelszungen meinem Vater ausgeredet hatte. Nicht, weil mir lernen so viel Spaß machte – es fiel mir leicht, aber ich war kein Streber – nein, es war hauptsächlich die Aussicht darauf, mein Elternhaus zu verlassen und auf den Campus zu ziehen. Mir ein eigenes Zimmer mit Chad Tassilo zu teilen, meinem besten Freund seit dem ersten Jahr auf der High, ohne die Zwänge einer familiären Militärdiktatur durch meinen Vater. Einfach frei zu sein und mich irgendwann nicht mehr verstecken zu müssen. Diese Idee hatte lediglich einen winzigen, säuerlichen Beigeschmack:Ichwäre dann raus, aber meine Mum müsste allein mit dem General bleiben. Andererseits würde ich früher oder später sowieso unser Heim verlassen und meine Mum hatte ihn mit ihrer passiven Art Widerstand zu leisten, einigermaßen im Griff. Ghandi hätte seine wahre Freude an ihr gehabt.
Jedenfalls bemühte ich mich um die besten Noten, um meinen Vater gnädig zu stimmen, und war recht erfolgreich damit. Ich hatte mich innerlich sogar schon mit dem technischen Bereich angefreundet, obwohl mir musische Fächer wesentlich besser lagen. Aber mit so etwas hätte ich bei dem General nicht landen können. Wer benötigt schon Poesie in Worten, Tönen oder Bildern im Gefecht? Ein Computerexperte, den man zum Beispiel in Raketentechnik weiterbilden könnte, wäre dort lieber gesehen. Ich tröstete mich mit der Idee, nach einem abgeschlossenen Informatikstudium Mathematik und Kreativität miteinander zu verbinden. Der begnadete Künstler M. C. Escher hatte seinerzeit bewiesen, dass dies möglich ist. Allerdings dachte ich dabei weniger an gezeichnete optische Täuschungen, sondern eher an die Computerspiel- oder Filmindustrie.
3D-Grafik stand momentan hoch im Kurs und bot einen regelrechten Spielplatz für große Kinder wie mich. Nach dem College und dem Studium – da war ich mir sicher – hätte ich ausreichend Abstand zum General, um mich seinem Einfluss gänzlich zu entziehen und meinen eigenen Weg zu gehen.
Meine Mum kannte meine unkonformen Pläne und tröstete mich in jener Nacht damit, dass meine Chancen in einem digitalen und zugleich kreativen Job in Kalifornien sowieso besser standen. Dort, so sagte sie, befänden wir uns in der modernsten Künstlermetropole Amerikas überhaupt. Trotz ihrer persönlichen Verluste schaffte sie es, mir die Vorzüge der neuen Umstände klar zu machen. Ich bewunderte sie für ihre Stärke und Anpassungsfähigkeit.
Die Abschlussfeierlichkeiten an meiner Highschool verliefen mit dem üblichem Prunk, dem Stolz der Eltern derer, die ihr Diplom freudig empfangen durften, der Erleichterung und plötzlichen Kameradschaft der Lehrer, die es fertiggebracht hatten, einen weiteren Jahrgang auf die Menschheit loszulassen und der Ausgelassenheit der Absolventen, die trotz ihrer Ausbildung noch weit davon entfernt waren, zu ahnen, was das schreckliche Leben eines Erwachsenen für sie noch in petto hatte. Dennoch genoss ich die Zeremonie der Zeugnisübergabe, die Ansprache meiner Mitschülerin Lorane Witten, unsere traditionelle Kostümierung und das Hochwerfen unserer quadratischen Kopfbedeckungen, dem Academic Graduation Hat. Und der überschwänglichen Umarmung von Chad, für den ich mehr empfand, als er je in seinem heterosexuellen Leben begreifen würde. Meine Eltern befanden sich unter den zahlreichen Besuchern, meine Mum, elegant aber jugendlich gekleidet wie immer und mein Vater in seiner besten Ausgehuniform. Viele Fotos wurden geschossen, viele Videokameras surrten und freudige Tränen wurden vergossen.
2
Nur vier Wochen später, im Juni, war es soweit. Unser Haus war leer, riesig und kalt, der Abschied tränenreich und kurz. Eine Militärmaschine brachte uns nach Santa Ana, Kalifornien, von wo aus wir weiter über Landstraßen nach Cape Orchid fuhren. Wir hatten gerade das Ortsschild nach einer langen Fahrt des Schweigens passiert, als sich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigten. Cape Orchid war einer der unzähligen Orte an der Westküste, für den es keine Bezeichnung gab. Er war zu klein für eine Stadt und zu groß für ein Dorf. Ein netter kleiner Ort mit langen Alleen, gepflegten Vorgärten, Grillgeruch, flitzenden Eichhörnchen, radfahrenden Zeitungsjungen und einer Haben-Sie-schon-gehört-Mentalität. Zuviel Platz für Tratsch, zu wenig Platz für mich.
Unser Haus befand sich im Südwesten der Stadt, in einer Sackgasse, die in einem Wendeplatz endete. Es schien, als hätten sich Architekten aus aller Welt an Cape Orchid versucht, kaum ein Haus glich im Baustil dem Nachbarhaus. Mein Vater parkte den Wagen vor einem Bungalow in mexikanischer Bauweise, direkt vor dem Umzugswagen der Wasco Moving Company, der wie zur Bestätigung der militärischen Korrektheit meines Vaters fast zeitgleich mit uns eingetroffen war. Meine Mum und ich betrachteten das Haus durch die geschlossenen Fensterscheiben unseres Autos wie ein Wissenschaftler ein Versuchstier, welches das Resultat eines missglückten Gen-Experiments war. Derweil erteilte der General den Leuten von Wasco erste Anweisungen.
„Was meinst du, Julian, ob es uns hier gefallen wird?“
„Ich weiß nicht, Mum. Ich hoffe es.“
„Ich denke, wir haben sowieso keine andere Wahl. Zumindest sieht das Haus doch ganz nett aus. Stell dir mal vor, dein Vater hätte sich das Nachbarhaus ausgesucht.“
Meine Mum deutete auf die zugewachsene, heruntergekommene Villa im spätgotischen Stil rechts neben unserem Bungalow. Sie fiel durch ihre Architektur komplett aus dem Rahmen. Das Grundstück war als einziges von einer wildwuchernden, mannshohen Hecke umschlossen, während alle anderen Vorgärten typischerweise keine Begrenzungen aufwiesen. Und ja, die Villa wirkte verfallen und leer, aber das war nicht alles. In der strahlenden Mittagsonne glänzte sie in einem Zwielicht, wie man es von den seltenen Tagen kennt, an denen trotz dicker Gewitterwolken ein Paar Sonnenstrahlen den Erdboden erreichen und die Regentropfen wie Quecksilber aussehen lassen.
„Wäre auch nicht schlimmer. Es hat doch einen gewissen Charme.“
„Das sagst du. Du musst ja auch nicht alle Fenster putzen. Außerdem wirkt es unheimlich.“
„Finde ich nicht. Es wirkt wie, ... wie ...“
„Wollt ihr hier im Wagen übernachten?“ Mein Vater hatte die Fahrertür aufgerissen und beugte sich zu uns in das Auto. „Es sieht so aus, als können die Schlappschwänze von Wasco Hilfe gebrauchen. Ich will, dass das Haus bis zu meinem Dienstantritt morgen Früh bewohnbar ist, also los, Jul. Zack-Zack.“
Ich hasste es, wenn er so sprach.
In einem Film hätten wir jetzt zu dritt auf dem Bürgersteig vor dem Haus gestanden, Vater in der Mitte, Mum und mich im Arm, auf das Haus geblickt und gesagt, wie schön unser neues Heim ist. Stattdessen ging ich zum Möbelwagen, während meine Eltern das Haus allein betraten. Wenigstens gab es einen kleinen Lichtblick, denn einer der beiden Möbelpacker war ein gutaussehender, junger Latino mit Latzhose, hautengem Unterhemd und einem einnehmenden, blendenden Lächeln, das durch seine dunkle Hautfarbe besonders strahlend wirkte. Zwar wusste ich nicht, ob er schwul war, aber selbst wenn, hätte es keinen Unterschied gemacht. Er würde nach erledigtem Auftrag aus Cape Orchid verschwinden und in eine Stadt zurückkehren, die mit ziemlicher Sicherheit größer und besser war als dieses Nest und in der man sich nicht für seine Neigungen verstecken muss.
Aber er war offen und freundlich, also genoss ich einfach seine Gegenwart und half hauptsächlich ihm beim Entladen und Hereintragen der Möbel, immer darauf bedacht, dass der General nicht misstrauisch wurde.
Ein erstes Mal ist immer einprägsam, vermutlich sogar für den Rest unseres Lebens. Das gilt nicht nur für den ersten Sex, sondern für jedes einschneidende Erlebnis, abgesehen von der eigenen Geburt, dem ersten gesprochenen Wort und ähnlichen Dingen, die in den frühsten Jahren der Kindheit stattfinden; in einer Zeit, in der unser fast noch leeres Gehirn mit wesentlichen und unwichtigen Ereignissen überflutet wird. Aber ich glaube, jeder erinnert sich an seinen ersten Tag in der Elementary- und der Highschool, an das erste Ferienlager, die erste Zigarette und an viele weitere Anfänge.
Ich erinnere mich auf jeden Fall an die erste Nacht in unserem neuen Heim. Innerhalb weniger Stunden nach unserer Ankunft sah das Haus wie eine Baustelle aus. Es gab kaum ein Zimmer, in dem nicht Kisten, riesige Plastiktüten oder beschriftete Kartons zwischen den teils unausgerichteten Möbeln herumstanden. Gegen Abend bestellten wir Pizza für meine Mum und mich und einen Salat für den General. Danach ging es weiter mit dem Auspacken und Einräumen, bis mein Vater um kurz vor Mitternacht entschied, dass sich unser neues Haus in einem prinzipiell bewohnbaren Zustand befand. Diese Feststellung bezog sich zwar nicht auf mein Zimmer im ersten Stock, aber ich war zu erschöpft von der Reise und dem Umzug, um in der Nacht noch etwas daran zu ändern. Ich suchte lediglich den Karton mit meinem Bettzeug, bezog die noch auf dem Boden liegende Matratze und legte mich in dem ganzen Durcheinander schlafen.
Der kleine Bruder des Todes wollte nicht kommen. Unruhig, müde, mürrisch, aber wach, wälzte ich mich von einer Seite auf die andere. Im matten Licht des sichelförmigen Mondes betrachtete ich die verschwommenen dunkelgrauen Umrisse der Einrichtung vor dem schwarzen Hintergrund. Chaos. Dieses Wort beschrieb nicht nur den Zustand meines Zimmers, sondern den meines kompletten Lebens. Gegen meinen Willen arbeitete mein Gehirn auf Hochtouren, fleißig damit beschäftigt, die durch den Umzug entstandenen Verluste durchzugehen. Freunde, Ereignisse, die Sicherheit einer gewohnten Umgebung.
Es war zu warm, um zu schlafen. Ich stand auf, öffnete mein Fenster, hörte das seit Jahrmillionen anhaltende Geräusch des Meeres, und schloss es wieder. Stattdessen zog ich mein Shirt aus und legte mich wieder hin, ohne mich zuzudecken. Scheiß trockene kalifornische Hitze, scheiß Meer, scheiß Umzug, scheiß Leben.
Zwanzig Minuten später schlief ich endlich ein.
Als ich verstört die Augen öffnete, war es noch immer dunkel. Etwas hatte mich geweckt, aber es war nicht der seltsame Traum gewesen, dessen Fragmente sich bereits auflösten. Etwas von einem gefährlichen Jugendlichen in meinem Alter, der versucht hatte, mich umzubringen, und von einstürzenden Häuserfassaden.
Ich lag mit dem Gesicht zur Wand und lauschte. Eine neue Umgebung bringt neue Laute mit sich. Jedes Haus besitzt seine persönlichen Geräusche und ist ständig am arbeiten; wie ein Lebewesen. Trotzdem war ich mir sicher, dass es keine knarrende Diele, keine angesprungene Klimaanlage und kein Knacken im Gebälk war, das mich wach gemacht hatte. Auch keine Waschbären an den Mülltonnen oder Ratten in den Wänden. Überhaupt kein Geräusch.
Es war das beängstigende Gefühl, nicht allein im Zimmer zu sein. Dieses unerklärliche Prickeln auf der Haut, wenn man still und heimlich angestarrt wird. Dieser Eindruck verstärkte sich mit jeder Sekunde, bis seine erdrückende Last so groß wurde, dass ich es nicht mehr aushielt. Ich wirbelte herum, sah Schatten und Dunkelheit und tastete hektisch nach dem Lichtschalter der kleinen Nachttischlampe, die neben der Matratze auf dem Fußboden stand. Das Licht verscheuchte die Finsternis und präsentierte lediglich Kartons und Möbel, kein stummes, glotzendes Wesen, keine Monster, keine Einbrecher. Ich war allein.
Trotzdem verschwand der Eindruck beobachtet zu werden nicht sofort. Ich hielt meinen Atem an und lauschte angestrengt. Erfolglos.
„Hallo?“, flüsterte ich. Der Klang meiner Stimme in dieser Ruhe war beängstigender, als sie selbst. Ich bekam keine Antwort. Nach ein paar Minuten legte ich mich wieder hin, zog die Decke bis zum Kinn und ließ die Lampe brennen. Sollte der General am nächsten Morgen in mein Zimmer kommen und ich noch nicht wach sein, würde er mir entweder einen Vortrag über das Stromsparen halten, oder darüber, dass ich ein unglaublicher Hasenfuß sei. Wahrscheinlich würde er sogar beide geschickt kombinieren. Es war mir im Moment egal.
3
Unser Frühstück verlief geordnet und relativ stumm, wie so viele zuvor. Die neue Umgebung änderte gar nichts daran. Nachdem der General zu Ende gegessen und sein Besteck akkurat mit der Rückseite nach oben auf den leeren Teller gelegt hatte, nahm er einen kräftigen Schluck aus seiner zweiten Tasse Earl Grey.
„Ich habe beschlossen, dass du an den Brückenkursen am College teilnimmst“, sagte er plötzlich mit unverschämter Gleichgültigkeit. Bevor ich auch nur den Ansatz eines Einwandes erheben konnte, fuhr er fort. „Du bist ein guter Schüler, das ist mir klar. Aber wir befinden uns jetzt in einem anderen Staat und wissen nicht, wie hoch hier die Messlatte hängt. Außerdem kannst du auf diese Art bessere soziale Kontakte knüpfen.“
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Es war ihm nicht genug, meine Zukunft zu erschweren, in dem er meine Vergangenheit einfach abgeschnitten hatte, nein, er musste mir auch noch akkurat gemeißelte Steine auf meinen gegenwärtigen Weg legen. Meinesozialen Kontaktesollten sich nicht auf die Menschen beschränken, mit denen ich sowieso ein Drittel des Tages der nächsten Jahre verbringen würde. Ich wollte das Beste aus meiner Situation machen und den Sommer dazu nutzen, meine aufgezwungene neue Umgebung frei zu erkunden.
„Das sind doch alles lernschwache Schüler, die diese Kurse besuchen“, konterte ich. „Und Halbkriminelle. Das ist bestimmt kein vorteilhafter Umgang.“
Das war klischeehaft und entsprach nicht unbedingt der Wahrheit, aber es war meine einzige Verteidigung. Ein flüchtiger Blick zu meiner Mum verriet mir, dass der General sie nicht eingeweiht hatte. Sie sah ebenfalls überrascht aus. Trotzdem reagierte sie sofort.
„Ich glaube nicht, dass Julian das nötig hat. Du kennst seine Noten, Ernest. Lass ihm doch den Sommer, um sich an unsere neue Umgebung zu gewöhnen.“
„Das ist mir durchaus bewusst. Ich möchte auch nicht, dass er Kontakte zu diesen Verlierern aufnimmt. Aber auf diese Art kann er einen Vorsprung nutzen, sich einen guten Namen bei den Dozenten zu machen.“
Der General sah mich ruhig an, trotzdem hatten seine Augen eine glanz- und kompromisslose Härte.
„Du solltest im Leben immer nach der für dich besten Strategie suchen.“
„Und taktisch vorgehen“, ergänzte ich. Es war eine sarkastische Bemerkung, die ich mir unter anderen Umständen niemals erlaubt hätte. Dafür hatte ich zuviel Angst vor meinem Vater. Aber im Moment war ich zu aufgewühlt, um Konsequenzen zu berücksichtigen. Zum Glück bemerkte er das Gift in meiner Stimme nicht – oder er ignorierte es einfach.
„Richtig, Jul. Ich sehe, wir verstehen uns. Zeig denen, was in dir steckt.“
Dann beugte er sich tatsächlich vor und strich mir über die halblangen Haare. Ich scheute beinahe seine Berührung, einerseits, weil er mich überrumpelt hatte, andererseits, weil sie ungewohnt und emotionslos war und er es nur tat, um mir die restliche verbale Munition zu nehmen. Taktische Vorgehensweise. Damit war der Sommer für mich gelaufen, aber ich hatte noch eine Karte im Ärmel: Den Campus.
Sicherlich gab es hier in Cape Orchid keinen guten alten Chad, mit dem ich hätte zusammen ziehen können, aber einen halbwegs passablen Zimmergenossen würde ich bestimmt finden. Im Grunde war jedes Leben besser als das mit dem General. Mein Zugeständnis an die Sommerkurse war vielleicht mein Ticket in die Unabhängigkeit.
Während ich kurz darüber nachdachte, warf der General einen prüfenden Blick auf seine Uhr und trank hastig seinen Tee aus. Meine Mum reichte über den Tisch und ergriff meine Hand. Sie ahnte bestimmt, was jetzt kommen sollte.
„Ich bin einverstanden, Dad. Aber, wo wir schon mal darüber reden, da gibt es noch etwas.“
Der General wischte sich mit der Serviette über die feuchten Lippen und legte sie sauber zusammengefaltet neben seinen Teller. Mein Puls beschleunigte sich. Der Griff meiner Mum wurde etwas fester.
„Was denn?“, fragte er und rückte seinen Stuhl demonstrativ vom Tisch weg.
Ich sah kurz meine Mum an und sie schüttelte fast unmerklich ihren Kopf. Sie war gezwungenermaßen ebenfalls zu einer guten Strategin geworden. Ich fühlte mich hin und her gerissen. Einerseits wollte ich dem General jetzt davon erzählen, auf den College-Campus zu ziehen, andererseits traute ich meiner Mum, dass ich es im Moment lassen sollte.
„Ach, nichts wichtiges.“
Ohne näher darauf einzugehen, erhob sich der General, straffte seine Uniform und küsste meine Mum lieblos auf die Stirn.
„Dann werde ich mir jetzt mal den Sauhaufen ansehen, den sie mir hier übertragen haben. Ich hoffe, es sind wenigsten ein paar Jungs dabei, die deinen Schneid haben, was, Jul?“
„Ja, Sir“, sagte ich und nickte widerwillig. Die Schlacht war verloren. Er wusste genau, wo man einen Menschen tödlich verletzen konnte, Körper, so wie Geist.
„Ruf im Sekretariat des Colleges an, Jul, und klär das mit deiner Einschreibung. Sollten die Schwierigkeiten machen, gib ihnen meinen Namen und meine Büronummer. Sie steht auf dem Block neben dem Telefon. Wir sehen uns heute Abend.“
Mit diesen Worten verließ er unser neues Heim.
„Es tut mir Leid, Schätzchen“, sagte meine Mum, nachdem die Haustür zugeschlagen wurde. „Der Zeitpunkt war nicht richtig.“
„Wieso? Ich gehe doch zu diesen besch... eidenen Brückenkursen. Du weißt, was ich fragen wollte, oder?“
„Natürlich. Du sollst auch auf den Campus ziehen. Du bist jung, aber auch erwachsen und musst dein eigenes Leben führen. Wenn wir dich zu sehr unter unsere Fittiche nehmen, wirst du es später umso schwerer haben. Du benötigst Freiraum, um dich zu entfalten, schließlich bist du mein kleines, kreatives Genie.“
Sie rückte etwas näher an mich heran.
„Ich rede mit deinem Vater, fest versprochen. Aber du musst mir etwas Zeit lassen, bis der richtige Moment dafür da ist. Geht das okay für dich?“
Ich nickte und nahm sie dankbar in den Arm. Der General war ohne Frage ein Tyrann, aber meine Mum kannte ihn lange genug um zu wissen, wann und wo man bei ihm den Hebel ansetzen musste.
„Und mach dir keine Sorgen wegen der Sommerkurse“, sagte sie anschließend und sah mich mit ihren wundervoll braunen Augen – die ich leider nicht von ihr geerbt hatte – eindringlich an. „Die schaffst du doch spielend. Außerdem lernst du dort vielleicht wirklich ein paar nette Mädchen kennen.“
Ich ließ mir nichts anmerken, trotzdem ergänzte meine Mum ihre Aussage.
„Oder Jungs.“
Vielleicht meinte sie lediglich Freunde im allgemeinen. Wahrscheinlich, denn sie wartete keine Reaktion von mir ab, sondern stand auf, um den Tisch abzuräumen. Ich wollte ihr helfen, aber sie schob mich zur Seite.
„Lass nur, ich mache das schon. Ruf du im College an und klär die Sache mit deiner Einschreibung. Wenn du zu lange wartest, könnte es sein, dass dir dein Vater zuvor kommt, wenn er in der Kaserne ist. Und wenn er dann hört, dass du noch nicht angerufen hast, weißt du ja, was passiert. Gott, er ist immer so misstrauisch.“
Ich erledigte den Anruf und fuhr noch am selben Vormittag mit dem Bus zur Schule, um den nötigen Papierkram zu erledigen. Die junge Sekretärin Mrs. Townsend erklärte mir freudig, wie viel Glück ich doch hätte, mich noch vordem Wochenende gemeldet zu haben, da die Kurse am folgenden Montag beginnen sollten. Ich lächelte zerknirscht. Sie sah mir und meinem Abschlusszeugnis von der Highschool an, dass mein Glück vielleicht doch nicht so groß war.
„Sind Sie sicher, dass Sie am Sommerunterricht teilnehmen wollen, Mr. Grifter? Ihr Notendurchschnitt ist recht hoch.“
„Nein, ich möchte es nicht. Aber ich werde es tun, weil mein Vater es so will.“
Sie nahm ihre schmale Brille ab und stubbste sich nachdenklich ein paar Mal mit dem Bügel gegen ihr Kinn. Sie war ungemein hübsch und konnte nicht sehr viel älter als ich sein.
„Ich verstehe Ihr Problem. Ich selbst bin mit meiner Mum drei Mal während meiner Schulzeit umgezogen. Es ist immer unangenehm. Aber wenn es Sie tröstet, kann ich Ihnen versichern, dass Cape Orchid eine wunderbare kleine Stadt mit einem besonderen Zauber ist. Die Leute hier sind sehr einfach und offen. Man findet schnell Kontakt.“
4
Die nächsten Tage in unserem neuen zu Hause vergingen wie in Zeitlupe. Meine Freizeit verbrachte ich hauptsächlich mit dem Auspacken sämtlicher Umzugkartons und dem Einräumen der Sachen. Die Brückenkurse am College waren erwartungsgemäß beschissen. Ich gehörte weder zu den reichen Yuppies, noch zu den Strebern oder zu den Athleten, obwohl ich bei denen noch am besten aufgehoben gewesen wäre. Ich war zwar eher schlank als muskelbepackt, aber mein Körper war schön definiert. Meine ersten Kontakte beschränkten sich auf ein pummeliges Mädchen mit unzähligen Sommersprossen namens Diane Kurlander und einen mageren, stets gebeugt gehenden Typ, Matthew Hall, dessen Brille schätzungsweise dreitausend Dioptrien besaß. Wie ich war auch Diane erst vor kurzem mit ihrer Familie nach Cape Orchid gezogen. Sie stammte aus Jacksonville, Florida, und beschwerte sich in einer Tour über die drohenden Gefahren durch Erdbeben. Ich ging nicht weiter darauf ein, zumal mir die Erdbebensache ebenfalls nicht geheuer war. Trotzdem fragte ich mich, was an Hurricans so toll sein soll.
Ansonsten war Diane ganz okay. Sie war witzig und benahm sich ungezwungen. Als dumm konnte man sie nicht bezeichnen, sie litt lediglich unter Prüfungsangst, was ihr schlechtere Noten einbrachte, als sie verdiente. Daher auch ihre Teilnahme an den Brückenkursen. Bei Matthew sah es ganz anders aus. Er war hier in Cape Orchid aufgewachsen, noch stiller als ich und einkleines Genie. Die Sommerkurse belegte er auf eigenen Wunsch, obwohl das bei seinem perfekten Zeugnisdurchschnitt lächerlich war. Was ihn interessant machte, war sein unglaubliches Allgemeinwissen. Wann immer eine Unterhaltung einzuschlafen drohte, warf er einfach eine interessante Information in den Raum, egal, zu welchem Thema. Ich fand ihn nett, genau wie Diane, mehr aber auch nicht.
Als ich am dritten Tag vom College heim kam, fand ich das Haus leer vor. Eine Notiz meiner Mum zufolge, die sie an die Kühlschranktür geheftet hatte, war sie mit meinem Vater in den Nachbarort zum Einkaufen gefahren:Essen im Kühlschrank – stell keinen Unsinn an – wir lieben dich – bis nachher, Mum. Mit einem Mal kam mir das Haus riesig und einsam vor. Der Eindruck wurde durch die vielen großen Fenster und die offene Innenarchitektur verstärkt, und obwohl sich warmes Sonnenlicht in Millionen träger Staubpartikel brach, fröstelteich. Es war unangenehm still. Seit unserer Ankunft war dieses der erste Moment, in dem ich allein in unserem neuen Heim war. Zu Hause in Nampa war ich daran gewöhnt, aber in dieser fremden Umgebung behagte mir das gar nicht. Die kaum hörbaren Schreie von Kindern, die einige Häuser weiter auf der Straße spielten, der gedämpfte Gesang der Vögel, ferner Verkehrslärm und das stete Murmeln des Meeres vermischte sich zu einem beinahe lautlosen Wispern, dessen Eindringlichkeit körperlich und fast bedrohlich wirkte.
Und wieder dieses Gefühl, beobachtet zu werden.
Ich machte mir nicht die Mühe nach dem Essen zu sehen, Hunger hatte ich sowieso keinen. Stattdessen verließ ich die Küche durch die Terrassentür und betrat den Hintergarten. Draußen schloss ich die Augen, atmete tief durch und ließ das von den Bäumen erzeugte Spiel zwischen Sonne und Schatten mein Gesicht kitzeln. Schon viel besser. Dann bemerkte ich einen angenehm süßen Geruch, verführerisch, ein wenig herb, aber lieblich. Ich drehte meinen Kopf in die Richtung, aus der dieser Geruch zu kommen schien und öffnete die Augen.
Die Villa. Gefangen von der riesigen Hecke, die auch in unserem Hintergarten an der Grundstücksgrenze entlang lief. Die Hecke selber trug keine Blüten, also konnte sie nicht die Quelle der Verführung sein. Neugierig näherte ich mich ihr bis auf ein paar Fuß und versuchte, durch das dichte Gestrüpp hindurch zu spähen – vergeblich. Der einzige Zugang zum Nachbargrundstück schien das zugewachsene, schwere Eisentor an der Straße zu sein. Unentschlossen wanderte ich langsam an der Hecke entlang zum Ende unseres Gartens, doch nirgends fand sich eine lichte Stelle in dem von Menschenhand angelegten Urwald, die einen kleinen Einblick zugelassen hätte. Am Ende unseres Grundstücks wuchsen ein paar wilde Johannesbeersträucher. Ich weiß bis heute nicht, warum – vielleicht habe ich im Augenwinkel den Schwanz eines weißen Kaninchens verschwinden sehen – aber ich ging in die Knie und drückte die Sträucher zur Seite.
Dort war er, der geheime Durchgang zum geheimnisvollen Garten. Ungefähr drei Fuß hoch und fast ebenso breit. Ohne weiter darüber nachzudenken, kroch ich hindurch. Auf der anderen Seite sprang ich auf und blickte michum. Der Garten war genau so lang wie unserer, aber wesentlich breiter. Pflanzen und Bäume und Zeit hatten hier ihre Magie versprüht, außerhalb menschlichen Einflusses. Altes Laub vom letzten Herbst – und vielleicht von vielen davor – lugte, noch nicht ganz verrottet, zwischen dem hohen Gras hervor. Ranken und Kletterpflanzen, deren vorrangiges Ziel die vereinzelten Apfel- und Kirschbäume waren, hatten erfolgreich ihr Hoheitsgebiet auf den Wildrasen erweitert. Keine Palmen. Ein alter Trampelpfad verband eine von Büschen geschützte kleine Holzhütte mit der Terrasse der Villa. In einiger Entfernung hinter dem Pfad stand ein reich verzierter, alter Springbrunnen, vielleicht aus Marmor, der ebenfalls von den Klettergewächsen erobert worden war. Auffällig waren die vielen blutroten Farbkleckse in dieser grünen Welt. Die meisten Kletterpflanzen waren Wildrosen.
5
Mein erster Gedanke war Flucht. Schließlich befand ich mich illegal auf fremden Grund und Boden und ich wusste nicht, wie es die Einheimischen mit Hausfriedensbruch hielten. Stattdessen blieb ich, genau wie er, wie angewurzelt stehen. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, bis er aus dem Schatten heraustrat.
Er war etwas größer als ich, schlank, durchtrainiert, hatte kinnlanges, hellbraunes Haar, schön geschwungene, dunkelbraune Augenbrauen, fein geschnittene Gesichtszüge und trug lediglich ein offenes, lindgrünes Hemd und eine abgeschnittene, zerfranste rote Jeanshose, die gerade noch auf seinen Beckenknochen hing. Während er langsam die Steintreppe herunterkam, musterte ich ihn von seinen bloßen Füßen – nackte Füße von hübschen Männern haben mich schon immer wahnsinnig gemacht – bis zu seinen klaren, grünen Augen, die sich selbst auf diese Entfernung stark von seiner, für diese Gegend unnatürlich hellen, fast milchigen Haut abhoben und wie zwei Jadesteine in der Nachmittagssonne glänzten. Heute glaube ich, dass es das vorsichtige Lächeln war, das seine Mundwinkel umspielte, weshalb ich nicht Reißaus genommen hatte.
Je näher er kam, desto jünger schien er zu werden, bis er letztendlich vor mir stand und ich überzeugt war, dass wir in etwa gleichaltrig seien mussten. Erlächelte mich an. Ein Lächeln, das nicht nur von seinem Mund ausging, sondern sein ganzes Gesicht betraf. Ein Lächeln, mit dem man die Mauern von Jericho zum Einsturz hätte bringen können.
„Es ... es tut mir leid, ich wollte hier nicht einfach eindringen. Ich habe dieses Loch in der Hecke entdeckt und die Villa –“
„Alain.“
„Was?“
„Alain Blanchard.Das ist mein Name.“
„Oh, äh, ich heiße Grifter. Ich meine, Julian, Julian Grifter. Freunde nennen mich Grif.“
Unnötig zu erwähnen, dass ich ein wenig verwirrt war. In meinem Inneren tobte ein regelrechtes Gefühlschaos: Schuld, aber auch Faszination, Neugier und der heiße, prickelnde Taumel der Erotik. Er strahlte eine regelrechte Aura der Makellosigkeit und Perfektion aus, und der Duft von Rosen hatte sich zunehmend verstärkt.
„Julian. Das ist ein schöner Name. Julianus. Aus dem Geschlecht der Julier.“
„Hm?“
„Das ist die lateinische Bedeutung deines Vornamens. Julius Caesar gehörte zu dieser Adelslinie. Er war ein mächtiger Feldherr.“
Diese Bezeichnung traf wohl eher auf meinen Vater als auf mich zu, und die Bemerkung als solche hätte von Matthew kommen können.
„Ich wusste nicht, dass die Villa bewohnt ist. Ich wollte nicht stören.“
Er lachte plötzlich auf und warf seinen Kopf in den Nacken. Ein ehrliches, herzliches Lachen.
„Niemand stört mich. Du schon gar nicht.“
Dann drehte er sich um und ging zurück zur Terrasse, während ich völlig verwirrt zurückblieb. Seine Bewegungen wirkten auf eine seltsame Weise elegant, so, als würde er durch Wasser, nicht durch Luft schreiten. Nach der Hälfte des Weges blickte er sich zu mir um.
„Nun komm schon, Julian. Ich habe drinnen kühlen Eistee.“
Wie hypnotisiert folgte ich ihm durch den wilden Rosengarten die Steintreppe hinauf in die Villa.
Das alte Gemäuer hielt, was es von Außen versprach: Die Räume waren mindestens elf Fuß hoch, mit erblassten, eingerissenen Tapeten aus den fünfziger Jahren verkleidet und sehr spärlich mit antik anmutenden Möbeln versehen. Stuckverzierungen, die früher einmal die Decke in ein ansehnliches Kunstwerk verwandelt hatten, waren jetzt nur noch teilweise vorhanden. Die Luft in dem Wohnraum war angenehm kühl, aber auch dort war der Rosenduft allgegenwärtig. Unter einem riesigen Fenster zu unserer Grundstücksseite stand ein uraltes Sofa hinter einem winzigen Eichentisch mit einem übervollen Aschenbecher darauf, rechts davon eine nikotingefärbte Stehlampe, links ein Stapel alter Zeitungen, ein paar vertrocknete Topfblumen auf der Fensterbank und auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers ein Schwarz-Weiß-Fernseher auf dem Fußboden, der fast lautlos aktuelle Nachrichten präsentierte. Ein abgewetzter Läufer zwischen Tisch und Fernseher zierte das ansonsten karge Parkett.
„Warte, ich hole unsere Erfrischungen. Wir werden Tee trinken.“
Alain verließ den Raum und ließ mich in meiner Verwirrung zurück. Viel zu erkunden gab es in dem Wohnzimmer, wenn man es denn so nennen konnte, nicht, also setzte ich mich auf das Sofa und versuchte sowohl angestrengt als auch vergeblich dem Fernseher zu lauschen, der nur ein tonloses Flüstern von sich gab. Also schaute ich doch weiter in die Runde, bis meine Blicke auf den Stapel Zeitungen fielen, die kreuz und quer aufeinander lagen. Die oberste trug das Datum von der vorherigen Woche, einer Zeit, in der noch niemand in Cape Orchid von der Existenz Julian Grifters wusste. Irgendwie deprimierte mich der Gedanke. Dann bemerkte ich den Zipfel einer tiefer im Stapel verborgenen Zeitung. Das Datum war zu lesen. Sie war vom dreizehnten Oktober 1982. Das schien mir ein wenig seltsam, aber bevor ich darüber nachdenken konnte, kam Alain mit zwei riesigen Gläsern Früchtetee zurück, in denen munter Eiswürfel klimperten.
„Voilà, Ihr Eistee, Monsieur.“
Er drückte mir eines der feuchten Gläser in die Hand, lief um den Eichentisch herum und nahm neben mir im Schneidersitz Platz. Etwas war merkwürdig, aber ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht einordnen.
„Danke.“
Er hielt mir sein Glas am ausgestreckten Arm entgegen und ich stieß mit ihm an. Dabei sahen wir uns tief in die Augen. Ich hatte einmal gehört, dass man das so machen muss, andernfalls ist es unhöflich oder bringt Unglück oder so. Jedenfalls war der Tee erfrischend und fruchtig.
„Lebst du allein hier, Alain? Ich dachte, das Haus sei unbewohnt.“
„Die meiste Zeit schon. Ich sehe meine Eltern selten, sie sind viel unterwegs. Du wohnst in dem Nachbarhaus, richtig?“