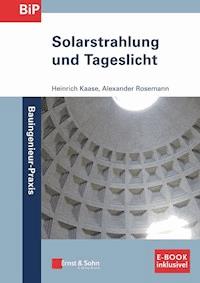
52,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Bauingenieur-Praxis
- Sprache: Deutsch
Der Solarstrahlung kommt für das Leben auf der Erde die größte Bedeutung zu. Dieses Thema wird in diesem Buch aufgegriffen. Nach einer Beschreibung des Prozesses der Strahlungserzeugung und des Durchganges der Solarstrahlung durch die Erdatmosphäre werden die Wechselwirkungen durch physikalische, chemische, biologische und medizinische Effekte beschrieben. Da über verschiedene Formen der Sonnenenergiewandlung bereits eine kompetente Fachliteratur vorliegt, wird hier auf die entsprechenden Ausführungen verzichtet. Dagegen wird auf die Wirkungen über das menschliche Auge - also auf das Tageslicht - besonders eingegangen. Tageslicht als passive Solarstrahlungstechnik dient nicht nur der Beleuchtung von Innenräumen der Gebäude, es kann auch einen merklichen Anteil der Energieeinsparung liefern. Der Jahresumsatz der Energie eines Gebäudes hängt von den verwendeten wärmetechnischen Installationen, den architektonischen Gegebenheiten und der Kunstlichttechnik ab. So werden technische Lösungen sowie Komponenten beispielhaft zusammengestellt und Berechnungsverfahren und technische Regel angegeben. Besonderer Augenmerk wird auf eine qualifizierte, integrale Gebäudeplanung gelegt, die auf den Bedürfnissen der Nutzer basiert und somit nicht nur die energetische Gesamtbilanz verbessert, sondern gleichzeitig die Aufenthaltsqualität erhöht. Dieses Buch führt in die notwendigen physikalischen und meteorologischen Zusammenhänge von Solarstrahlung und Tageslicht ein, indem die doppelt spektralen Zusammenhänge von Strahlung und Effekt, wie die lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kennzahlen und die gesundheitlichen Wirkungen erläutert werden. Das Buch erläutert zudem Verfahren zur Bestimmung des Energieumsatzes mit Planungstools. Das Buch ist für Architekten, Bauingenieure, Gebäudetechniker, Lichttechniker, Arbeitsmediziner, Meteorologen und Umwelttechniker in Planungspraxis, Industrie, Forschung und Lehre geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Vorwort
Über die Autoren
1 Einleitung
2 Lichttechnische Grundlagen
2.1 Optische Strahlung
2.2 Licht- und Strahlungsgrößen
2.3 Photonengrößen, Wellenzahl und Frequenz
2.4 Farbe
Literatur
3 Extraterrestrische Solarstrahlung
3.1 Die Sonne
3.2 Die Solarkonstante
Literatur
4 Terrestrische Solarstrahlung
4.1 Aufbau der Erdatmosphäre
4.2 Einfluss der Erdatmosphäre auf die Solarstrahlung
4.3 Die Globalstrahlung
4.4 Spektrale Verteilung der terrestrischen Solarstrahlung
4.5 Die Himmelsfarbe
Literatur
5 Tageslichtangebot
5.1 Tageslicht im Außenraum
5.2 Sonnenstand
5.3 Besonnung
5.4 Tageslicht im Innenraum
5.5 Blendung durch Tageslicht
5.6 Anforderungen an das Tageslicht im Innenraum
Literatur
6 Tageslichtmesstechnik
6.1 Gesamtstrahlungsmessungen
6.2 Spektrale Messtechnik
6.3 Lichtmessungen
6.4 Licht- und Strahlungsmessgeräte für den Feldeinsatz
6.5 Testräume für lichttechnische Untersuchungen an Tageslichtsystemen
Literatur
7 Sonnensimulation
Literatur
8 Strahlungsphysikalische und lichttechnische Kennzahlen von Tageslichtsystemen
8.1 Winkelbeziehungen
8.2 Spektraler Transmissions- und Reflexionsgrad
8.3 Strahlungstransmissionsgrad, Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad
8.4 Bidirektionale Messungen
8.5 Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades nach optischen Methoden
8.6 Das Datenformat EUMELDAT
8.7 Konvertierung der Messdaten in Planungsprogramme
Literatur
9 Angewandte Tageslichttechnik
9.1 Potenziale der Tageslichttechnik
9.2 Tageslichtsysteme
9.3 Tageslichtdachsysteme
9.4 Heliostatensysteme
Literatur
10 Planungsprogramme
10.1 Einleitung
10.2 Berechnungsverfahren
10.3 Berechnungswerkzeuge/Anwenderschnittstellen
10.4 Zusammenfassung
Literatur
11 Energetische Aspekte der Tageslichttechnik
11.1 Gebäudeautomatisierungssysteme
11.2 Tageslichtabhängige Beleuchtung
11.3 Energiebedarf von Gebäuden
11.4 Kunstlichtbeleuchtungsanlagen
11.5 Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Energiebedarfes für Beleuchtung
11.6 Anwendung des Verfahrens im internationalen Vergleich
11.7 Beispiele für innovative, energieoptimierte Tageslichtnutzungskonzepte
11.8 Umwelttechnische Aspekte der Tageslichttechnik
Literatur
12 Fotoinduzierte Effekte durch Solarstrahlung
12.1 Allgemeine Grundlagen
12.2 Beispiele für physikalische Wirkungen
12.3 Beispiele für chemische Wirkungen
12.4 Beispiele für biologische Wirkungen
Literatur
13 Gesundheitliche Aspekte
13.1 Zur Geschichte des Sonnenkultes und der Heliotherapie
13.2 Medizinisch-technische Bewertungsgrößen
13.3 Wirkungen auf und über die Haut
13.4 Wirkungen auf das Auge
13.5 Systemische Wirkungen
13.6 Wärme- und Strahlungsbelastung
13.7 Heliotherapie
13.8 Sicherheitsaspekte und Schutzmaßnahmen
13.9 Referenzsonnenspektren
Literatur
14 Ausblick
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Tabellenverzeichnis
2 Lichttechnische Grundlagen
Tab. 2.1 Spektralbereiche der optischen Strahlung.
Tab. 2.3 Radiometrische Größen (energetische Strahlungsgrößen) mit Strahlungsleistung Φ als Ausgangsgröße.
Tab. 2.4 Definition fotometrischer Größen und ihre Einheiten.
3 Extraterrestrische Solarstrahlung
Tab. 3.1 Vergleich typischer Daten von Sonne und Erde.
4 Terrestrische Solarstrahlung
Tab. 4.1 Internationale Wolkenklassen.
5 Tageslichtangebot
Tab. 5.1 Zusammenhang zwischen dem Himmelszustand, der Strahlungsart und dem mittleren fotometrischem Strahlungsäquivalent
Tab. 5.2 Koeffizienten a
0
bis a
3
und b
1
bis b
3
zur Bestimmung der Sonnendeklination δ
S
in Grad und der Zeitgleichung Z
g
in min.
Tab. 5.3 Empfehlungen für die Fenster zur Sichtverbindung nach außen.
8 Strahlungsphysikalische und lichttechnische Kennzahlen von Tageslichtsystemen
Tab. 8.1 Farb- und Farbwiedergabeeigenschaften einer beispielhaften Sonnenschutzverglasung.
Tab. 8.2 Beispiele für die Bezeichnung von Messgrößen im EUMELDAT-Format.
Tab. 8.3 Symmetriekennzahlen für #sym1 und #sym2.
Tab. 8.4 Lichteinfallsrichtungen für bidirektionale Messungen.
9 Angewandte Tageslichttechnik
Tab. 9.1 Lichttechnische, strahlungsphysikalische, energetische und farbmetrische Kennzahlen der Verglasungen aus Abb. 9.4.
Tab. 9.2 Einfluss lichttechnischer Größen von PC-Platten auf Tageslicht D65.
10 Planungsprogramme
Tab. 10.1 Kurzcharakterisierung verschiedener Berechnungswerkzeuge zur Tageslichtplanung und Bewertung der Solarstrahlung in urbanen Umfeldern.
11 Energetische Aspekte der Tageslichttechnik
Tab. 11.1 Verschiedene LAN-Topologien nach [3].
Tab. 11.2 Einflussfaktoren auf Raum- und Systempotenzial.
Tab. 11.3 Vor- und Nachteile der Steuerstrategien.
Tab. 11.4 Typische Daten einiger ausgewählter Lampentypen.
Tab. 11.5 Zuordnung der Leuchtenkennbuchstaben.
Tab. 11.6 Standardwerte für die Lichtreflexionsgrade von Raumbegrenzungsflächen.
Tab. 11.7 Übersicht möglicher Verfahren zur Ermittlung der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung der Kunstlichtbeleuchtung.
Tab. 11.8 Relative Zeiten für aktivierten und nicht aktivierten Sonnenschutz.
13 Gesundheitliche Aspekte
Tab. 13.1 Einteilung der Hauttypen nach der Reaktion der nicht vorbestrahlten Haut auf natürliche Sonnenbestrahlung.
Tab. 13.2 Schwellenbestrahlung, Bereich der spektralen Empfindlichkeit und Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit der fotomedizinischen Wirkungen für den Strahlenschutz.
Orientierungspunkte
cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
C1
III
IV
V
IX
XI
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
e1
Solarstrahlung und Tageslicht
Heinrich Kaase und Alexander Rosemann
Autoren
Heinrich Kaase
Berlin
Deutschland
Alexander Rosemann
Eindhoven
Niederlande
Titelbild Kuppel des Pantheons
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Umschlaggestaltung: Stefanie Eckart – stilvoll
Satz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig, Deutschland
Print ISBN: 978-3-433-03188-9
ePDF ISBN: 978-3-433-60821-0
ePub ISBN: 978-3-433-60819-7
oBook ISBN: 978-3-433-60822-7
Vorwort
Das Wissen über das Weltall, die Sonne und die Gestirne ist wohl die älteste Wissenschaft. Sie reicht in ihren Anfängen bis weit in das Altertum der Menschheit zurück. Die alten Völker wie die Chinesen in Asien, die Ägypter in Afrika und die Mayas in Amerika besaßen bereits hochentwickelte astronomische Kenntnisse und haben ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen, sie haben zur Entwicklung des Weltbildes und der technischen Entwicklung maßgeblich beigetragen.
Der Strahlung der Sonne kommt dabei für das Leben auf der Erde die allergrößte Bedeutung zu. Eine Einführung in die Grundlagen der Solarstrahlung und eine vertiefte Beschreibung der Eigenschaften des Tageslichtes sollen in dieser Publikation behandelt werden. Auf Themen der Solarenergiewandlung, zu denen eine Vielzahl an Übersichts- und Fachliteratur vorliegt, wird hier verzichtet.
Mit diesem Buch haben wir uns nach langem Zureden endlich dazu entschlossen, die Grundprinzipien der Solarstrahlung im Zusammenhang zu erläutern und eine Vorstellung von der Wirkungsweise in einer Buchform aufzustellen. Die mathematische Behandlung ist dabei auf das grundsätzlich Notwendige beschränkt. Dieses Buch enthält Inhalte aus Vorlesungen an der Technischen Universität Berlin und an der Eindhoven University of Technology sowie aus Forschungsprojekten der Autoren, die aus öffentlichen Mitteln von BMFT, BMWi, BMU, EU und BBSR sowie von Industriefirmen gefördert worden sind. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Jan de Boer, der die Bearbeitung des Kapitels „Planungsprogramme“ übernommen hat. Mit ihm haben wir den kompetentesten deutschen Experten zu diesem Thema gewinnen können.
Die langjährige Forschungstätigkeit über interdisziplinäre Themen mit einer intensiven Mitarbeit in nationalen Gremien (DIN, DKE, SLS, SSK und VDI) und in internationalen Gremien (CIE, IEA, IMEKO, ISO und PEP) war Garantie für eine praxisorientierte Betrachtung von Themen zur Wirkung der Solarstrahlung. Wenn es nunmehr gelingt, neben den Studenten auch diesem oder jenem Physiker, Biologen, Ingenieur, Architekten oder Mediziner in Forschung und Lehre Einblicke in physikalisch wie technisch interessante Entwicklungen der Solarstrahlung und der Tageslichttechnik zu vermitteln, so ist der Zweck des Buches völlig erreicht.
Über die Autoren
Prof. em. Dr. rer. nat. Heinrich Kaase studierte Physik an der Technischen Universität Braunschweig und war von 1970 bis 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Laboratorium für Radiometrie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Ab 1980 leitete er das neugegründete Laboratorium „Optoelektronik“ der PTB als Regierungsdirektor. 1987 erhielt er den Ruf auf den Lehrstuhl „Lichttechnik“ der TU Berlin. Seit 2008 ist Prof. Kaase im Ruhestand.
Die wissenschaftlichen Arbeiten zur Forschung über Spektralradiometrie, Synchrotronstrahlung, Plasmastrahlung, Solarstrahlung, Tageslicht, Lichtmesstechnik, Optohalbleiter, Fotobiologie, Fotomedizin und elektrische Installationstechnik waren stets praxisorientiert und interdisziplinär angelegt. Die Ergebnisse wurden in mehr als 200 Publikationen veröffentlicht. Auf Grund dieser Tätigkeiten wurde Heinrich Kaase in eine Vielzahl von nationalen Gremien (DIN, DKE, SLS und SSK) und internationalen Komitees (CIE, IEA, IMEKO und PEP) berufen.
Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Rosemann leitet das Fachgebiet Building Lighting an der Eindhoven University of Technology (TU/e). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Licht & Energie, Licht & visuelle Umgebung sowie Licht & Gesundheit. Nach dem Studium der Elektrotechnik an der TU Berlin promovierte und habilitierte er sich bei Prof. Kaase auf dem Gebiet der Tageslichttechnik. Im Anschluss an seine Tätigkeiten am Fachgebiet Lichttechnik und in der Firma schüco International KG ging er für 10 Jahre nach Kanada. Dort war er nach einer Postdoc-Anstellung an der University of British Columbia in Vancouver bei dem Energieunternehmen BC Hydro im Bereich Energieeffizienz tätig. Sein Verantwortungsgebiet umfasste die Entwicklung und Anwendung von energieeffizienten Standards und Building Codes auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene. Rosemann ist Vorstandsmitglied der NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) und Mitglied der LiTG (Deutsche Lichttechnische Gesellschaft).
1Einleitung
Das Interesse an elektromagnetischer Solarstrahlung ist außerordentlich groß, da diese nicht nur die primäre Energiequelle im Energiehaushalt der Erdoberfläche und der Erdatmosphäre ist, sondern auch unsere wichtigste Lichtquelle darstellt. Die jährliche Strahlungsmenge durch Solarstrahlung auf der Erdoberfläche ist rund 3000-mal größer als der Weltjahresenergiebedarf zu Beginn des 21. Jahrhunderts und ist nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich. Dagegen sind unter energetischen Aspekten die korpuskularen und die kosmischen Strahlungsanteile aus dem Weltraum, die die Erdoberfläche erreichen, gegenüber der Solarstrahlung, die die Erdatmosphäre trifft, ebenso zu vernachlässigen wie die geothermischen Wärmeströme aus dem Erdinneren oder die natürliche radioaktive Strahlung. Die für die Erde wichtigste natürliche Strahlungs- und Energiequelle ist also die Sonne. Durch sie werden das Erdklima und der Energiehaushalt auf der Erdoberfläche sowie die Verhältnisse in der Erdatmosphäre entscheidend bestimmt.
Neben der energetischen Bedeutung der Solarstrahlung sind ihre Wirkungen auf den Menschen lebensnotwendig. Dies trifft besonders auf das Auge als unser wichtigstes Orientierungs- und Kommunikationsorgan zu. Deshalb werden in diesem Buch Themen der Tageslichttechnik und Wirkungen der Solarstrahlung auf Organe des Menschen grundlegend behandelt. Dagegen wird bei Themen der Sonnenenergiewandlung und den technischen Anwendungen auf die umfangreiche Literatur verwiesen.
Die Solarstrahlung wird auf dem Wege von der Sonne bis zum Erreichen der Erdoberfläche durch Absorption und Streuung reduziert. Die Verluste treten durch Atom- und Molekülabsorption in den Randzonen der Sonne, im interstellaren Raum, in der Erdatmosphäre und auf der Erdoberfläche auf. In der Erdatmosphäre und auf der Erdoberfläche führen Streuung und Reflexion an Aerosolteilchen, Wassertropfen und Wasserkristallen zu weiteren Strahlungsverlusten. Die Berechnung der auf der Erde zur Verfügung stehenden Solarstrahlung ist aufgrund der inhomogenen Verteilung und Zusammensetzung der Erdatmosphäre, die zusätzlich noch höhen- und temperaturabhängig sind, z. T. sehr aufwendig und erfordert Kenntnisse der theoretischen und der geometrischen Optik.
Mithilfe der Tageslichtbeleuchtung können heute sowohl die Energie eines Gebäudes als auch die Gesundheit der Menschen und die Aufenthaltsqualität entscheidend verbessert werden. Dabei lassen sich die Beleuchtungsverhältnisse im Innenraum durch Tageslicht von den örtlichen Gegebenheiten der terrestrischen Solarstrahlung, den lichttechnischen Eigenschaften der Verglasungen bzw. der Sonnenschutzeinrichtungen, der Raumumschließungsflächen und der Einrichtungsgegenstände bestimmen. Zur ausreichenden Beleuchtung fensterferner Zonen in Gebäuden werden zunehmend auch Lichtlenksysteme eingesetzt. Die sich hieraus ergebenden Arbeitsfelder der Lichttechnik behandeln also die zentralen Zukunftsthemen: Energie, Umwelt und Gesundheit. Dabei können Gebäude sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der Energieumsetzung und der Verbesserung des Komforts spielen.
Heute werden am Markt eine Vielzahl von Systemen/Produkten für die Tageslichtbeleuchtung bei unterschiedlichsten Problemfeldern angeboten: Tageslichtlenkung, tageslichtabhängige Kunstlichtsteuerung, Sonnenschutz, Blendschutz, Sichtverbindung ins Freie, Ergonomie, passive Solarenergienutzung, Lüftung und Wärmedurchgang.
Die Entscheidung, ob der Einsatz dieser Systeme sinnvoll und wirtschaftlich ist, fällt jedoch oft ohne gesicherte Grundlagen. Auch ist dem Planer im Einzelfall nicht immer klar, welche Umgebungsparameter in dem System „Gebäude“ vorliegen müssen, damit sich die energetische oder tageslichttechnische Maßnahme sinnvoll in die Gebäudedynamik einfügt bzw. überhaupt funktioniert.
Der wirtschaftliche Einsatz von Tageslichtlenksystemen kann vor allem in Kombination mit der elektronischen Gebäudeautomatisierungstechnik, insbesondere mit einer tageslichtabhängigen Beleuchtungskontrolle, erreicht werden. So wird die Einsparung elektrischer Energie bei der künstlichen Beleuchtung durch energieeffiziente Lampen- und Vorschalttechniken, aber auch durch tageslichtabhängiges Schalten und Dimmen möglich.
Die Solarstrahlung und das Tageslicht beeinflussen aber nicht nur die Energiebilanz und den Sehvorgang, sie haben auch eine große Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Tageslichtlenksysteme sowie Sonnenschutzmaßnahmen beeinträchtigen häufig den Ausblick ins Freie; dies kann durch eine Verringerung der den für den freien Blick in die Außenwelt zur Verfügung stehenden Fensterfläche oder auch durch eine Verminderung der Transparenz geschehen. Es sind Fälle bekannt, bei denen Nutzer Einbußen in der Beleuchtungsqualität hinnehmen und die Tageslichtlenktechnik nicht verwenden, um einen besseren Ausblick ins Freie zu haben. Wenn Tageslichtsysteme den Innen- und Außenraum entkoppeln, so kann dies das Wohlbefinden des Nutzers beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang ist auch die Arbeitsstättenverordnung von Bedeutung, die für Arbeitsplätze einen Ausblick ins Freie fordert. Zudem beeinflussen Tageslichtsysteme die Blendungsbegrenzung, die Lichtfarbe und die Farbwiedergabe sowie die Beleuchtungsstärkeverteilung im Innenraum. Sie bestimmen die Akzeptanz bzw. die gesundheitlichen und die ergonomischen Verhältnisse entscheidend.
2Lichttechnische Grundlagen
Die Bestimmung von Strahlungs-, Licht- und Farbgrößen der Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht setzt die Kenntnis von lichttechnischen Grundlagen und von Parametern voraus, die die Solarstrahlung und das Tageslicht beschreiben. Während die Grundlagen der Lichttechnik [1] hier nur in kurzer Form zusammenhängend dargestellt werden können, werden die Eigenschaften der Solarstrahlung und das daraus abgeleitete Tageslichtangebot im Freien sowie die Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht in den Kapiteln 4 und 5 ausführlich behandelt.
Von der Solarstrahlung interessiert hier allerdings nur der Teil, der mit optischen Wirkungen verknüpft ist. Der langwelligere Anteil, der für die Wärmelast und die Raumkonditionierung wichtig ist, wird eher als Thema in der Raumklimatechnik dargestellt [2].
2.1 Optische Strahlung
Unter optischer Strahlung versteht man den Teil der elektromagnetischen Strahlung, der im Wellenlängenbereich von 1 nm (obere Grenzwellenlänge des Bereiches der Röntgenstrahlung) bis 1 mm (untere Grenzwellenlänge des Bereiches der Radiowellen) liegt. In der Norm [3] wird dieser Bereich von 100 nm bis 1 mm angegeben; es fehlt dort allerdings der sogenannte extreme Vakuum-UV (EUV)-Bereich von 1 nm bis 100 nm. Dieser EUV-Bereich ist Teil der nichtionisierenden Strahlung und deshalb der UV-Strahlung zuzuordnen.
Die Strahlungsleistung Φ, die durch elektromagnetische Wellen transportiert wird, lässt sich aus dem Maxwell’schen Gleichungen berechnen. Sie ist durch den Poynting-Vektor S als Kreuzprodukt des elektrischen und magnetischen Feldvektors
festgelegt [4]. E bezeichnet die elektrische Feldstärke und H die magnetische Feldstärke. Die Strahlungsleistung Φ (in W) einer emittierenden Quelle wird dann durch das Integral über eine geschlossene Fläche A (in m2) um die emittierende Quelle bestimmt:
Φ ist also die durch die Fläche A durchtretende Strahlungsleistung und dA ist ein Flächenelement auf der die Quelle umschließenden Fläche A.
Die Verteilung optischer Strahlung über die Wellenlänge wird durch Spektren beschrieben [5]. So ist die spektrale Strahlungsleistung diejenige Strahlungsleistung, die in einem Wellenlängenintervall um die Wellenlänge λ enthalten ist:
Mathematisch korrekt handelt es sich also um eine partielle Ableitung der wellenlängenabhängigen Strahlungsleistung. Die grafische Darstellung solcher spektralen Funktionen ist bei Strahlungsquellen wie die der Sonne, die sowohl Linien- als auch Kontinuumsstrahlung emittieren, mit Schwierigkeiten verbunden. In diesen Fällen wird oft eine histogrammähnliche Darstellung bevorzugt. Es wird dabei entweder die über ein endliches Wellenlängenintervall Δλ integrierte Strahlungsleistung in Abhängigkeit von der Mittenwellenlänge λm des jeweils betrachteten Intervalls aufgezeichnet [6]. Es ist also:
Oder es wird die über das Intervall Δλ gemittelte spektrale Strahlungsleistung
in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ dargestellt. Während also Φ(λm) in der Einheit W angegeben wird, misst man die spektrale Strahlungsleistung in der physikalischen Einheit W nm−1.
Die optische Strahlung wird in eine Vielzahl von Spektralbereichen eingeteilt, deren Grenzwellenlängen durch unterschiedliche physikalische, chemische oder biologische Wirkungen der Strahlung bestimmt sind. Die Einteilung der Spektralbereiche ist in Anlehnung an [3] mit der unteren Grenzwellenlänge λ1 und der oberen Grenzwellenlänge λ2 in Tab. 2.1 wiedergegeben.
Die obere Grenzwellenlänge gehört in dieser Aufstellung nicht mehr zu dem beschriebenen Bereich, der also nach oben offen ist. Die hier zusammengestellte Tabelle ist gegenüber der DIN-Norm um den Strahlungsbereich der extremen UV(EUV)-Strahlung erweitert. Die Grenzwellenlängen dieser Intervalle sind historisch entstanden und basieren auf Absorptionsvorgängen:
Tab. 2.1Spektralbereiche der optischen Strahlung.
1 nm ist die Grenzwellenlänge zwischen optischer Strahlung und Röntgenstrahlung; Strahlung mit kleinerer Wellenlänge hat ionisierende Wirkung.
Die Grenze bei 100 nm entspricht etwa dem Seriengrenzkontinuum von Wasserstoffatomen. Da diese Atome bei sehr geringem Druck das Weltall füllen, wird also UV-Strahlung mit Wellenlängen kleiner als etwa 100 nm im interstellaren Raum absorbiert, sodass der Weltraum zu kleinen Wellenlängen hin erst wieder Röntgenstrahlung mit Wellenlängen
λ
< 1 nm passieren lässt. Die Astronomie ferner Sterne basiert deshalb auf Röntgenteleskopen, wie sie z. B. im Röntgensatelliten ROSAT sehr erfolgreich verwendet wurden [7].
Die Grenze bei 200 nm entspricht etwa der Ionisierungsgrenzwellenlänge von O
2
und N
2
in der Luft. UV-Strahlung mit Wellenlängen kleiner als 200 nm hat bei Normaldruck in Luft eine Eindringtiefe von nur wenigen Millimetern.
Die Grenze bei 280 nm ist durch die Ozonabsorption bestimmt. Da in der oberen Erdatmosphäre Ozon angereichert vorkommt, bildet diese Schicht einen Schutz vor UV-Strahlung außererdatmosphärischer Quellen, die eine DNA-Schädigung hervorrufen kann.
Die Grenzwellenlänge 315 nm wurde in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts als DNS-Absorptionskante angesehen. Heute sind Forschungs- und Normierungsinstitute geneigt, diese Grenze längerwellig bei 320 nm festzulegen.
Nach [3] wird der sichtbare Spektralbereich für das helladaptierte menschliche Auge zwischen 380 und 780 nm festgelegt. Diese Grenzwellenlängen sind in internationalen Normen z. T. auf gerundete Werte bei 400 und 800 nm angesetzt worden; in der Farbmetrik der CIE wird die Verwendung der Grenzen bei 360 und 830 nm empfohlen.
Die Wellenlängengrenzen im IR-A-Bereich sind wiederum durch biologische Wirkungen bestimmt: IR-Strahlung der Wellenlängen 780 bis 1400 nm hat große Eindringtiefen (> 10 mm) in den menschlichen Körper.
Die Wellenlängengrenze bei 3000 nm (3 μm) ist dagegen durch die Messtechnik bedingt. So ist der Einsatz von Glas- und Quarzoptiken aufgrund ihrer Absorptionseigenschaften nur im IR-B-Bereich bis 3 μm möglich.
Im Spektralbereich des IR-C mit 3 μm <
λ
< 1 mm ist die Erdatmosphäre wegen der Wasserdampfabsorption nicht transparent. Damit kommt dem IR-C-Bereich auch keine wichtige Rolle in der Tageslichttechnik zu.
Für den Menschen ist der sichtbare Teil der optischen Strahlung von besonderem Interesse. Die mit der relativen spektralen Empfindlichkeitsfunktion des helladaptierten menschlichen Auges bewertete, sichtbare Strahlung wird als Licht bezeichnet. Diese Empfindlichkeitsfunktion wird auch V (λ)-Funktion für fotopisches Sehen genannt und ist in Abb. 2.1 dargestellt. Strahlung, die vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, darf also nicht als Licht benannt werden. In Abb. 2.1 ist zusätzlich die spektrale Empfindlichkeit der Rezeptoren für das dunkeladaptierte Auge (skotopisches Sehen) V′(λ), die sich in der Netzhaut des menschlichen Auges befinden, wiedergegeben [1].
Die Tab. 2.2 gibt typische Beleuchtungsstärken in horizontalen Ebenen auf der Erdoberfläche bei unterschiedlichen natürlichen Beleuchtungsverhältnissen wieder.
Während für das Tagessehen die V (λ)-Kurve und für das Nachtsehen die V′(λ)-Kurve anzusetzen ist, gilt im Zwischenbereich je nach Beleuchtungsstärke eine Kurve des sogenannten mesopischen Sehens.
Abb. 2.1 Spektrale Empfindlichkeitsgrade des helladaptierten menschlichen Auges V(λ) und des dunkeladaptierten Auges V′(λ) in Abhängigkeit von der Wellenlänge.
Tab. 2.2Beleuchtungsstärke Ev auf der Erdoberfläche durch natürliche Strahlung bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen.
Beispiel
Typische Beleuchtungsstärken in lx
Neumondnacht
0,01
Vollmondnacht
0,25
Vollkommen bedeckter Himmel am Wintertag
3 000
Vollkommen bedeckter Himmel am Sommertag um 12 Uhr
20 000
Klarer Sommertag um 12 Uhr
60 000… 100000
2.2 Licht- und Strahlungsgrößen
Der Strahlungsübergang von einer Strahlerfläche dA1 zu einer Empfängerfläche dA2 wird durch geometrische Größen nach Abb. 2.2 beschrieben. Dabei sind ε1 und ε2 Winkel zwischen den Flächennormalen n1 bzw. n2 der beiden Flächenelemente und der kürzesten Verbindung d.
Damit lässt sich nun der Raumwinkel Ω festlegen, unter dem die Strahlung von einer Quelle emittiert wird oder unter dem ein Empfänger die Strahlung einer Quelle erfasst. Es gilt
Die physikalische Einheit der Größe des Raumwinkels Ω ist Steradiant (sr), der gesamte Raumwinkel ist 4π sr. Der Raumwinkel wird also in der Einheit sr gemessen, ist aber dimensionslos! Deshalb ist bei Dimensionsbetrachtungen in Größengleichungen Vorsicht geboten.
Für kleine Flächen A und große Abstände d gilt für den Raumwinkel näherungsweise:
Die Definitionen der in [8] und im CIE-Wörterbuch [9] genormten abgeleiteten Strahlungsgrößen sind in Tab. 2.3





























