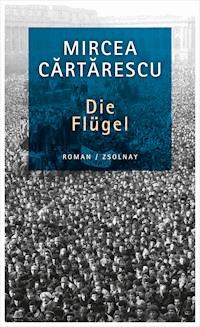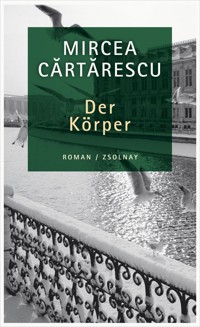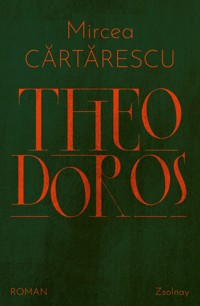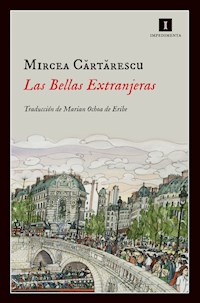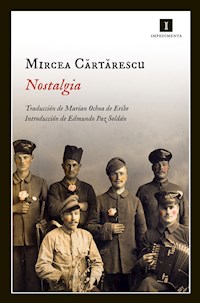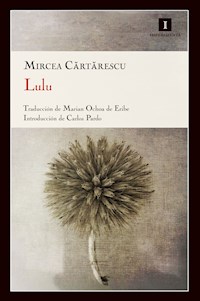Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Genial, verrückt, groß: Mit seinem monumentalen Roman um die Phatasiemaschine Solenoid schreibt sich Mircea Cartarescu endgültig in die Reihe der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart ein. Hohn und Spott erntet ein junger Mann in seinem Literaturkreis, als er dort seinen Text "Der Niedergang" zum Besten gibt. Aus ihm wird nicht wie erhofft ein gefeierter Schriftsteller, sondern ein Lehrer in der Vorstadt von Bukarest. Als dieser namenlose Erzähler jedoch ein Haus in Form eines Schiffes kauft, gerät er in den Bannkreis des Solenoids, einer Art riesiger Magnetspule, die sich unterhalb des Kellers befindet. Deren Gravitationskraft zieht aber nicht nach unten, sondern hebt konsequent alles in die Höhe, was in ihr Umfeld gerät – Menschen, Dinge, ja die Wirklichkeit selbst. Genial, verrückt, groß: Mit seinem monumentalen Roman hat Mircea Cartarescu erneut Weltliteratur geschaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1441
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Genial, verrückt, groß: Mit seinem monumentalen Roman um die Phatasiemaschine Solenoid schreibt sich Mircea Cartarescu endgültig in die Reihe der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart ein. Hohn und Spott erntet ein junger Mann in seinem Literaturkreis, als er dort seinen Text »Der Niedergang« zum Besten gibt. Aus ihm wird nicht wie erhofft ein gefeierter Schriftsteller, sondern ein Lehrer in der Vorstadt von Bukarest. Als dieser namenlose Erzähler jedoch ein Haus in Form eines Schiffes kauft, gerät er in den Bannkreis des Solenoids, einer Art riesiger Magnetspule, die sich unterhalb des Kellers befindet. Deren Gravitationskraft zieht aber nicht nach unten, sondern hebt konsequent alles in die Höhe, was in ihr Umfeld gerät — Menschen, Dinge, ja die Wirklichkeit selbst. Genial, verrückt, groß: Mit seinem monumentalen Roman hat Mircea Cartarescu erneut Weltliteratur geschaffen.
Mircea Cărtărescu
Solenoid
Roman
Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner
Zsolnay
Ein Mann holt hoch vom Gipfel Schlamm und Dung
Und formt sein großes Wunschbild in den Lüften
Von Träumen, Schatten, unbekannten Düften
Und bringt es uns in unsere Niederung.
Doch ganz vergeblich scheint sein kühnes Wagen,
Wie schön des Buches Klang auch sei und klar.
Geliebtes Buch, so ganz des Nutzens bar,
Du gibst uns Antwort nicht auf unsere Fragen.
(Tudor Arghezi: Ex Libris)
1 Teil
1
Wieder habe ich mir Läuse eingefangen, es wundert mich nicht einmal, erschreckt mich nicht, ruft keinen Ekel mehr hervor. Es juckt nur noch. Nissen habe ich immerzu, ich schüttele sie stets heraus, wenn ich mich im Bad kämme: winzig kleine, perlmuttfarbene Eier, die auf der Fayence des Waschbeckens dunkel glänzen. Auch zwischen den Zinken des Kamms bleiben noch genug davon hängen, anschließend reinige ich ihn mit einer alten Zahnbürste, jener mit dem angeschimmelten Stiel. Unmöglich, keine Läuse zu bekommen — ich bin Lehrer an einer Schule an der Peripherie. Die Hälfte der Kinder hat Läuse, die werden zu Beginn des Schuljahrs bei der ärztlichen Untersuchung festgestellt, wenn die Arzthelferin ihnen mit der Expertengeste der Schimpansen durch das Haar fährt — man darf sich wundern, dass sie die Chitinpanzer der eingefangenen Insekten nicht mit den Zähnen knackt. Dafür empfiehlt sie den Eltern eine weißliche, nach Chemikalien riechende Lauge, die gleiche, die schließlich auch die Lehrer benutzen. In wenigen Tagen riecht die ganze Schule nach dieser Tinktur gegen Läuse.
Das ist nun trotzdem nicht so schlimm, immerhin haben wir keine Wanzen, die wurden lange schon nicht mehr gesehen. Ich kann mich noch an sie erinnern, ich habe sie, als ich etwa drei Jahre alt war, mit eigenen Augen gesehen, in der kleinen Villa in Floreasca, wo wir so um 59, 60 herum gewohnt haben. Vater zeigte sie mir, wenn er mit einem Ruck die Matratze anhob. Sie sahen wie scharlachrote Körnchen aus, fest und glänzend wie Waldfrüchte oder jene schwarzen Körner im Efeu, von denen ich wusste, dass ich sie nicht in den Mund stecken durfte. Nur dass die Körnchen zwischen Matratze und Bettgestell ganz schnell in die dunkleren Ecken rannten, sie waren dermaßen alarmiert, dass ich stets einen Lachanfall bekam. Ich konnte es kaum erwarten, Vater ein weiteres Mal die schwere Ecke der Matratze anheben zu sehen (wenn die Leintücher gewechselt wurden) und wieder einmal die rundlichen Tierchen zu Gesicht zu bekommen. Dann lachte ich mit solcher Lust, dass Mutter, die mir das Haar hatte wachsen lassen, lang war es und voller Kringel, mich jedes Mal in den Arm nahm und bespuckte, damit mich nicht der böse Blick treffe. Daraufhin brachte Vater die Flit-Pumpe und verpasste den Wanzen, die es sich in den Fugen und Gelenkstellen des Holzes gemütlich gemacht hatten, eine übelriechende Dusche, dass sie nur noch Sterne sahen. Ich mochte den Geruch des Bettgestells, Tannenholz, in dem noch das Harz gärte, ja selbst den Geruch des Insektengifts mochte ich. Dann ließ Vater die Matratze los, und Mutter kam herbei, die Leintücher auf den Armen. Wenn sie eines auf das Bett breitete, entstand eine große Luftblase, in die ich stets mit größtem Vergnügen hineinschlüpfte. Nun wartete ich, dass das Leintuch ganz langsam auf mich herabsank, sich um meinen kleinen Körper legte, aber nicht auf jeden noch so geringen Fleck, sondern auch komplizierte Falten und Fältchen über mir zeichnete. Damals waren die Zimmer groß wie Hallen, und die beiden Menschen bewegten sich immerzu darin herum, schwer zu sagen, warum, sie kümmerten sich um mich: Mutter und Vater.
An die Stiche der Wanzen kann ich mich jedoch nicht erinnern. Mutter sagte, sie seien wie kleine rote Kreise auf der Haut mit einem weißen Punkt in der Mitte. Und sie würden eher brennen als jucken. Keine Ahnung, Tatsache aber ist, ich kriege stets von den Kindern Läuse, wenn ich mich über ihre Hefte beuge. Als wäre es eine Berufskrankheit. Ich trage das Haar lang, noch aus der Zeit, als ich hätte Schriftsteller werden können. Das ist alles, was mir von jener Karriere geblieben ist, die Mähne. Und die Helanca-Rollkragenhemden, wie sie der erste Schriftsteller trug, den ich je gesehen habe, und der sich mir als Bild des berühmten, unnahbaren Autors eingeprägt hat: der aus Frühstück bei Tiffany. Mein Haar berührt immer wieder das Haar der Mädchen, locker gebauscht und voller Schleifchen. Über diese verhornten, halb durchsichtigen Seile klettern die Insekten hoch. Ihre Krallen zeichnen die Krümmung des Haarfadens nach, den sie perfekt zu fassen kriegen. Dann laufen sie über die Kopfhaut, wo sie ihre Exkremente und Eier hinterlassen. Sie stechen in die tadellos weiße, pergamentartige Haut, die noch nie das Sonnenlicht gesehen hat, und das ist ihre Nahrung. Wenn das Jucken schier unerträglich wird, lasse ich heißes Wasser in die Wanne laufen und bereite mich vor, sie zu vernichten.
Gern höre ich dem Wasser zu, wenn es in die Wanne einläuft, jenem stürzenden Rauschen, dem turbinenhaft reißenden Strom der Milliarden Tropfen und zu Spiralen verdrehten Rinnsale, dem Dröhnen des Strahls, der senkrecht in die grünliche Gelatine des Wassers stößt, es steigt unmerklich an, nimmt, gestaut vor Hindernissen und in plötzlichen Invasionen, die Wände der Wanne ein, als bestünde es aus unzähligen durchsichtigen Ameisen, die im amazonischen Dschungel herumwuseln. Ich drehe den Wasserhahn zu, und es wird still, die Ameisen lösen sich ineinander auf, und der geleeweiche Saphir liegt reglos vor mir, er schaut mich wie ein helles Auge an und erwartet mich. Nackt steige ich ins Wasser, genüsslich. Ich versenke auch gleich den Kopf im Wasser, spüre, wie die Wasserwände mir symmetrisch über Wangen und Stirn steigen. Das Wasser setzt mir zu, schwer umfängt es mich, lässt mich in seiner Mitte levitieren. Ich bin der Kern einer Frucht mit grünblauem Fruchtfleisch. Meine Haare fächern sich auf und reichen bis zu den Wannenrändern, als hätte ein schwarzer Vogel seine Flügel ausgebreitet. Die Fäden stoßen sich gegenseitig ab, jedes Haar ist selbständig, jedes schwebt, nunmehr aufgeweicht, unter den anderen, ohne sie zu berühren, wie die Tentakel der Seelilien. Ruckartig bewege ich meinen Kopf hin und her, damit ich spüre, wie die Haarfäden unter Spannung geraten, im dichten Wasser gestreckt und schwer werden, eine unerwartete Last zu spüren bekommen. Es fällt schwer, sie ihren Wasseralveolen zu entreißen. Die Läuse halten sich an den dicken Stämmen fest, verschmelzen mit ihnen. Ihre unmenschlichen Gesichter zeigen eine Art Verwunderung. Ihre äußere Hülle besteht aus der gleichen Substanz wie die Haarfäden. Auch sie werden weich im heißen Wasser, aber sie lösen sich nicht auf. Die Atemröhrchen, symmetrisch am Rande der gaufrierten Bäuche angeordnet, sind bestens verschlossen, wie die verklebten Nüstern der Seehunde. Passiv und entspannt wie ein anatomisches Präparat schwebe ich in der Wanne, die Haut an meinen Fingern quillt auf und wird runzlig. Auch ich bin weich, als wäre ich von durchscheinendem Chitin überzogen. Die Hände, sich selbst überlassen, schwimmen obenauf. Auch der Pimmel strebt an die Oberfläche, wie ein Flaschenkorken. Es ist überaus seltsam, einen Körper zu haben, sich in einem Körper zu befinden.
Ich setze mich aufrecht und beginne, mir die Haare und den Körper einzuseifen. Während ich mich mit den Ohren unter der Wasseroberfläche befand, konnte ich die Gespräche und das Gepolter in den Nachbarapartments deutlich, aber wie im Traum, hören. Nun habe ich Gelatine-Pfropfen in den Ohren. Ich lasse die seifigen Hände über meinen Körper wandern. Für mich ist mein Körper nicht erotisch. Als strichen meine Finger nicht über meinen Körper, sondern über meinen Verstand. Mein in Fleisch verpackter Verstand, mein in den Kosmos verpacktes Fleisch.
Wie auch im Falle der Wanzen überrascht es mich nicht allzu sehr, als meine seifigen Finger an den Nabel gelangen. So geht es mir schon seit etlichen Jahren. Anfangs erschrak ich, selbstverständlich, denn ich hatte gehört, der Bauchnabel könne einem aufplatzen. Aber ich hatte mir über meinen keine Gedanken gemacht, da mein Nabel lediglich eine kleine Ausbuchtung in meinem »an der Wirbelsäule klebenden« Bauch war, wie Mutter sagte. Auf dem Grund dieser Vertiefung gab es etwas, das sich bei Berührung unangenehm anfühlte, mich aber niemals beschäftigt hatte. Der Nabel war nichts anderes als die ausgehöhlte Stelle am Apfel, woraus der Stiel ragte. Auch wir sind wie die Früchte an einem von Venen und Arterien durchzogenen Stiel gewachsen. Aber vor ein paar Monaten, als ich mit den Händen schnell mal über jenen Unfallort auf meinem Körper fuhr, nur damit er nicht ungewaschen bliebe, spürte ich etwas Ungewöhnliches, etwas, das es dort nicht hätte geben sollen: eine Art Knopf oder Nippel, den die Fingerkuppe als kratzend empfand, etwas Anorganisches, das nicht zu meinem Körper gehörte. Es steckte verkrustet in dem Knoten fahlen Fleisches, der sich dort wie ein Auge zwischen zwei Lidern auftat. Zum ersten Mal schaute ich aufmerksamer unter die Wasseroberfläche und schob die Ränder der Spalte etwas auseinander. Weil ich nicht gut sehen konnte, erhob ich mich aus der Wanne, und die Wasserlinse aus dem Nabel floss langsam ab. Herrgott, sagte ich lächelnd, jetzt ist es schon so weit, dass ich meinen eigenen Bauchnabel betrachte … Ja, es war ein blasser Knoten, der in letzter Zeit stärker hervortrat als gewöhnlich, weil meine Bauchmuskeln nach nunmehr fast schon dreißig Jahren etwas erschlafft waren. Eine Verkrustung von der Größe eines Kinderfingernagels in einer der Schlaufen dieses Knotens erwies sich schlicht als Schmutz. Aber auf der anderen Seite erhob sich fest und schmerzhaft der kleine, schwarz-grünliche Stumpf, den ich mit der Fingerspitze ertastet hatte. Ich konnte nicht erkennen, was das sein mochte. Ich versuchte, ihn mit den Fingernägeln zu packen, aber wenn ich daran zog, spürte ich einen leichten Schmerz, der mich erschreckte: Es konnte eine Art Warze sein, an die man besser nicht rührte. Ich bemühte mich, das Ding zu vergessen und dort zu belassen, wo es nun mal gewachsen war. Im Laufe unseres Lebens wachsen uns genügend Warzen und Muttermale, tote Knochen und anderes Zeugs, das wir geduldig mit uns herumschleppen, nicht zu reden von den Fingernägeln und dem Haar, den Zähnen, die uns ausfallen: Stücke von uns, die nicht mehr zu uns gehören und ein eigenes, ihr eigenes Leben erhalten. Ich besitze auch heute noch, aufgrund von Mutters Fürsorge, in einer Tic-Tac-Schachtel alle meine Milchzähne, und der gleichen Fürsorge verdanke ich den Besitz der geflochtenen Zöpfe des Dreijährigen. Unsere Fotos mit dem verblichenen Glanz und dem briefmarkengleich gezackten Rand sind ebenfalls solche Zeugnisse: Unser Körper hat sich irgendwann tatsächlich zwischen die Sonne und die Linse des Fotoapparats geschoben und seinen Schatten auf dem Filmstreifen hinterlassen, nicht anders als der Mond bei einer Finsternis seinen Schatten über die Sonnenscheibe wirft.
Aber nach einer Woche, wiederum in der Wanne, spürte ich neuerlich den ungewohnten irritierten Bauchnabel: Das nicht identifizierte Stückchen Etwas war länger geworden und fühlte sich nun anders an, eher beunruhigend denn schmerzhaft. Wenn uns ein Zahn wehtut, tasten wir immerzu mit der Zunge daran herum, gehen sogar das Risiko ein, schließlich auf einen lebendigen Schmerz zu stoßen. Alles, was auf der empfindlichen Karte unseres Körpers den Bereich des Gewöhnlichen verlässt, bringt uns auf und treibt uns um: Wir müssen um jeden Preis das Gefühl der Verlegenheit loswerden, das uns keine Ruhe lässt. Manchmal, wenn ich abends schlafen gehe, ziehe ich die Socken aus und spüre, dass die gelbe durchscheinende Haut an der Seite des großen Zehs übermäßig dick geworden ist. Ich packe diese feste Verdickung mit den Fingern und zerre mitunter eine halbe Stunde lang daran herum, bis es mir gelingt, einen Rand wegzureißen, an dem ich dann weiter und immer irritierter und unruhiger herumzerre, schon schmerzen meine Fingergelenke, als ich es schaffe, eine dicke, wie gläserne Rinde mit an zarte Fingerspitzen erinnernder Riffelung aufzureißen, einen ganzen Zentimeter toter Haut, die nun nicht eben vorteilhaft aussehend am Zeh hängt. Ich kann nicht länger daran herumzerren, denn schon bin ich bei der nervösen Haut darunter angelangt, bei mir selbst, der den Schmerz spürt, und doch muss ich dieses Jucken und diese Unruhe loswerden. Ich greife zur Schere und schneide sie ab, dann betrachte ich sie lange: eine weiße Rinde, die ich, ohne zu wissen, wie, produziert habe, ebenso wie ich mich nicht mehr daran erinnere, wie ich meine Knochen produziert habe. Ich knete sie zwischen den Fingern, rieche daran, sie riecht entfernt nach Ammoniak: Dieses organische, aber tote Stückchen, schon tot, als es noch Teil meiner selbst und mit einigen Gramm an meinem Gewicht beteiligt war, erzürnt mich immer noch. Mir ist nicht danach, es wegzuwerfen, ich lösche das Licht und lege mich hin, halte es immer noch zwischen den Fingern, um es am nächsten Tag vollends vergessen zu haben. Und doch humpele ich eine Weile: Die Stelle, von der es weggerissen wurde, schmerzt.
Also habe ich vorsichtig an dem festen Krümel zu ziehen begonnen, der aus meinem Bauchnabel hervorlugte, bis ich unerwarteter Weise das Ding in der Hand hielt. Es war ein kleiner Zylinder von einem halben Zentimeter Länge und etwa der Stärke eines Streichholzes. Er schien schon lange schwarz, verfault, dreckverklebt und im Laufe der Zeit schließlich zu Pechruß geworden zu sein. Es war etwas Uraltes, mumifiziert, verseift, weiß der Henker. Ich hielt es unter den Wasserstrahl des Waschbeckens, und der Dreckschorf löste sich und ließ erkennen, dass dieses kleine Ding vor langer Zeit vielleicht mal gelblich-grün gewesen sein mochte. Ich legte es auf den Boden einer leeren Streichholzschachtel. Es sah aus wie der abgebrannte Kopf eines Streichholzes.
Ein paar Wochen später zog ich ein weiteres Fragment aus meinem im heißen Wasser aufgeweichten Bauchnabel hervor, diesmal jedoch war es doppelt so lang, aber von gleicher Substanz, fest und lang. Nun merkte ich, dass es sich um ein bewegliches Schnurende handelte, ich konnte sogar die Menge der ineinander gedrehten Fäden erkennen, aus denen es bestand. Es war eine Schnur, eine ganz gewöhnliche Schnur, die man zum Verpacken benutzte. Die Schnur, mit der man mir vor siebenundzwanzig Jahren in der miserablen proletarischen Entbindungsstation, in der ich geboren wurde, den Nabel abgebunden hatte. Nun trieb mein Nabel sie ab, gemächlich, alle zwei Wochen ein Stückchen, pro Monat ein Stückchen und dann ein weiteres nach drei Monaten. Das heute ist das fünfte, ich hole es behutsam und genüsslich hervor. Ich biege es gerade, reinige es mit dem Fingernagel, wasche es im Wasser der Badewanne. Es ist das bislang längste Stück und, hoffentlich, das letzte. Ich lege es zu den anderen in die Streichholzschachtel. Brav liegen sie da, gelb-grünlich-schwarz, krumm, die Enden leicht aufgelöst. Hanfschnur, die gleiche, aus der auch die Einkaufsnetze der Hausfrauen gemacht werden, die ihnen in die Hände schneiden, wenn sie angefüllt sind mit Kartoffeln; die gleiche, mit der man Pakete verschnürt. Zu Mariä Himmelfahrt bekamen wir jeweils ein Paket von Vaters Verwandten im Banat: Kuchen mit Mohn und Honig. Der aufgeknotete Bindfaden, grünlich-kaffeebraun, bereitete mir Freude: Ich schlang sie um die Türklinken, damit Mutter nicht noch ein Kind bekäme. An jeder Klinke machte ich dutzende, hunderte Knoten.
Ich entledige mich der Sorge um die Nabelschnur und steige, das Wasser an mir ablaufen lassend, aus der Wanne. Ich hole die Flasche mit der Anti-Läuse-Substanz hinter der Kloschüssel hervor und gieße mir von deren muffelndem Inhalt einen Fingerbreit auf den Kopf. Dabei frage ich mich, von welcher Klasse ich sie diesmal wohl habe, als hätte das irgendeine Bedeutung. Wer weiß, vielleicht hat es sogar eine. Vielleicht sind die Läuse in den unterschiedlichen Straßen des Viertels und in verschiedenen Schulklassen von jeweils anderer Art, anderer Größe.
Ich spüle die eklige Flüssigkeit aus und kämme mich über dem sauber glänzenden Porzellan des Waschbeckens. Und plötzlich beginnen die Parasiten herabzufallen, zwei, fünf, acht, fünfzehn … Sie sind extrem klein, jeder eingekapselt in seinen je eigenen Wassertropfen. Schwerlich nur kann ich ihre Körper mit dem aufgedunsenen Bauch und je drei sich noch bewegenden Beinchen an jeder Seite sehen. Ihre Körper und mein Körper, der ich nackt und nass über das Waschbecken gebeugt dastehe, bestehen aus den gleichen organischen Geweben. Sie haben analoge Organe und Funktionen. Sie haben Augen, die die gleiche Realität sehen, haben Beine, die sie durch die gleiche unendliche und unverständliche Welt tragen. Sie wollen leben, ebenso wie ich es will. Ich beseitige sie mit einem Wasserstrahl vom Boden des Waschbeckens. Sie fahren hinab in die Siphons darunter, gelangen in die Kanalisation.
Ich lege mich mit nassen Haaren neben meinen Schätzen schlafen: der Tic-Tac-Schachtel mit den Kinderzähnchen, meinen Fotos, als ich ein Kleinkind war und meine Eltern in der Blüte ihrer Jahre standen, der Streichholzschachtel mit der aus meinem Bauchnabel herausgelösten Schnur, dem Tagebuch. Ich kippe mir, wie ich dies so oft abends tue, die Zähnchen in die Handfläche, glatte Steinchen, noch sehr weiß, die einstmals in meinem Mund waren, mit denen ich mal gegessen habe, ich habe Wörter ausgesprochen und zugebissen wie ein Hündchen. So oft schon habe ich mich gefragt, wie es denn wäre, irgendwo auch eine Papiertüte zu besitzen mit meinen Rückenwirbeln im Alter von zwei Jahren oder den Fingerknöcheln mit sieben …
Ich lege die Zähne zurück an ihren Platz. Gerne würde ich mir noch ein paar Bilder anschauen, aber ich halte nicht länger durch. Ich ziehe die Schublade am Nachtkästchen auf und stecke alles in die Schachtel aus vergilbtem »Schlangenleder«, die einstmals einen Rasierapparat beherbergt hat, einen Pinsel und ein Schächtelchen mit Astor-Klingen. Nun verwahre ich hier meine erbärmlichen Schätze. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und bemühe mich, möglichst schnell einzuschlafen, vielleicht sogar für immer. Die Kopfhaut juckt nicht mehr. Und weil es erst kürzlich geschah, hoffe ich, es geschieht nicht auch diese Nacht.
2
Ich dachte an Träume, an Besucher, an diesen ganzen Wahnsinn, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vorerst muss ich zurückkehren zur Schule, in der ich, sieh an, schon seit mehr als drei Jahren arbeite. »Ich werde nicht mein ganzes Leben Lehrer sein«, sagte ich mir, daran erinnere ich mich, als wäre es eben gestern gewesen, als ich spät an einem Sommerabend, rosa Wolken standen am Himmel, mit der Straßenbahn von dort, dem hintersten Colentina, wo ich hingefahren war, mir zum ersten Mal meine Schule anzuschauen, nach Hause fuhr. Aber sieh, es ist kein Wunder geschehen, und alles deutet darauf hin, dass es genau so weitergeht. Schließlich war es bis jetzt gar nicht so schlimm. An dem Nachmittag, als ich, unmittelbar nach der regierungsamtlichen Zuteilung, dort hinfuhr, um meine Schule zu sehen, war ich vierundzwanzig Jahre alt und wog etwa das Doppelte dieser Zahl an Kilos. Ich war unglaublich, unfassbar ausgehungert. Der Schnurrbart und die langen Haare, zu jener Zeit noch mit einem rötlichen Schimmer, vermochten es lediglich, meine Gestalt noch stärker zu infantilisieren, so dass ich, wenn ich mich unverhofft in einer Schaufensterscheibe oder in den Straßenbahnfenstern erblickte, einen Gymnasiasten zu sehen meinte.
Es war ein Sommernachmittag, die Stadt war bis oben hin angefüllt mit Licht, wie ein Glas, in dem sich das Wasser bogenförmig über den Rand wölbt. Ich hatte in Tunari vor der Generaldirektion der Miliz die Straßenbahn genommen, bin am Wohnblock meiner Eltern in der Ştefan cel Mare vorbeigefahren, wo auch ich gewohnt hatte, schaute wie üblich auf die unendliche Fassade, um das Fenster meines Zimmers zu sehen, das zum Schutz vor der Sonne von innen mit blauem Papier verklebt war, und fuhr danach am Maschendrahtzaun des Colentina-Spitals entlang. Die Pavillons der Patienten standen in dem großen Innenhof aufgereiht wie Schlachtschiffe aus Mauerwerk. Jeder hatte eine andere Form, als hätten die unterschiedlichen Krankheiten ihrer Bewohner die bizarre Architektur dieser Bauten bestimmt. Oder aber der Architekt jedes einzelnen dieser Pavillons war unter den Menschen, die an einer bestimmten Krankheit litten, ausgesucht worden und hatte das Gebäude so konzipiert, dass es dieses Leiden symbolisch repräsentierte. Ich kannte sie alle, mindestens zwei davon hatten auch mich schon beherbergt. Übrigens erkannte ich eben schaudernd in der rechten hinteren Ecke des Innenhofs das rosa Gebäude mit den papierdünnen Wänden, den Pavillon der Neurologie-Patienten. Hier hatte ich vor acht Jahren wegen einer partiellen Gesichtslähmung, die mir auch heute hin und wieder noch zu schaffen macht, einen ganzen Monat verbracht. Oftmals irre ich nächtens im Traum zwischen den Pavillons des Colentina-Spitals umher und betrete unbekannte, feindlich wirkende Gebäude, deren Wände bedeckt sind von anatomischen Schautafeln …
Dann fuhr die Straßenbahn an den ehemaligen ITB-Werkstätten vorbei, wo auch Vater einige Zeit als Schmied gearbeitet hatte. Davor hatte man jedoch Wohnblocks gebaut, so dass man sie von der Chaussee aus kaum mehr sehen konnte. Im Erdgeschoss eines Blocks befand sich direkt an der Doktor-Grozovici-Haltestelle eine Quartiersklinik. Dort war ich eine Zeit lang hingegangen, mir die Vitamin-B1- und -B6-Impfungen verabreichen zu lassen, ebenfalls infolge der Gesichtslähmung im Alter von sechzehn Jahren. Die Meinen drückten mir die Phiolen in die Hand und sagten mir, ich möge nicht ungeimpft zurückkehren. Die wussten schon Bescheid. Anfangs warf ich sie in den Fahrstuhlschacht und sagte ihnen, ich habe sie mir geben lassen, doch kam ich damit nicht lange durch. Bis zum Schluss musste ich sie mir tatsächlich verabreichen lassen. Ich brach abends im Dunkeln auf zur Klinik, beinahe tot vor Angst. Ich ging zu Fuß, so langsam es irgend möglich war, zwei Haltestellen weit. Wie an den Tagen, an denen ich zum Zahnarzt gehen musste, hoffte ich, es würde ein Wunder geschehen, und ich fände die Praxis geschlossen vor, das Gebäude abgerissen, den Arzt gestorben, oder es gebe zumindest eine Stromunterbrechung, so dass die Turbine und die Lichter über dem Zahnarztstuhl nicht funktionierten. Aber niemals geschah ein Wunder. Der Schmerz erwartete mich dort in seiner ganzen Größe, mit seiner blutigen Aura. Die erste Schwester an der Grozovici, die mich spätnachts geimpft hatte, war schön, blond und sehr gepflegt, aber schon bald graute mir vor ihr. Sie war eine von denen, die sich deinen nackten Hintern total verächtlich anschauten. Nicht der Gedanke an den nun folgenden Schmerz, sondern der Überdruss jener Frau angesichts des Hinterns, mit dem sie nun eine intime Beziehung eingehen würde (und sei es nur das Einführen der Nadel in die Pobacke), erledigte umstandslos die leichte Erregung, und mein Geschlecht verzichtete auf die Anstrengung, den Kopf ein klein bisschen zu erheben, um besser sehen zu können. Dann wartete ich auf die unvermeidliche Befeuchtung der Hautpartie, die gemartert werden sollte, auf die drei, vier kurzen Schläge mit dem Handrücken, sodann auf den Schock der ins Fleisch gestochenen Nadel, stets mit der Sorge, dass sie keinen Nerv berühren möge, keine Vene, dass mir nichts Übles geschehe, nichts Dauerhaftes, das man im Gedächtnis behält, dann auch noch verschlimmert durch das Gift, das durch den Nadelkanal hinabfloss, um sich, Schwefelsäure, in der ganzen Pobacke auszubreiten. Es war grauenhaft. Nach den Impfungen durch die blonde Schwester hinkte ich noch eine ganze Woche.
Zum Glück wechselte sich diese im Bett mit ihren Liebhabern wahrscheinlich sadomasochistische Schwester in der Klinik mit einer anderen ab, die man, wiewohl aus anderen Gründen, ebenso schwer sollte vergessen können. Es war eine Frau, die einen beim ersten Anblick schon tödlich erschreckte, denn sie hatte keine Nase. Aber sie trug auch keinerlei Verband oder etwa eine falsche Nase, sie trug schlicht und einfach mitten im Gesicht ein großes rundes Loch, das vage in zwei Hälften unterteilt war. Sie war klein wie ein Küken, brünett, und hatte Augen, die vielleicht aufgrund ihrer Sanftmut deine Aufmerksamkeit erregt hätten, wenn ihr totenschädelartiges Gesicht dich nicht vollends aus der Fassung gebracht hätte. Wenn ich auf die Blonde traf, nahm diese mich sogleich ran. Durch den Warteraum fegte der Wind. Wohingegen die Zwergin ohne Nase ungewöhnlich erfolgreich zu sein schien: Bei ihr war das Wartezimmer immerzu gefüllt, voll wie die Kirche in der Auferstehungsnacht. Ich kehrte so gegen zwei Uhr nachts von der Klinik nach Hause zurück. Viele der Patienten, die darauf warteten, einzutreten, brachten ihr Blumen mit. Wenn diese Schwester in der Tür erschien, lächelten die Leute glücklich. Versteht sich von selbst: Wahrscheinlich hatte niemand je eine so leichte Hand. Wenn ich an der Reihe war, und sie mich mit heruntergelassener Hose auf das Wachstuch der Behandlungsliege setzte, betörte mich das Parfüm der Blumen, die, noch in Zellophan eingehüllt, sieben, acht an der Wand aufgereiht stehende Vasen füllten. Die auffallend brünette Frau sprach ruhig und gleichmütig auf mich ein, dann berührte sie einen Augenblick meinen Po mit der Hand, und … das war alles. Ich spürte die Nadel nicht, und das Einsickern des Serums in den Muskel erfuhr ich lediglich als leichte Erwärmung. In ein paar Minuten war alles vorbei, so dass ich fröhlich und glücklich heimkehrte. Die Eltern schauten mich argwöhnisch an: Hatte ich etwa wieder die Phiole weggeworfen, wohin auch immer?
Nun folgte das Melodia-Kino, sogar noch vor dem Lizeanu, und dann stieg ich an der nächsten Haltestelle, am Obor, um in eine Straßenbahn, die im rechten Winkel zur Ştefan cel Mare verkehrte, sie kam von der Moşilor und verlor sich tief im hintersten Colentina.
Ich kannte die Örtlichkeiten gut, in gewisser Weise war das meine Gegend. An der Piaţa Obor machte Mutter ihre Besorgungen. Als ich klein war, hatte sie mich mitgenommen in das Menschenmeer des alten Marktes. Die Fischhalle, die stank, dass man es nicht darin aushielt, dann die große Halle mit den unverständliche Szenen darstellenden Flachreliefs und Mosaiken, schließlich die Eisfabrik, vor der die Arbeiter stets mit in der Mitte weißen und an den Enden rätselhaft durchsichtigen Eisblöcken hantierten (als hätten diese sich in der sie umgebenden Luft fortwährend aufgelöst), waren für meine Kinderaugen phantastische Zitadellen aus einer anderen Welt. Dort, an der Hand der Mutter durch die Montagvormittagsödnis des Obor-Marktes gehend, sah ich das Plakat, das mich dann so lange verfolgen sollte, an einem Pfosten kleben: Aus einer fliegenden Untertasse kam ein riesiger Krake hervor und streckte seine Fangarme nach einem Astronauten aus, der über einen roten, mit Steinen übersäten Boden ging. Darüber stand Planet der Stürme. »Es ist ein Film«, sagte Mutter. »Warten wir, bis er näher bei uns gezeigt wird, im Volga oder im Floreasca.« Mutter fürchtete sich vor dem Stadtzentrum, sie verließ ihr Viertel nur, wenn sie nicht mehr anders konnte, wenn sie mir beispielsweise auf der Lipscani die Schuluniform mit dem Pepitahemd und den Hosen kaufte, deren Knie schon ausgebeult waren, als hätte sie bereits in der Fabrik jemand getragen.
Auch das Colentina-Viertel war mir vertraut, die zerfallenden Häuser auf der linken und die Stela-Seifenfabrik auf der rechten Straßenseite, wo die Wäscheseifen der Marken Schlüssel und Kamel hergestellt wurden. Der Gestank nach ranzigem Fett breitete sich von hier über das ganze Viertel aus. Es folgten das Gebäude der Weberei »Donca Simo«, wo Mutter einstmals an den Webstühlen gearbeitet hat, und danach ein paar Lagerschuppen mit Bauholz. Die elende und zutiefst deprimierende Straße strebte in der Sommerhitze unter den gewaltigen weißlichen Himmeln, die man nur über Bukarest zu sehen bekommt, weiter auf den Horizont zu. Eigentlich war ich dort geboren worden, im Colentina-Viertel, in der Vorstadt, in einer baufälligen Entbindungsstation, die man in einem alten Gebäude, das vor 1944 halb Spielhölle und halb Bordell gewesen sein mochte, eingerichtet hatte, und meine ersten Jahre lebte ich irgendwo auf der Doamna Ghica, in einem Straßengewirr, das eines jüdischen Ghettos würdig gewesen wäre. Viel später bin ich mit einem Fotoapparat dorthin zurückgekehrt, in die Silistra, und habe ein paar Fotos vom Haus meiner Kindheit gemacht, die nichts wurden. Diese Zone gibt es nicht mehr, sie ist vom Erdboden wegrasiert worden, mit meinem Haus und allem, was es dort sonst noch gab. Was steht jetzt an seiner Stelle? Selbstverständlich Wohnblocks, wie überall.
Als ich mit der Straßenbahn Nr. 21 jenseits der Doamna Ghica angelangte, geriet ich in ein fremdes Land. Die Häuser am Straßenrand wurden spärlicher, schmutzige Seen waren zu sehen, an denen Frauen mit gerafften Röcken Teppiche wuschen. Sodawasserläden und Brotzentren, Wein- und Fischläden. Eine leere, trostlose, unendliche Straße, siebzehn Straßenbahnhaltestellen, die meisten ohne ein Schutzdach und ohne Sinn, wie die Bahnstationen auf offenem Feld. Mütter in bedruckten Kleidern, je ein Mädchen an der Hand, die ins Nirgendwo gingen. Hin und wieder ein Pferdewagen, vollbeladen mit leeren Flaschen. Zentren für Gasflaschen, wo man abends schon für den nächsten Tag in der Schlange stand. Rechtwinklig abgehende Straßen, staubig wie auf dem Land, mit Maulbeerbäumen an den Rändern. Drachen, die sich in den elektrischen Stromkabeln zwischen den mit Teer bestrichenen Holzmasten verfangen hatten.
Nach eineinhalb Stunden des Schaukelns mit der Straßenbahn war ich an der Endstation. Ich glaube, ich war an den drei, vier letzten Haltestellen im Waggon allein geblieben. Ich stieg an einem großen Rondell aus, wo die Straßenbahnen wendeten, um neuerlich, sisyphosartig, über die Colentina davonzufahren. Der Tag neigte sich dem Abend zu, blieb aber bernsteinfarben und spektral, vor allem aufgrund der Stille. Hier, an der Endhaltestelle der Straßenbahn Nr. 21, war kein Mensch. Industriehallen mit schmalen Fenstern zogen sich lang und grau dahin, irgendwo, in einiger Ferne, ein Wasserschloss, und im Inneren des weiten Kreises, den die Straßenbahnschienen beschrieben, eine Obstwiese mit buchstäblich ruß- und abgasschwarzen Bäumen. Zwei leere Straßenbahnen ohne Schaffner, nebeneinander erstarrt. Ein geschlossener Fahrscheinkiosk. Starke Kontraste zwischen rosenfarbenem Licht und Schatten. Was suchte ich dort? Wie sollte ich an einem derart fernen Ort leben? Ich brach zu Fuß auf zum Wasserschloss, gelangte an seine Grundmauer, in der es eine Tür mit einem Vorhängeschloss gab, und schaute, den Kopf in den Nacken geworfen, hoch zu der Kugel, die am Ende des geweißelten Zylinders im Himmel glitzerte. Ich zog weiter nach … nirgendwo, in die Ödnis … Dort endete, wie mir schien, nicht die Stadt, sondern die Wirklichkeit. Eine Straße, die nach links abging, trug auf einem Täfelchen den Namen, den ich suchte: Dimitrie Herescu. Irgendwo in dieser Straße musste die Schule, musste meine Schule sein, mein erster Arbeitsplatz, an dem ich mich am 1. September einzufinden hatte, in mehr als zwei Monaten. Das grün und rosa gestrichene Gebäude einer Automechanik-Werkstatt konnte die dörfliche Atmosphäre des Ortes nicht zerstören: Häuser mit Wasserrinnen aus Hohlziegeln, Höfe mit vermoderten Zäunen, angekettete Hunde, Vorstadtblumen. Die Schule befand sich rechter Hand ein paar Häuser hinter der Automecanica und war selbstverständlich auch völlig verlassen.
Es war eine kleine Schule, ein Hybrid in Form eines L, mit einem alten Baukörper, dessen Wände rissig und dessen Fensterscheiben eingeschlagen waren, sowie im hinteren Teil des kleinen Hofes einem neuen Baukörper, der noch deprimierender aussah. Im Hof eine schiefe Tafel mit einem Basketballkorb ohne Netz am Ring. Ich öffnete das Tor und trat ein. Ich ging ein paar Schritte über den Asphalt des Hofes. Die Sonne hatte eben zu sinken begonnen, so dass eine Aureole von Sonnenstrahlen auf dem Dach des alten Gebäudes lag. Sie schossen von dort hervor, traurig, gewissermaßen schwarz, denn sie beleuchteten nichts, sondern mehrten nur noch die unmenschliche Einsamkeit des Ortes. Das Herz krampfte sich mir zusammen: Ich würde in diese wie ein Leichenschauhaus erstarrte Schule eintreten, den Klassenkatalog unter dem Arm, werde ich über die dunkelgrün gestrichenen Flure schreiten, werde hochgehen zum ersten Stock und in eine mir unbekannte Klasse treten, wo dreißig fremde Kinder, mir fremder, als wenn sie von einer anderen Spezies abstammten, auf mich warten. Vielleicht erwarteten sie mich eben nun, still in ihren Bänken sitzend, mit ihren hölzernen Federschachteln und den in blaues Papier eingeschlagenen Heften. Bei diesem Gedanken stellten sich mir die Haare an den Armen auf, und ich eilte fast schon im Laufschritt auf die Straße. »Ich werde ohnehin nicht mein ganzes Leben Lehrer bleiben«, sagte ich mir, während die Straßenbahn mich zurück in die weiße Welt fuhr, die Haltestellen zurückblieben, die Häuser dichter zusammenrückten, und wieder Menschen die Erde bevölkerten. »Nur längstens ein Jahr, bis man mich in eine Redaktion aufnimmt, bei einer Literaturzeitschrift.« Und die ersten drei Jahre Unterricht an der Schule Nr. 86 habe ich tatsächlich damit zugebracht, diese Illusion in mir zu nähren, so wie manch eine Mutter ihre Kinder lange über den Zeitpunkt hinaus stillt, an dem sie sie hätte abstillen müssen. Meine Illusion war so groß geworden wie ich selbst, und ich erbarmte mich immer noch nicht — und in gewisser Weise habe ich auch heute noch kein Erbarmen —, mir nicht wenigstens hin und wieder mal die Brust zu entblößen und ihr zu erlauben, mich genüsslich wie ein Kannibale zu zerfleischen. Die Jahre des Referendariats vergingen. Es werden etwa noch weitere vierzig Jahre vergehen, und ich werde von hier aus die Rente antreten. Schließlich war es bis jetzt nicht ganz so schlimm. Es gab lange Zeitspannen ohne Läuse. Nein, wenn ich es mir so recht überlege, es war nicht alles schlecht an dieser Schule, und was nicht so ganz richtig war, ist letztlich vielleicht auch zum Guten ausgeschlagen.
3
Mitunter verliere ich die Kontrolle über meine Unterarme und Hände. Ich habe deswegen keine Angst, manchmal könnte ich sogar sagen, es gefällt mir. Es geschieht unerwartet, glücklicherweise aber nur, wenn ich allein bin. Ich schreibe etwas, korrigiere Klassenarbeiten, trinke meinen Kaffee oder schneide mir die Nägel mit der kleinen chinesischen Nagelzange, und plötzlich spüre ich meine Hände ganz leicht werden, als wären sie angefüllt mit einem flüchtigen Gas. Sie erheben sich von alleine, ziehen mir die Arme aus den Schultergelenken in die Höhe und levitieren fröhlich in der dunkel glänzenden dichten Luft meines Zimmers. Dann werde auch ich fröhlich, ich schaue sie mir an, als sähe ich sie zum ersten Mal: lang und schmal, mit dünnen Knochen und wenigen schwarzen Härchen auf den Fingerrücken. Unter meinen verzückten Augen beginnen sie selbständig zu gestikulieren, elegant und bizarr, sie erzählen Geschichten, die Gehörlose vielleicht verstehen könnten. Dann bewegen sich auch meine Finger präzise, ja geradezu unfehlbar in Folgen unverständlicher Zeichen, die Finger der rechten Hand fragen, die der Linken antworten, der Ringfinger und der Daumen schließen sich zum Kreis, die kleinen Finger blättern etwas durch, die Gelenke schwingen mit dem grazilen Schwung eines Dirigenten um die eigene Achse. Ich müsste verrückt werden vor Angst, denn in meinem eigenen Kopf verdammt jemand diese so augenfällig qualifizierten Bewegungen, die sich verzweifelt nach Entschlüsselung sehnen, und doch empfinde ich nur selten ein solches Glücksgefühl. Ich betrachte meine Hände wie ein Kind, das man ins Puppentheater ausgeführt hat, und das nicht begreift, was auf der winzig kleinen Bühne passiert, das aber fasziniert ist von der Aufgeregtheit der Holzgestalten mit den Haaren aus Zwirnsfäden und Kleidern aus Krepp-Papier. Die selbsttätige Beseelung meiner Hände (Gott sei Dank passiert es nicht auch, wenn ich unterrichte oder mich auf der Straße befinde) legt sich nach ein paar Minuten wieder, die Gesten verlangsamen, beginnen den Fingerstellungen der indischen Tänzerinnen zu ähneln und hören dann ganz auf, aber ich kann mich noch zwei, drei Minuten lang des bezaubernden Eindrucks erfreuen, meine Hände seien leichter als die Luft, als hätte Vater statt der Luftballons am Gasrohr des Herds zwei Gummihandschuhe aufgeblasen, die mir nun die Hände vertreten. Und wie sollte ich es denn nicht bedauern, wenn meine echten Hände, brutal, schwer, organisch, schier enthäutet, mit den Muskelsträngen, den milchig weißen Sehnen und den Venen, in denen das Blut schäumte, wieder zurück in die Handschuhe aus Haut mit den Fingernägeln an den Enden schlüpften, und ich plötzlich zu meiner Verwunderung die Hände dazu bringen kann, sich so zu bewegen, wie ich es möchte, als könnte ich, allein indem ich mich konzentrierte, einen Zweig von dem Ficus auf der Schwelle abbrechen oder ohne jede Berührung die Kaffeekanne zu mir herüberziehen.
Später erst kommt die Angst. Erst nachdem diese Feerie (sie mag sich so etwa alle zwei bis drei Monate ereignen) zu einer Art Erinnerung geworden ist, beginne ich mich zu fragen, ob ich nicht unter so vielen anderen Anomalien meines Lebens — denn davon spreche ich — in der Selbsttätigkeit meiner Hände einen weiteren Beweis dafür besitze, dass sich alles im Traum abspielt … dass mein ganzes Leben traumlogisch abläuft oder etwas trauriger, schwerfälliger, verrückter, jedoch wahrer als jedwede Geschichte, die man sich irgendwann einmal ausdenken könnte. Das erheiternd-erschreckende Ballett meiner Hände, das stets hier in meinem Haus in Schiffsform auf der Maica Domnului stattfindet, ist der kleinste, der geringfügigste (weil letztlich auch harmloseste) Grund dafür, diese Seiten niederzuschreiben, ganz allein für mich, in der unglaublichen Einsamkeit meines Lebens. Hätte ich Literatur schreiben wollen, so hätte ich es vor zehn Jahren getan. Ich meine, wenn ich es wirklich gewollt hätte, ohne ein Bewusstsein von der damit verbundenen Anstrengung, etwa so wie man sich wünscht, einen Schritt zu tun, und dein Bein tut ihn. Du musst nicht sagen: »Ich befehle dir, den Schritt zu tun«, auch musst du nicht daran denken, welch komplizierte Prozesse dein Wunsch zu durchlaufen hat, bis er Tatsache wird. Du musst nur daran glauben und ein senfkorngroßes Zutrauen darein haben. Wenn du Schriftsteller bist, schreibst du. Die Bücher kommen, ohne dein Wissen davon, was du dafür zu tun hast, wie deine Gabe funktioniert, genauso, wie die Mutter für die Geburt gemacht ist und tatsächlich das Kind gebiert, das in ihrer Gebärmutter herangewachsen ist, ohne dass ihr Verstand an dem komplizierten Origami ihres Fleisches beteiligt gewesen wäre. Wenn ich Schriftsteller gewesen wäre, hätte ich Fiction geschrieben, bis heute hätte ich zehn, fünfzehn Romane verfasst, die mir nicht mehr abverlangt hätten als die Sekretion von Insulin oder der tägliche Nahrungsverkehr durch die beiden Öffnungen meines Verdauungsapparates. Ich aber habe damals, es ist lange her, als mein Leben noch unter unbestimmt vielen Orientierungen seine Wahl hätte treffen können, meinem Verstand geboten, Fiktionen zu schaffen, und es ist nichts geschehen, genauso, wie ich meinen Finger betrachten und ihm zurufen kann: »Beweg dich!«
Als Heranwachsender wollte ich Literatur schreiben. Ich weiß bis heute nicht, ob ich diesen Weg verfehlt habe, weil ich nicht wirklich ein Schriftsteller war oder aus schlichtem Unglück. Im Gymnasium hatte ich Gedichte geschrieben, ich habe immer noch irgendwo ein paar Hefte herumliegen, und von bestimmten Träumen her weiß ich, dass ich auch Prosa geschrieben hatte, ein großes Quartheft mit festen Deckeln voller Geschichten. Jetzt ist nicht der Moment, darüber zu schreiben. Dann ging ich zu den Rumänisch-Olympiaden, die an verregneten Sonntagen in unbekannten Gymnasien stattfanden. Damals war ich ein verstörter, beinahe schizophrener Knabe, der in den Pausen in den Schulhof ging, sich auf den Rand der Weitsprunggrube setzte und aus zerfledderten Büchlein laut Gedichte las. Wenn ich sprach, schauten die Leute durch mich hindurch, sie hörten mir nicht zu, ich war ein Dekorationsstück — und kein gelungenes — in einer riesigen, chaotischen Welt. Weil ich Schriftsteller werden wollte, entschied ich mich für die Aufnahmeprüfung in Philologie. Ich bestand problemlos im Sommer 1975. Zu jener Zeit war meine Einsamkeit total. Ich wohnte mit meinen Eltern in der Ştefan cel Mare. Ich las acht Stunden pro Tag und wälzte mich unter dem schweißnassen Leintuch im Bett von der einen auf die andere Seite. Die Buchseiten nahmen die immerzu sich verändernde Färbung der weiten Bukarester Himmel an, vom Goldschimmer der Sommermittage bis zum bedrückenden Dunkelrosa der Schneeabende im tiefsten Winter. Ich merkte nicht, wann es völlig finster wurde. Mutter fand mich im finsteren Zimmer, wenn die aufgeschlagenen Seiten mit den Buchstaben darauf praktisch einfarbig waren, und ich nicht mehr las, sondern davon träumte, dass ich in der Geschichte voranschritt und sie dabei den Gesetzen des Traums gemäß abwandelte. Dann kam ich zu mir, streckte mich, erhob mich aus dem Bett — tagsüber hatte ich es nur getan, um zum Klo zu gehen — und trat stets wieder ans große Fenster meines Zimmers, von dem aus man, hingestreckt unter phantastischen Wolken, ganz Bukarest sehen konnte. Tausende Lichter waren in all den weithin verstreuten Häusern eingeschaltet, in den benachbarten Villen konnte ich Leute sehen, die sich wie träge Fische im Aquarium bewegten, und viel weiter weg gingen bunte Neonreklamen an und aus. Was mich jedoch faszinierte, war der gewaltige Himmel über uns, eine höhere Kuppel, überwältigender als jedwede Kathedrale. Auch die Wolken vermochten es nicht, bis in ihre Spitze hochzusteigen. Ich legte die Stirn an die kalte elastische Fensterscheibe und verharrte so, ein Heranwachsender in einem in den Achselhöhlen zerrissenen Schlafanzug, bis Mutter mich zu Tisch rief. Dann kehrte ich zurück in die Höhle meiner Einsamkeit, tief unter die Erde, um bei eingeschaltetem Licht und in einem anderen, identischen Zimmer, das sich im Fensterspiegel weitete, zu lesen, bis mich die Müdigkeit überwältigte.
Tagsüber ging ich hinaus und spazierte in einem Sommer herum, der nicht mehr enden wollte. Zuerst suchte ich die zwei, drei Freunde auf, die ich niemals zu Hause antraf. Ich streifte durch unbekannte Straßen, fand mich in Stadtvierteln wieder, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab, verirrte mich zwischen Häusern, die aussahen, als wären sie Bunker auf einem fremden Planeten. Alte rosa Kaufmannshäuser mit Fassaden, überladen von Stuckengeln, die nun gottserbärmlich abgeschlagen waren. Niemals war da jemand auf den vom Gewölbe der alten Platanen eingefassten Straßen anzutreffen. Ich betrat die alten Häuser, ging durch die Zimmer voll kitschiger Möbel, stieg auf bizarren Außentreppen hoch zur nächsten Etage und entdeckte weiträumige leere Säle, in denen meine Schritte ungehörig laut klangen. Ich stieg in elektrisch beleuchtete Keller hinab, öffnete faulige Holztüren und gelangte in nach Erde riechende Gänge mit dünnen Gasrohren an den Wänden. An diesen Rohren klebten in einem ekligen Schaum langsam pulsierende Koleopteren-Puppen, mithin bildeten sich unter der festen Hülle die Flügel aus. Aus den Kellern anderer Häuser trat ich wieder ans Tageslicht, ich stieg andere Treppen hoch, betrat andere leere Räume. Manchmal landete ich in Häusern, die mir sehr vertraut waren, ich hatte mal in jenen Stuben gewohnt, hatte in deren Betten geschlafen. Wie ein von Nomaden geraubtes und nach Jahren der Entfremdung wiedergefundenes Kind ging ich schnurstracks auf die Servierkommoden zu, in denen ich das Fünfzig-Lei-Stück aus Silber wiederfand, das sie mir bei meinem ersten Bad in den Badezuber gelegt hatten, nunmehr so eingeschwärzt, dass man die Gesichtszüge des Königs auf der Kopfseite nicht mehr erkennen konnte, den Beutel mit der Haarlocke, die mir im Alter von einem Jahr abgeschnitten worden war, als ich auf dem kleinen Metalltablett mir angeblich den Bleistift ausgewählt hatte, oder meine armen Milchzähnchen, die komplette Garnitur, über die ich hier schon geschrieben habe. Immerzu herumstreunend, den ganzen Sommer 75, Tag für Tag durch die Straßen und Häuser der glühenden Stadt, lernte ich sie bestens kennen, wurden mir all ihre Geheimnisse und Schandbarkeiten vertraut, ihre Größe ebenso wie ihre Einfalt. Bukarest, das begriff ich damals im Alter von neunzehn Jahren, als ich schon alles gelesen hatte, war nicht so wie andere Städte, die sich im Laufe der Zeit entwickelten, indem sie großflächig Hütten und Schuppen niedergerissen und die von Pferden gezogenen Bahnen durch elektrische Straßenbahnen ersetzt hatten. Es war mit einem Mal und zugleich auch schon als Ruine da gewesen, zerbröselt, der Putz herabgefallen, die Nasen der Stuck-Gorgonen abgebrochen, die elektrischen Leitungen in melancholischen Bündeln über den Straßen hängend, mit einer fabelhaft variantenreichen Industrie-Architektur. Man hatte von vorneherein den Entwurf einer humaneren und aufregenderen Stadt gewünscht als etwa ein Brasilia aus Beton und Glas. Schmale Gassen waren von seinem genialen Architekten entworfen worden, offene Abwasserkanäle, seitwärts weggesackte, von Unkraut überwucherte Villen, Häuser, deren Fassaden komplett weggekippt sind, unbrauchbare Schulen und Kaufhäuser mit sieben schiefen und spektral angeordneten Stockwerken. Auch war Bukarest insbesondere als großes Freilichtmuseum angelegt worden, als ein Museum der Melancholie und des Niedergangs aller Dinge.
Es war die Stadt, die ich von meinem Fenster in der Ştefan cel Mare aus sah, und die ich, wenn ich es denn geschafft hätte, Schriftsteller zu werden, endlos beschrieben hätte, von einer Seite auf die nächste und von einem Buch ins nächste, menschenleer, aber voll von mir selbst, wie ein Netz von Gängen in der Epidermis irgendeines Gottes, in dem eine einzige, mikroskopisch kleine und durchscheinende Milbe mit Haarfädchen an ihren widerwärtigen Stümpfen haust.
Im Herbst zogen sie mich zur Armee ein, und neun Monate lang trieben sie mir all meine Gedichte und literarischen Flausen aus dem Kopf. Ich kann die modernisierte automatische Kalaschnikow auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Ich verstehe mich darauf, das Richtkorn mit dem Rauch eines brennenden Zahnbürstenstiels einzuräuchern, damit es auf dem Schießstand nicht in der Sonne glänzt. Ich habe winters bei zwanzig Grad Minus einzelweise zwanzig Patronen ins Magazin gepackt, bevor ich zum Wachdienst angetreten bin, um in Frost und Ödnis einen entlegenen Winkel der Militäreinheit von drei bis sechs Uhr früh zu bewachen. Ich bin mit aufgezogener Gasmaske und dem Dreißig-Kilo-Rucksack auf dem Rücken einen Kilometer durch den Dreck gekrochen. Ich habe Stechmücken ein- und ausgeatmet, fünf bis sechs pro Kubikzentimeter Atemluft im Schlafraum. Ich habe Klos und Fußböden mit der Zahnbürste geschrubbt. Ich habe mir die Zähne an den Kriegskeksen zerbrochen und aus meinem Napf Kartoffeln mitsamt Schale gegessen. Ich habe die Baumstämme in der Kaserne geweißelt. Habe mich mit einem Kameraden um eine Fischkonserve geprügelt. Ein anderer Kamerad war kurz davor, sein Bajonett in mich zu rammen. Neun Monate lang habe ich kein Buch, ja eigentlich keinen Buchstaben gelesen. Ich habe keinen Brief geschrieben und keinen bekommen. Nur Mutter hat mich alle zwei Wochen mal besucht und mir stets ein Essenspaket mitgebracht. Das Militär hat mich nicht männlicher werden lassen, es hat meine Introvertiertheit und Vereinsamung verzehnfacht. Ich wundere mich auch heute noch, dass ich es überlebt habe.
Das Erste, was ich nach meiner »Befreiung« im Sommer danach getan habe, war, eine Badewanne mit heißem Wasser anzufüllen, blau wie ein wertvoller Stein. Ich ließ das Wasser über die Sicherheitsrosette hinaus und bis an den Rand der Porzellanwanne ansteigen, sich auch leicht darüber hinweg wölben. Nackt stieg ich ins Wasser, das sich über den Fußboden des Baderaums ergoss. Es bekümmerte mich rein gar nichts, ich musste mich der Dreckschicht von neun Monaten Militärdienst entledigen, der einzig toten Zeit — wie ein toter Knochen — meines Lebens. Ich tauchte vollständig ein in die gesegnete Substanz, klemmte mir die Nüstern mit den Fingern zu und versenkte den Kopf tief in die Wanne, bis ich mit der Stirn den Fayenceboden erreichte. Ich blieb auf dem Wannenboden liegen, ein schmaler junger Mann, mit pathetisch unter der Haut hervortretenden Rippenknochen, der aus weit aufgerissenen Augen die kilometerweit über ihm stattfindenden Lichtspiele auf der Wasseroberfläche betrachtet. Ich verbrachte ganze Stunden in dieser Haltung, ohne das Bedürfnis zu atmen, bis sich eine dunkle Haut von mir abzulösen und geschmeidige Falten zu werfen begann. Ich habe sie auch heute noch, sie hängt über einem Bügel im Schrank. Sie wirkt, als wäre sie aus dünnem Kautschuk, und in ihrer Textur kann man ganz deutlich meine Gesichtszüge erkennen, meine Brustwarzen, mein im Wasser runzlig gewordenes Geschlecht, ja sogar die Abdrücke meiner Fingerkuppen. Es ist eine Dreckshaut, agglutinierter Dreck, verhärtet, grau wie die Knetmasse, in die man alle Farben hineingemengt hat: der Dreck der neun Monate beim Militär, die mich beinahe umgebracht haben.
4
Im Sommer, der auf die Armeezeit folge, und den ich mir, während der nächtlichen Schießübungen in den Unterständen kauernd, als Paradies einer unendlichen Freiheit vorgestellt hatte, ebenso wie das Zivilleben mit seiner mystisch-sexuellen Aura, das sich jedoch als genau so einsam und öde wie die vorangegangenen Sommer erwies — niemand geht ans Telefon und hebt ab, keiner zu Hause, tagelang niemand, mit dem man einen Satz wechseln könnte (außer meinen gespenstergleichen Eltern) —, schrieb ich mein erstes wirkliches Gedicht, das auch meine einzige, jemals herangereifte literarische Frucht bleiben sollte. Seit damals sollte ich für immer wissen, was Hölderlins Verse: »Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!/Und einen Herbst zu reifem Gesange mir …« einem mitzuteilen vermögen. Auch ich habe 1976 ein paar Monate, während ich Der Niedergang geschrieben habe, wie die Götter gelebt, und danach hat mein Leben, das sich mit größter Natürlichkeit zur Literatur hin hätte öffnen müssen, mit der Konsequenz, mit der man eine Tür öffnet, um in der verbotenen Kammer schließlich die tiefste Wahrheit über sich selbst zu erfahren, ganz plötzlich eine andere Wendung genommen, beinahe grotesk, wie man eine Weiche an einer Bahnstrecke umlegt. Ich wurde von Hölderlin zu Scardanelli, dreißig Jahre lang eingeschlossen in einem Turm oberhalb der Jahreszeiten.
Der Niedergang war kein Gedicht, sondern das Gedicht. Es war »jener einzige Gegenstand, durch den sich das Nichts selbst ehrt«. Das ultimative Produkt von zehn Jahren literarischer Lektüre. Zehn Jahre lang hatte ich zu atmen vergessen, zu husten, mich zu erbrechen, zu niesen, zu ejakulieren, zu sehen, zu hören, zu lieben, zu lachen, weiße Zellen zu produzieren, mich mit Antikörpern zu schützen, ich hatte vergessen, dass mein Haar wachsen und meine Zunge mit ihren Papillen Speisen schmecken musste. Ich hatte vergessen, an mein Schicksal hier auf Erden zu denken und mir eine Frau zu suchen. Ins Bett geworfen wie eine etruskische Statue auf ihrem Sarkophag, die Leintücher mit meinem Schweiß vergilbend, las ich bis an die Grenze zum Erblinden und zur Schizophrenie. In meinem Kopf gab es keinen Platz mehr für blaue Himmel, die sich im Frühling in den Pfützen spiegelten, auch nicht für die feine Melancholie der Schneeflocken, die an einem Gebäudewinkel in antikisierendem Rauhputz haften bleiben. Wenn ich den Mund aufmachte, sprach ich in Zitaten meiner bevorzugten Autoren. Wenn ich in dem sich rötlich kaffeebraun eindunkelnden Zimmer der Abenddämmerungen in der Ştefan cel Mare die Augen von den Buchseiten erhob, sah ich ganz deutlich die buchstabentätowierten Wände: Es waren Gedichte auf der Zimmerdecke, auf dem Spiegel, auf den durchscheinenden Blättern der Pelargonien, die in ihren Blumentöpfen dahinvegetierten. Ich hatte mir Verse auf die Fingernägel und auf die Handflächen geschrieben, mit Tinte auf den Schlafanzug und aufs Leintuch Gedichte geschrieben. Verängstigt ging ich zum Toilettenspiegel, wo ich mich ganz sehen konnte: Ich hatte mir mit der Nadel ins Weiße des Auges Gedichte geschrieben und Gedichte auf der Stirn stehen. Meine Haut war ganz kleinteilig tätowiert, manisch, in einer Handschrift, die ich nachvollziehen konnte. Ich war blau vom Kopf bis zu den Füßen, und ich stank so nach Tinte, wie andere nach Tabak stanken. Der Niedergang musste ein Schwamm sein und alle Tinte dieser einsamen Molluske aufsaugen, die ich war.
Mein Gedicht bestand aus sieben Teilen, welche die sieben Lebensetappen repräsentierten, sieben Farben, sieben Metalle, sieben Planeten, sieben Chakren und sieben abfallende Stufen vom Paradies in die Hölle. Es musste eine kolossale, eine versteinernde Kaskade zwischen Eschatologischem und Skatologischem, eine metaphysische Treppe abgeben, auf der ich Dämonen und Heilige, Gaffer und Sterndeuter, Sterne und Kröten, Geometrie und Kakophonie mit der unpersönlichen Strenge des Biologen platzierte, der den Stamm und die Verzweigungen der tierischen Gattung skizziert. Es war auch eine riesige Collage, denn in meinem Kopf gab es ein Puzzle an Zitaten, auch eine überschlagene Summe alles dessen, was man wissen konnte, ein Amalgam aus Patristik und Quantenphysik, Genetik und Topologie. Es war schließlich das einzige Gedicht, das das Universum als nutzlos erscheinen ließ, es ins Museum schickte, ebenso wie die elektrische Lokomotive die Dampflokomotive dorthin verwiesen hatte. Es bedurfte keiner Realität mehr, keiner Elemente oder Galaxien. Es gab den Niedergang, worin das Ganze in einer ewigen Flamme loderte und prasselte.
Diese Dichtung umfasste dreißig handgeschriebene Seiten, selbstverständlich schrieb ich damals alles auf diese Weise, denn mein Traum, eine Schreibmaschine zu besitzen, war nicht umzusetzen, und ich las die Seiten Tag für Tag, besser gesagt, ich tastete sie ab, überprüfte und staubte sie jeden Tag einmal ab, als handelte es sich dabei um eine seltsame Maschinerie aus einer anderen Welt, wer weiß, wie — durch den Spiegel — in unsere Welt gelangt. Ich besitze sie noch immer, auf den Originalblättern, auf die ich sie in jenem Sommer, in dem ich mein zwanzigstes Lebensjahr vollendete, geschrieben hatte, ohne jemals einen Buchstaben zu streichen. Sie sieht wie eine uralte Schrift aus, die in einem großen Museum unter einer Glasglocke und bei vorschriftsmäßigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten verwahrt wird. Auch diese Dichtung zählt zu den Artefakten, mit denen ich mich umgeben habe, und in deren Mitte ich mich wie ein Gott mit vielen Armen inmitten eines Mandalas fühle: die Milchzähne, die Schnur aus dem Nabel, meine blassen Zöpfe, die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Kindheit. Meine Augen aus der Kindheit, meine Rippen als Heranwachsender, später meine Frauen. Der traurige Irrsinn meines Lebens.
Im Herbst, ein heller Herbst, wie ich mich an keinen anderen erinnern kann, ging ich zum ersten Mal zur Universität. Im 88er Oberleitungsbus, während wir die Kosmodemjanskaja überquerten und auf die Batiştei zuhielten, sprudelte ich vor Glück wie Champagner: Ich war Student, was ich mir kaum je zu erträumen gewagt hatte, Philologie-Student! Von nun an würde ich jeden Tag das Zentrum von Bukarest sehen, das mir damals als die schönste Stadt der Welt vorkam. Fortan würde ich in der Herrlichkeit dieser Stadt leben, die sich pfauengleich aufplusterte mit dem Intercontinental, dem Nationaltheater, der Universität und dem »Ion Mincu«-Institut, dem Cantacuzino-Krankenhaus und den ihm folgenden vier vormundschaftlichen Statuen, wie hypnotische Augen mit wechselnden Wassern. Marienfäden funkelten in der Luft, junge Mädchen beeilten sich zu ihren Fakultäten, die Welt war neu und heiß, soeben aus dem Backofen hervorgeholt, und all dies gab es nur für mich! Das Fakultätsgebäude schien mir zu unmenschlichen Proportionen aufgetürmt: Die Marmorhalle kam mir wie eine Basilika vor, leer und kalt. Die weißen Steinplatten auf dem Schachbrett des Fußbodens waren abgenutzter als die schwarzen. Tausende Schritte hatten Vertiefungen in ihre wie Achat süßen Flächen getreten. Der Bibliothekssaal war ein mit Büchern vollgestopfter Schiffsbauch. Ich aber hatte sie schon alle gelesen, absolut alle, eigentlich hatte ich schon alle jemals geschriebenen Buchstaben gelesen. Und doch überraschte mich die Höhe jenes Saales: zwanzig Stockwerke tapeziert mit nummerierten Eichenregalen, die mit schmalen Leitern verbunden waren, auf denen Bibliothekarinnen mit Bücherstapeln auf den Armen auf und ab stiegen. Ihr Chef, ein unsympathischer, bärtiger junger Mann, stand zu jeder Uhrzeit wie ein Automat an seinem Pult und nahm die Bestellscheine der Studenten entgegen, die im vorderen Teil des Saales in der Schlange standen, und sortierte sie. An den Wänden lagen, wie in einem anderen Schloss, weitere Bücherstapel aufgereiht, die sortiert werden mussten und immerzu polternd umkippten, so dass die an den Tischen Sitzenden aufschraken.
Weil dies später mal in dieser Schrift, die Gott sei Dank kein Buch ist, lesbar oder auch nicht, von Bedeutung sein wird, möchte ich hier ein Detail einstreuen, und zwar, dass mir, als ich zum ersten Mal in den Bibliothekssaal trat — wo ich mir übrigens während meiner Studienzeit nicht arg viele Flöhe geholt habe, denn ich war nicht gewohnt, am Tisch sitzend zu lesen, sondern nur im Bett (ein Möbelstück, das mit dem Buch selbst wesentlicher Bestandteil meiner Lektüreausstattung war) —, plötzlich etwas einfiel, das ich nicht mehr loswerden konnte. In der Mitte des Saals befanden sich die Zettelkästen, massive Schränke aus dem vorigen Jahrhundert, voller Schubfächer mit handschriftlich in veralteter Schönschrift geschriebenen Karteikarten. Vor einem dieser Schränke kniete ich nieder, denn der Buchstabe V befand sich ganz unten, in der ersten Regalreihe über dem Fußboden, und wie Barten im Maul eines Wals schlug ich die Hunderte vergilbten, mit der Schreibmaschine geschriebenen Karteikarten mit dem Namen, dem Autor und anderen Angaben zum Buch um, immer mehr und immer nutzlosere Bücher, die auf dieser Welt geschrieben worden waren. Ganz hinten in dem Schubfach fand ich den Namen, den ich suchte: Voynich. Ich hatte nie gewusst, wie man ihn richtig schreibt, aber sieh an, hier gab es ihn.
Dieser Name hatte mir seit der sechsten Klasse in den Ohren geklungen, als ich zum ersten Mal beim Lesen eines Buches in lautes Schluchzen ausgebrochen war. Mutter hörte dies und eilte in ihrem lumpigen, nach Ciorbă riechenden Hauskittel herbei in mein Zimmer. Sie versuchte, mich zu beruhigen, zu trösten, glaubte, ich hätte Magenweh oder Zahnschmerzen. Schwerlich nur begriff sie, dass ich wegen des zerfledderten, auf den Teppich geschleuderten Buches weinte, eines Buches ohne Einband, dem auch vom Anfang her noch gut fünfzig Seiten fehlten. Viele der Bücher bei uns zu Hause waren so: auch das über Thomas Alva Edison und jenes über die Polynesier, auch Vom Nordpol zum Südpol. Vollständig und niemals gelesen waren allein (auch jetzt noch habe ich sie vor Augen) Schlacht unterwegs von Galina Nikolajewa und Wie der Stahl gehärtet wurde von N. Ostrowski. Zwischen den Schluchzern meines durch Tröstungen nicht zu mildernden Weinens erzählte ich Mutter etwas von einem Revolutionär, einem Monsignore und einem Mädchen, einer äußerst vertrackten Geschichte, die ich nicht recht begreifen konnte (zumal ich sie erst ab der Mitte hatte lesen können), die mich jedoch zutiefst beeindruckt hatte. Ich wusste nicht, wie das Buch hieß, und um die Autoren kümmerte ich mich damals ohnehin nicht. Am Abend, als Vater nach Hause kam und wie gewöhnlich seine Tasche auf dem Tisch liegen ließ (ich entnahm ihr stets die Sportul und die Scânteia, um die Sportartikel darin zu lesen), traf er mich mit rot verweinten Augen an, immer noch dachte ich an die Szene, in der der junge Revolutionär erfährt, dass sein Vater tatsächlich der verhasste Monsignore ist! »Was ist das für ein Buch, Liebling?«, fragte ihn Mutter bei Tisch, und Vater, nur noch in Unterhemd und Unterhosen, wie er stets zu Hause herumlief, sagte mit vollem Mund etwas, das nach »wohnlich« klang, worauf er »Die Rinderbremse« hinzufügte. Ja, der Junge war dort in Italien tatsächlich unter dem Namen »Rinderbremse« bekannt, ich aber wusste damals nicht einmal, was dieser Name zu bedeuten hatte. »So eine große graue Stechfliege mit Glotzaugen«, klärte Mutter mich auf. Niemals sollte ich jenen Abend vergessen, an dem ich vier Stunden am Stück wegen eines Buches, das ich eben las, geweint habe, ebenso war es mir zu keiner Zeit möglich gewesen, mehr über dieses Buch und seinen Autor in Erfahrung zu bringen. Eine erste Überraschung bestand darin, dass der Autor eigentlich eine Autorin war, nun konnte ich ihren Namen auf der Karteikarte lesen, Ethel Lilian Voynich, und daneben das Erscheinungsjahr der Bremse (The Gadfly): 1909. Ich verspürte einen kleinen Triumph, schließlich hatte ich eine beinahe zehn Jahre zurückliegende Geschichte aufgeklärt, tatsächlich aber hätte sich mein Frust verschärfen müssen. Damals wusste ich noch nicht, dass sich mit dem Namen, den ich im Karteikasten gesucht hatte — und für den mein damaliges Weinen eine Art merkwürdiger Vorahnung abgab —, zwei der wichtigeren Richtungen meiner Suchen verbinden sollten, denn das Unglück, kein Schriftsteller geworden zu sein, eröffnete mir auf paradoxe Weise, und ich hoffe, dies ist keine weitere Illusion, den Weg hin zum wahren Sinn meines Lebens. Ich habe keine fiktionale Literatur geschrieben, aber dies hat mich befreit, und zwar auf meine tatsächliche Berufung hin: in der Wirklichkeit zu recherchieren, in der Realität der Verstandeskräfte, des Traums, der Erinnerung, der Halluzinationen und in jeder anderen Realität. Wiewohl sie Angst und Schrecken verbreitet, befriedigt mich meine Suche voll und ganz, ebenso, wie es die eher verachteten oder nicht anerkannten Künste tun, die Flohdressur und die Zauberei.
Wie besessen stürzte ich mich in mein neues Leben. Ich hörte alte Literatur bei untauglichen Professoren und studierte Mönche und Novizen, die drei Zeilen in Altslawisch niedergeschrieben hatten, und selbst dies war im Gefolge fremder Kanonisierungen geschehen, denn man hatte die geschichtlichen Leerstellen einer Kultur zu rechtfertigen, die erst ziemlich spät zum Leben erwacht war. Aber was kümmerte es mich? Ich war Philologie-Student, wie ich es mir früher kaum zu erträumen gewagt hatte. Meine erste Seminararbeit über die versifizierten Psalmen war beinahe hundert Seiten lang. Sie war monströs, ging fast alles durch, was an Bibliographie vorhanden war, von Clément Marot bis zu Kochanowski, zu Verlaines Psalmen und jenen von Arghezi. Alle Gedichte, die ich in meiner Arbeit zitierte, hatte ich selbst in ihrer originalen Prosodie übersetzt …