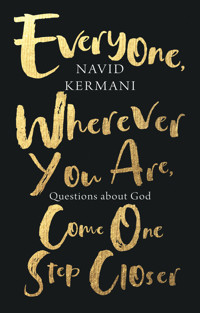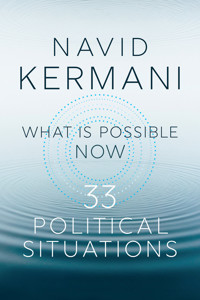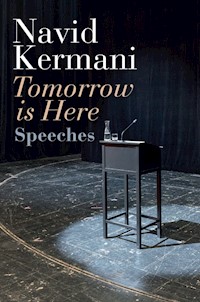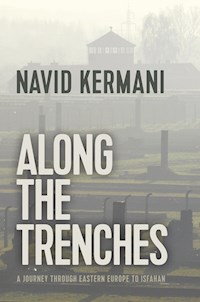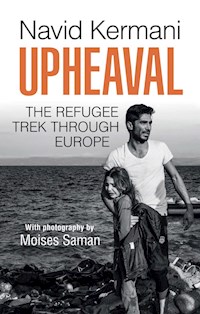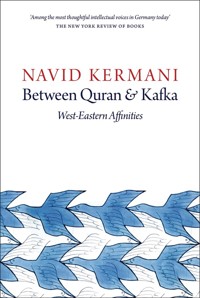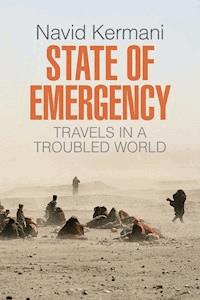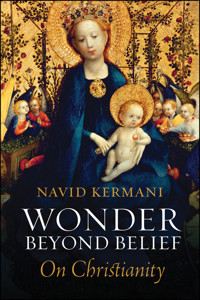16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie ist es, wenn sich die vertraute Welt auflöst, wenn das, was gestern noch normal war, heute nicht mehr gilt? Navid Kermani fängt diesen Moment in einem einzigen Sommer ein: Ein Freund, der zuletzt politisch auf Abwege geraten war, hat sich das Leben genommen. Die Kriege rücken näher und die Debatten werden schriller. Seine Freundin hält den Erzähler für einen Macho, aber das bleibt bei weitem nicht der schlimmste Vorwurf, der sein Selbstbild erschüttert. Auf unnachahmliche Weise gelingt es Navid Kermani, unsere Gegenwart aus ihren Widersprüchen heraus zu begreifen, das scheinbar Unversöhnliche zu versöhnen und, wichtiger noch, das wirklich Unversöhnliche auszuhalten. Ein existenzieller, hellsichtiger Roman unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Über das Buch
Wie ist es, wenn sich die vertraute Welt auflöst, wenn das, was gestern noch normal war, heute nicht mehr gilt? Navid Kermani fängt diesen Moment in einem einzigen Sommer ein: Ein Freund, der zuletzt politisch auf Abwege geraten war, hat sich das Leben genommen. Die Kriege rücken näher und die Debatten werden schriller. Seine Freundin hält den Erzähler für einen Macho, aber das bleibt bei weitem nicht der schlimmste Vorwurf, der sein Selbstbild erschüttert. Auf unnachahmliche Weise gelingt es Navid Kermani, unsere Gegenwart aus ihren Widersprüchen heraus zu begreifen, das scheinbar Unversöhnliche zu versöhnen und, wichtiger noch, das wirklich Unversöhnliche auszuhalten. Ein existenzieller, hellsichtiger Roman unserer Zeit.
Navid Kermani
Sommer 24
Roman
Hanser
Von einigen Begebenheiten der letzten Monate möchte ich berichten. Die erste ist der Freitod des Galeristen Rudolf Meyer, der seit einem Sturz Anfang des Jahres ans Bett gefesselt war: Als ich ihn anrief, um gelegentlich einer Veranstaltung in München meinen Besuch anzukündigen, antwortete er im selben halb spöttischen, halb liebenswürdigen Tonfall, in dem er oft sprach, daß das zu spät sei. Warum?, fragte ich. An dem betreffenden Tag sei er bereits tot. Auch wenn er nähere Angaben vermied und meinen Nachfragen auswich, dauerte es nicht lang, bis ich verstand, was er vorhatte. Ob ich sofort kommen dürfe, um ihn noch anzutreffen, fragte ich, ich könne mich noch heute in den Zug setzen oder morgen früh. Das sei nicht nötig, sagte Rudolf, vorgeblich oder tatsächlich besorgt um Aufwand und Kosten der Reise: Wir könnten uns auch zu einem längeren Telefonat verabreden. Weil ich darauf beharrte, ihn noch einmal zu sehen, einigten wir uns auf den Tag, der sich vor seinem Tod am besten zu meinen Terminen fügte — mehr, weil ihm daran gelegen war, meine Mühen gering zu halten, als daß ich Zeit sparen wollte, indem ich den Abstecher nach München mit einer anderen Veranstaltung in Süddeutschland verband.
Als ich eintraf, stellte sich heraus, daß es sein letzter Abend auf Erden war. Die Fügung, wenngleich er das Wort für übertrieben hielt, schließlich läge kein höherer Wille darin — die Fügung oder meinetwegen der Zufall war ihm bewußt gewesen, als wir uns verabredeten. Es störte ihn offenbar nicht, den Abend außer mit seiner Schwester und seinem Schwager auch mit mir zu verbringen, der ich kaum mehr als ein guter Bekannter war. Um meine Anwesenheit ersucht hatte er allerdings auch nicht. Ein anderer Tag wäre ihm genauso recht gewesen, und aus seiner Sicht hätte es ein Telefonat getan, wenngleich er im Laufe des Abends mehrmals seufzte, sich nun doch zu freuen, allein schon wegen der Unterhaltung und Abwechslung, die ich in sein Sterbezimmer gebracht hätte. So a liaba Bua, rief er, und fesch nannte er mich außerdem, nur weil ich mit Abstand der Jüngste in der Runde war und von meinem Vortrag noch das weiße Hemd trug. Guten Wein gab’s dazu und Leckereien, obschon er nur kostete. Zum Einschlafen wollte er Mozarts »kleine« g-Moll-Symphonie hören, also nicht die berühmte, sondern die frühe, mit gerade siebzehn Jahren komponiert; gern könne ich so lange bleiben. Am nächsten Morgen würde er die Tablette schlucken oder die Injektion in Gang setzen, durch die er aus dem Leben scheiden würde. Ich fragte nicht nach den genauen Umständen, weil der Arzt, dessen Beistand in einen juristischen Graubereich fiel, wohl um Verschwiegenheit gebeten hatte. Kurz sah ich ihn auch, also den Arzt, er schaute vorbei, um sich nach Rudolfs Befinden zu erkundigen und zu prüfen, ob er an seinem Vorhaben festhielt oder ihm auch nur die geringsten Zweifel gekommen wären. A woher denn!
Eigentlich wäre Rudolf schon einige Wochen zuvor gestorben, aber seine polnische Putzfrau, die nach dem Sturz zur Haushälterin, Pflegerin und Vertrauten geworden war, hatte es mit ihrem katholischen Glauben nicht vereinbaren können, tatenlos einem Selbstmord zuzusehen. Sie hatte den Arzt beiseite genommen und Zweifel bezeugt, die Rudolf geäußert habe. Der Arzt, den er nach zermürbender Suche endlich für sein Vorhaben gefunden hatte, erklärte daraufhin, er könne keine Sterbehilfe leisten. Bettlägerig, nur mit dem Handy ausgestattet, mußte Rudolf von neuem herumfragen, und war so wütend, daß er die Polin nicht nur entließ, sondern sogar enterbte. Ja, ein Teil seines Vermögens, das trotz der Insolvenz vor ein paar Jahren immer noch beträchtlich war — allein schon der Kunstbesitz —, wäre an sie gegangen, die sich aufopferungsvoll um ihn gekümmert hatte. Seine Frau, seine geliebte, stets gepriesene Frau, war vor einigen Jahren gestorben, Kinder hatten sie nicht.
Auch weil er als frommer — fromm gewesener? — Mensch die Gewissensnöte der Putzfrau doch verstehen mußte, erschien mir Rudolfs Reaktion sehr hart. Sicherlich, ich konnte den Zorn über die Eigenmächtigkeit nachvollziehen, den Eingriff in den Zentralbereich der menschlichen Autonomie. Aber daß er, der seinen eigenen, jüdischen Glauben bis hin zum Einhalten des Sabbats stets ernst genommen hatte, überhaupt keine Empathie für ihre Not zeigte, ja, sich noch am Vorabend seines Todes zu Beleidigungen und Flüchen verstieg, ließ mich an der Gelassenheit zweifeln, die er sonst an den Tag legte. Allein, wer würde in den letzten Stunden, die ein Gegenüber noch zu leben hat, sein Befremden erwähnen oder auch nur durch einen Blick andeuten? Und ehrlich gesagt, befremdete mich seine Gelassenheit noch mehr als die kurze Aufwallung.
Ich schreibe das alles auf, während ich aufs Mittelmeer blicke, einen Monat danach. Mein bisher letztes Buch habe ich vor meiner Abfahrt abgeschlossen. Jetzt liegen einige Wochen vor mir, in denen ich entweder bloß lesen oder ein neues Buch beginnen könnte. Das eine ist mir zu wenig, das andere zu früh. Nicht nur in Gaza geht das Sterben weiter, sondern auch in der Ukraine und im Sudan, um aus der Gegenwart nur die drei Kriege anzuführen, die ich aus eigener Anschauung kenne. Dem Westen droht nach dem Erfolg der Nationalisten bei der Europawahl Anfang Juni und dem möglichen Sieg bei den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und den Vereinigten Staaten nicht weniger als das Ende der liberalen Demokratie. In Iran hingegen, wo meine Gedanken mindestens so häufig sind, läßt die Zukunft, die bei den Protesten vor anderthalb Jahren bereits greifbar schien, weiter auf sich warten. Dies nur in Stichpunkten die Weltlage, in der ich einige private Erlebnisse der letzten Zeit festhalten möchte, allzu private vielleicht. Oder steht das eine mit dem anderen im Zusammenhang? Ja, bestimmt, schon weil das Private mit dem Politischen immer zusammenhängt und im Leben und Sterben eines Juden in Deutschland erst recht. Ich weiß nur nicht wie.
Als ich das Wohnzimmer betrat, in dessen Mitte das Krankenbett stand, war die Welt von einem auf den anderen Schritt wie ausgeblendet. Sie zählte nichts mehr, nicht mehr die Geiseln, nicht mehr das Gendern, nichts von den gesellschaftlichen Themen, zu denen sich Rudolf oft polemisch geäußert hatte, erschreckend polemisch mitunter. Dabei hatte er immer wieder darauf verwiesen, in der Studentenbewegung Ende der Sechzigerjahre politisch sozialisiert worden zu sein, und hielt sich selber nach wie vor für einen entschiedenen Linken, nicht für einen Rechten, als der er unter meinen Münchner Bekannten zuletzt galt. Entfremdet hatte er sich von den Genossen spätestens nach dem Anschlag während der Olympischen Spiele in seiner eigenen Stadt, als der Antisemitismus innerhalb der Bewegung nicht mehr zu ignorieren war. Für ihn begann ein langer Weg — kein Rückweg, denn er war nicht mit dem Glauben aufgewachsen — ein langer Weg zum Judentum, in dessen Praxis er sich zunehmend einfand, bis er schließlich auch Ämter innerhalb der Münchner Gemeinde übernahm. Daß die Koordinaten politischer Zuschreibung sich verschieben oder durcheinandergeraten, gehört ebenfalls zu der Lage, in der ich zu schreiben begonnen habe, und könnte später einmal als Symptom jener zunächst schleichenden, zunehmend jedoch eruptiven Auflösung des liberalen Gesellschaftssystems verstanden werden, die nach meinem Eindruck in den Jahren nach dem Mauerfall begann, also just im Triumph über den Kommunismus.
Auch wer Rudolf nicht aus der lokalen Kunstszene oder der jüdischen Gemeinde kennt, kann ihn googeln. Das ist ein bißchen mißlich, weil mein Bericht keinen dokumentarischen Grund hat wie eine Biographie oder ein Nekrolog, und ich mir erlaube, auch auf meine Phantasie zu rekurrieren, die für Leute wie mich genauso echt ist wie das äußere Geschehen. Ohnehin möchte ich nicht nur von öffentlichen Personen wie Rudolf Meyer berichten, mit dem begonnen zu haben ich bereits bereue, weil bei jedem Satz ein bestimmter Körper, ein Lebenslauf und nicht zuletzt die Insolvenz seiner Galerie hinzugedacht wird, nachdem er 2018 gegenüber einem Kunstkritiker Sympathien für die AfD bekundet hatte. Ich wünschte mir zum Beispiel, man würde sich Rudolf als einen großgewachsenen, beleibten, weißbärtigen Alten vorstellen, weil das eher zu dem Bärbeißigen wie zu dem Genießerischen paßt, das ihm zu eigen war — tatsächlich war er, wie auf den Photos zu erkennen ist, klein und dünn.
Ich könnte neu anfangen, also mit einer anderen Begebenheit. Doch zu den wenigen Gesetzen, die ich mir auferlegt habe — viel, viel weniger als in jedem meiner Bücher — gehört, daß ich, um dem Zufall ein ausreichend großes Einfallstor zu gewähren, strikt meiner Eingebung und den äußeren Einwirkungen gehorchen möchte, selbst wenn sie mich auf Abwege zu führen scheinen. Die Abwege sind für Leute wie mich im besten Fall Fügungen, auf die sie mit dem eigenen Verstand nie gekommen wären, und die Einwirkungen sind dadurch eingeschränkt, daß ich mich ans Meer zurückgezogen habe, wo ich mit dem Weltgeschehen lediglich durch Telefonate, das Radio und die mitgebrachten Bücher verbunden bin. In der Strandbar hängt außerdem ein Fernseher für die Fußball-EM. Nein, kein Internet, das ist für das Schreiben Gift, weil es zu viele Informationen enthält. Es bringt mich schon genügend aus der Fassung, heute morgen im Deutschlandfunk zu hören, daß die Regierung, eine linksgrünliberale Regierung, die Möglichkeit prüft, Asylanträge in Lagern außerhalb der Europäischen Union zu bearbeiten. Bereits jetzt würden Flüchtlinge von Partnerländern der EU in der Wüste ausgesetzt oder von griechischen Grenzschützern sogar ins Mittelmeer geworfen, also praktisch ermordet. Engagement für Flüchtlinge sei gelebte Mitmenschlichkeit, wird am selben Morgen die Entwicklungsministerin zitiert.
Ich erwähne das nicht, um Kritik zu üben. Wenn ich Politiker wäre und Sachzwängen ausgesetzt, würde ich womöglich ebenfalls manche Skrupel verlieren. Ich erwähne die heutigen Nachrichten, um mir selber klarzuwerden, wie weit sich die Koordinaten bereits verschoben haben in unserem politischen System. Noch vor drei, vier Jahren haben selbst konservative Zeitungen die australische Praxis, Bootsflüchtlinge mit militärischen Mitteln abzuwehren und auf Inseln zu internieren, mit Degout kommentiert. Undenkbar schien es, daß Europa diesem Modell folgen könnte in seiner Flüchtlingspolitik. Im Sommer 24 ist es nicht nur denkbar, sondern sogar absehbar geworden, daß wir uns ebenfalls Flüchtlinge in Ruanda oder Albanien fernhalten. Fällt auch noch Frankreich an den Ressemblement National und Amerika wieder an Trump, ist es um den Westen vermutlich geschehen, in dem ich geboren bin. Nicht, daß von einem auf den nächsten Tag alles anders wäre wie nach einer Revolution oder der Reichstagswahl von 1933. Aber wenn der Chauvinismus gleichzeitig in genügend und genügend großen Ländern herrscht, wird das liberale und globalistische System nicht mehr funktionieren, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat. Seine bisherigen Organisationsformen aus Nato, G7, EU, IWF, Weltbank wären blockiert, die Rechtsstaatlichkeit würde immer weiter untergraben, als erstes das Völkerrecht mitsamt der Internationalen Gerichtsbarkeit, Handelskriege brächen aus, der Klimawandel geriete endgültig außer Kontrolle, ein Großteil der Ukraine fiele an Rußland, China würde sich als neue Ordnungsmacht durchsetzen … vielleicht ist es ein Glück, daß unter den mitgebrachten Büchern Der Zauberberg, Doktor Faustus, die Erzählungen und vier Bände mit Reden und Aufsätzen von Thomas Mann sind, über den ich im Herbst eine Rede halten soll. Da bekommt man einen sehr guten Eindruck, wie so ein Ende geht, mag auch das Heranziehende weniger schlimm anmuten im Vergleich. Aber nur im Vergleich.
Unter meinen Bekannten steht Rudolf beispielhaft für die Abkehr vom Liberalismus, gerade was die Flüchtlingspolitik betrifft. Vor Jahren sprach er bereits davon, daß Flüchtlinge auf Inseln ausgeflogen oder Straftäter ungeachtet ihres deutschen Passes in ihr Herkunftsland abgeschoben werden sollten. Oder daß Europa seine Grenzen notfalls mit Stacheldraht und Schußwaffen schützen müsse, wenn es nicht vom Islam geflutet werden will, wie es Julien Green, der auch von mir bewundert wird, schon in den Neunzigerjahren gefordert habe (ich wollte es nicht glauben, aber es stimmt, diese und ähnliche Aussagen finden sich in Greens späten Tagebüchern zuhauf). Rudolfs Sympathie für mich schien das nicht zu tangieren, und die Winter verbrachte er weiterhin in seinem renovierten Haus in der Altstadt von Fès, wo er, um sein eigenes Bild zu verwenden, aus freien Stücken im Islam ertrank. Darauf angesprochen, antwortete er, daß die Synagoge in München rund um die Uhr von der Polizei überwacht werden müsse, nicht die Synagoge in Fès. Das Problem sei nicht der traditionelle Islam, sondern der Islamismus, der etwas ganz Neues, ja, ein neuer Faschismus sei, und das werde von seinen muslimischen Freunden in Marokko genauso gesehen.
Und umgekehrt? Tangierten seine Nähe zu einer, in meinen Augen, völkischen Partei, seine Ansichten zur Reproduktionsmedizin, sein Beharren auf der tradierten Geschlechterordnung oder seine Apologien Putins, Orbáns und Trumps meine Sympathie für ihn? Rudolf war ein viel zu komplexer Charakter, kunstsinnig, umfassend gebildet, vielsprachig, auch in seinen politischen Ansichten widersprüchlich und daher kaum so ausrechenbar, daß man ihn einfach als Reaktionär hätte abtun können. Die zunehmende Radikalisierung der israelischen Politik zum Beispiel bereiteten ihm Sorgen, weil für ihn klar war, daß am Ende Juden und Araber zusammen oder zumindest nebeneinander leben müssen, und zwar eher in einem Staat, weil ihm die Zweistaatenlösung durch die Siedlungen kaum noch praktikabel erschien. Innerhalb eines israelischen Kontextes — in dem er sich selbst jedoch bis zum siebten Oktober nie sah — hätte er damit vermutlich als Linker gegolten statt als Rechter. Einerseits schien es ihm regelrecht Freude zu bereiten, sich mir gegenüber im Sinne derjenigen zu äußern, die meine Kinder in Angst und Schrekken versetzen, weil sie ebenfalls ein »Herkunftsland« haben, in das man sie deportieren könnte. Wie gesagt, bei ihm spielte auch Provokation hinein, die Lust, mein vermeintliches Gutmenschentum herauszufordern. Andererseits vermute ich, daß er sich unter seinesgleichen noch extremer äußerte, als wenn jemand wie ich dabeisaß. Ich halte es nicht einmal für ausgeschlossen, daß er — als Jude! — sogar formell der AfD beigetreten ist, nachdem mit der Galerie auch sein Ruf ruiniert war. Bekanntlich hat die Partei eine eigene Gruppe jüdischer Mitglieder, und immer fürchtete ich, dort auf seinen Namen zu stoßen.
Ich erklärte nicht das Ende unserer Freundschaft — es war schon mehr als eine Bekanntschaft gewesen, jetzt, da ich darüber nachdenke, immer, wenn ich in München zu tun gehabt hatte, hatten wir uns gesehen, oder während der Art Cologne bei mir —, aber ich kündigte ihm meinen Aufenthalt in seiner Stadt auch nicht mehr jedesmal an. Einmal kam er trotzdem zu meiner Lesung, da lud ich ihn wie früher ein, mich zum Essen mit den Veranstaltern zu begleiten, und war froh, daß er statt dessen ein Treffen am nächsten Morgen vorschlug, das dann überraschend angenehm, ja, heiter verlief. Zur Art Cologne reiste er ohnehin nicht mehr an. Also haben wir uns seit seinem Ruin tatsächlich nur einmal getroffen, aber immerhin öfters und durchaus freundschaftlich telefoniert, ohne über Politik zu sprechen oder nur sehr allgemein. Nach dem siebten Oktober rief ich ihn an, dafür war er dankbar, es kam kurzzeitig zu einem neuen, jetzt geradezu innigen Austausch. Niemand habe sich gemeldet, sagte er, was in seinem Falle vielleicht noch erklärlich sei, weil er keine Verwandten in Israel habe, indes bei den anderen Mitgliedern der Gemeinde auch nicht, die sich in Deutschland seit langem nicht mehr so verloren, im Stich gelassen gefühlt hätten. Dieses ganze Menschsein à la Tabori — nur a Schmarrn. Er selbst habe plötzlich gespürt, geradezu physisch in den Nervenbahnen und Blutadern, während er Stunde um Stunde allein mit dem Internet saß, warum es den Staat Israel braucht, und sich ihm erstmals zugehörig gefühlt. Letztlich sei er für den Rest der Menschheit, sein Viertel in Fès vielleicht ausgenommen, wo allerdings kaum jemand von seinem Judentum wisse — letztlich sei er nur ein Jude, ein dreckiger Jude aus einem osteuropäischen Ghetto. »Schwarze Haut, weiße Masken«, wie Franz Fanon es beschrieben habe, dieser natürlich auf die Neger bezogen, ansonsten genau so, jüdische Sau, bayerischer Dialekt. »Neger«, dachte ich, Mann, Mann, Mann!, und daß es vielleicht besser war, daß ihn die Deutschen nicht mehr anriefen außer seine Freunde in der AfD, die er aber wahrscheinlich gar nicht hatte, die er sich nur herbeiphantasierte, um uns zu brüskieren. Auch sein Rechtsextremismus war ja nur a Schmarrn.
Ich erinnere mich, daß er einmal sagte, in Fès fühle er sich deswegen so wohl, weil er dort lediglich am Sabbat ein Jude sei. Aber mit Fès, mit der islamischen Welt, war es für ihn nach dem siebten Oktober vorbei. Er hoffe noch, sein Haus verkaufen zu können, sagte er in einem der Telefonate, jedoch auf lange Sicht, nein, schon sehr bald, hätte er als Jude unter Muslimen nirgends mehr einen sicheren Platz. Mit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs fürchtete ich, daß er recht behalten könnte. Auch unsere Verbindung brach rasch ab; seine Verweise auf Dresden, wo die Briten ebensowenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen hätten, oder auf Hiroshima und Nagasaki, wo die Atombombe den Krieg beendet habe, waren kaum zu ertragen für mich, der bei jedem Trümmerbild aus Gaza an die Menschen denkt, die er dort kennengelernt hat. Er wiederum fühlte sich wohl nun auch von mir alleingelassen mit dem siebten Oktober. Erst als ich von seinem Sturz hörte, schickte ich ihm Blumen und bat ihn, sich zu melden, sobald es ihm möglich sei. Bereits am nächsten Tag, kaum hatte die Krankenschwester die Blumen in eine Vase gestellt, rief er mich an: Mei liabs Persalein, du! Mann, Mann, Mann.
Der größte Widerspruch mit sich selbst aber war sein Tod. Zu dem Eklat vor ein paar Jahren gehörte schließlich nicht nur, daß er die extreme Rechte in Schutz genommen hatte. Noch schlimmer waren seine Äußerungen über die künstliche Befruchtung, die er derart »abartig« fand, daß ihm »Menschen, die im Reagenzglas zusammengemischt werden, eher wie Monster als wie vollgültige Menschen« vorkämen. Auch die Sterbehilfe lehnte er mit den Worten ab, »daß der Mensch nicht Gott spielen« dürfe. Die Idee, daß Erlösung leicht zu haben sein sollte, sei gefährlich und naiv. »Furcht und Schrecken sind essentielle Bestandteile des Lebens, ohne die wir unsere Kreatürlichkeit negieren und in einer oberflächlichen Welt versinken.« Das sagte Rudolf Meyer, der acht Jahre später Sterbehilfe in Anspruch nahm. Das Ende des liberalen Zeitalters, für ihn war es bereits geschehen.
Rudolf wäre der Ansicht gewesen, daß nicht seine Kritik an der Reproduktionsmedizin für den Niedergang stünden, vielmehr die öffentliche Meinung, die sich über die Gesetze der Schöpfung erhebt. Wie er seinen eigenen Selbstmord rechtfertige, fragte ich ihn am Vorabend nicht, obwohl er über halbe Stunden hinweg ganz klar war. Dann dämmerte er vom Morphin weg oder nickte mitten im Satz ein. Mir fiel auf, daß er das Judentum nicht einmal erwähnte und es auch keinerlei jüdische Insignien in seinem Wohnzimmer gab. Einmal sprachen wir darüber, was ihn nach dem Tod wohl erwarte, aber nicht einmal da kam viel, kaum mehr, als daß der Tod dem Leiden ein Ende bereite, gleich wie. Dabei sagte er selbst, daß die Schmerzen dank des Morphins erträglich und die letzten Wochen wegen des vielen Besuchs und der zärtlichen Fürsorge der Schwester oft sogar sehr schön gewesen seien, schöner als die meisten Tage seit dem Tod seiner Frau. Aber: Seiner Schwester und ihrer Familie könne er die Fürsorge nur zumuten, weil sie zeitlich begrenzt war. Und dann die Freunde, die früheren Bekannten und Kollegen, so viele hätten vorbeigeschaut, von denen er es nicht mehr erwartet hätte, die tiefen Gespräche, das gemeinsame Musikhören, die Freude, daß dir jemand vorliest, dazu der vorzügliche Pflegedienst Tag und Nacht, den er sich leisten könne, täglich der Lieferservice von Feinkost Käfer — er habe es sich gutgehen lassen zuletzt und rate jedem dringend, fürs Alter vorzusorgen, wenn Wohl und Wehe abhingen vom Ersparten. Allein, wenn er länger lebte, noch Jahre, würde er vereinsamen und verelenden. Unmöglich, auf Dauer seiner Schwester und ihrer Familie zur Last zu fallen, sie alle hätte ein Leben, hätten Arbeit, Termine und Sorgen, Sport, Urlaube, Kinder und Enkel. Auch den Pflegedienst müsse er beschränken, unbegrenzt seien seine Mittel nicht mehr, und er selbst könne sich nicht einmal ein Butterbrot schmieren. Er würde depressiv werden, ganz bestimmt. Nicht mehr käme jemand auf einen letzten, allein dadurch innigen Besuch so wie ich. Nur der Tod sei ein großer Versöhner, nicht das Siechtum. Und dann die Hygiene. Sein Körper würde vermodern einzig durch das vierundzwanzigstündige Liegen, die immer höhere Dosis Morphin würde seinen Verstand eintrüben. Nein, das sei keine Aussicht für ihn, nicht sterben zu dürfen wie meine Tante in Iran. Die Monographie über das Hadern mit Gott, in der ich ihre Qualen schildere, liebte er unter meinen Büchern immer am meisten, auch weil ich als Motto den Satz des Rabbi Jizchak von Berditschew vorangestellt habe, den Rudolf als Kind zuhause oft gehört: Nichts ist ganzer als ein gebrochenes Herz. Nur daß ihm »gebrochen« ein zu schwaches Wort zu sein schien. Tatsächlich heiße es im Jiddischen »tsebrakhn«, und das bedeute zerbrochen, also vollständig zerstört, was aber natürlich nicht bedeute, daß da nichts mehr sei. Ein Haufen von Zerbrochenem bleibe zurück, und zwischen den Splittern finde die Erlösung statt. Nicht nur besser, sondern vollkommen klar, daß er Schluß mache, solange er noch die Kraft dazu habe, den Willen und das Geld. Zumindest bis zum Tod Marlens, seiner Frau, habe er ein wunderbares Leben geführt und auch seither noch manches Entzücken gehabt. Guad is!