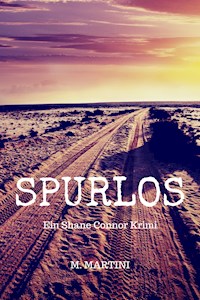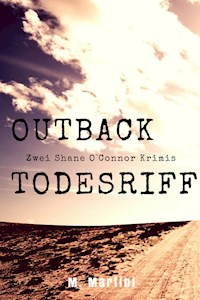Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Franziska kehrt an den Ort zurück, an dem das unfassbar Schreckliche geschehen ist. Vor einem Jahr hat sie während der Sommerparty am See ihren Freund umgebracht. Aber die entscheidenden Minuten sind in ihrer Erinnerung wie ausgelöscht. Warum nur ist dieser furchtbare Unfall passiert? Als Franziska Licht in das Dunkel bringen will, steht plötzlich ihr eigenes Leben auf dem Spiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Franziska kehrt an den Ort zurück, an dem das unfassbar Schreckli-che geschehen ist. Vor einem Jahr hat sie während der Sommerparty am See ihren Freund umgebracht. Aber die entscheidenden Minuten sind in ihrer Erinnerung wie ausgelöscht. Warum nur ist dieser furcht-bare Unfall passiert? Als Franziska Licht in das Dunkel bringen will, steht plötzlich ihr eigenes Leben auf dem Spiel.
Manuela Martini
Sommernachtsschrei
Jugendthriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2010 by Manuela Martini
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-316-8
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
1
Bleib, wo du bist, oder du wirst es bitter bereuen!
Schwarz auf weiß. Gedruckt auf einem gewöhnlichen Blatt Papier. Kein Absender auf dem Kuvert. Adressiert an Franziska Krause, ebenfalls gedruckt. Abgestempelt in München vor zwei Tagen.
Ich falte den Bogen wieder zusammen, stecke ihn in den Umschlag zurück und stopfe ihn in die Tasche meines Kapuzenpullis. Meine Finger zittern, als ich den Briefkasten zuschließe. Mit den drei Briefen für meine Eltern betrete ich den Aufzug, drücke siebter Stock und sehe mir im Aufzugspiegel in die Augen. Ich zucke zurück vor diesem panischen, flackernden Blick. Das bin ich nicht!, schreit meine innere Stimme.
Die Türen schließen sich. Ruckartig setzt sich der Aufzug in Bewegung. Ich will fliehen aus diesem neonlichthellen Gefängnis, weg, irgendwohin, wo mich keiner kennt und ich mir vormachen kann, jemand anders zu sein. Vorsichtig taste ich in meiner Tasche nach dem Papier, als hoffte ich, es wäre nicht da und ich hätte eben nur einen Albtraum gehabt. Aber die scharfen Kanten schneiden in meine Finger ...
Bleib, wo du bist ...
Ich zwinge mich, meinem Spiegelbild in die Augen zu sehen. Willst du dein ganzes Leben Angst vor dir und vor solchen Briefen haben?
Meine Hand zerknüllt das Papier.
Ich werde fahren.
Zwei Tage später sitze ich im Zug und bin unterwegs. Köln – Prien – Kinding. In Kinding ist es passiert. Vor genau einem Jahr. In Kinding ist mein Leben zerfallen in ein Davor und ein Danach.
»Versuch, dich zu erinnern, Franziska. Das ist deine einzige Chance, dich selbst zu verstehen«, sagte Dr. Pohlmann, die Klinikpsychiaterin, bei meiner Entlassung. Ich nickte. Und dachte daran, was andere – und auch meine Eltern – glaubten: »Wie gut, dass sie sich nicht erinnert, sonst wäre sie nicht so leicht aus der Sache herausgekommen.«
Ich tue, was Dr. Pohlmann sagt. Seitdem es passiert ist, versuche ich, mich an jene schreckliche Tat zu erinnern, die mein ganzes Leben verändert hat. Jeden Tag versuche ich, meinem Gedächtnis die düstersten Minuten meines Lebens zu entlocken. Ohne Erfolg.
Ich leide unter einem Posttraumatischen Belastungssyndrom mit Amnesien. Anders ausgedrückt: Ich habe etwas Schreckliches erlebt und etwas in mir weigert sich, die Erinnerung an einen bestimmten Moment freizugeben. Es sei ein Schutzmechanismus der Seele, der verhindert, dass ich mich an wichtige Teile des Traumas erinnern kann, sagt Dr. Pohlmann.
Mir fehlen Minuten. Die entscheidendsten meines Lebens.
Immer wenn ich die Augen schließe und mich an jene Minuten im letzten Sommer erinnern will, ist es, als wäre ich auf einem See und plötzlich umgibt mich dichter Nebel. Ich kann mich noch genau erinnern, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich meine Augen wieder geöffnet habe. Doch der entscheidende Moment verliert sich in jenem weißen, undurchdringlichen Nebel. Je verzweifelter ich versuche, ihm zu entkommen, umso dichter umschließt er mich.
»Du solltest nicht fahren«, sagte meine Mutter heute Morgen, als ich mit meiner Reisetasche in die Küche kam, um mich zu verabschieden. »Es ist doch genau vor einem Jahr passiert.«
Ich erwiderte nichts, dabei hätte ich sagen müssen: Gerade deshalb fahre ich. Übermorgen würde in Kinding die Sommerparty des Augustinus-Gymnasiums stattfinden. Wie jedes Jahr – und wie letztes Jahr. Da wohnten wir noch am Chiemsee, da ging ich noch auf dieses Gymnasium – und da war ich auf dieser Sommerparty gewesen.
Wochenlang habe ich überlegt, ob ich wirklich nach Kinding – in die Vergangenheit – fahren soll. Kann ich das wirklich durchziehen? Halte ich das aus? Und kann ich das meinen Eltern zumuten? Sie machen sich Sorgen um mich. Mein Vater hat, seitdem es passiert ist, Angina-Pectoris-Anfälle. Und meine Mutter leidet unter Schlafstörungen.
Von dem anonymen Brief habe ich weder meiner Mutter noch meinem Vater was gesagt.
Hinter dem Zugfenster zieht die Landschaft an mir vorbei. Wie mein Leben, denke ich. Ich bin Zuschauer geworden und fürchte mich, zurück auf die Bühne zu gehen, meine Rolle selbst zu bestimmen. Ich bin unsichtbar geworden. Und dann kam dieser Brief. Bleib, wo du bist, oder du wirst es bitter bereuen. Unwillkürlich gleitet meine Hand in die Tasche meines Kapuzenpullis. Ich habe es nicht geschafft, den zerknüllten Brief wegzuwerfen. Wer wusste eigentlich von meinem Plan, nach Kinding zu fahren?
Leonie, Maya und Vivian. Mit ihnen habe ich vor einer Woche telefoniert und gesagt, dass ich zur Sommerparty kommen wollte. »Willst du dir das wirklich antun?«, haben sie mich gefragt.
Sie waren die Einzigen aus meiner Schule, die zu mir standen, die mir Briefe in die Klinik geschickt haben, in der ich nach den beiden Wochen in Untersuchungshaft wegen meines Traumas behandelt wurde. Wenn die drei allerdings wussten, dass ich kommen würde, wusste es garantiert halb Kinding ...
Tja, so sind sie eben, meine Freundinnen. Wir fahren in einen Tunnel und im Zugfenster sehe ich mich lächeln. Ihre Schwächen haben etwas Liebenswertes bekommen, weil ich merke, wie sehr sie mir vertraut sind.
Ob ich ihnen von dem Drohbrief erzählen soll?
Der Zug taucht wieder aus dem Dunkel auf und ich blicke gespannt aus dem Fenster. Es ist eine Gewohnheit; jedes Mal, wenn ich aus einem Tunnel herauskomme, erwarte ich, in einer anderen Welt zu sein. Aber die Landschaft hat sich nicht verändert, die gleichen grünen Wiesen, die gleichen Hügel. Dasselbe Wetter.
Ich taste in meiner Jeansjacke nach dem Apfel. Meine Mutter hat ihn mir heute Morgen zusammen mit dem Käsebrot eingepackt. Sie wusste, dass ich mich nicht aufhalten lassen würde, dass ich nach Kinding gefahren wäre, selbst wenn sie und mein Vater es mir verboten hätten.
Manchmal glaube ich, dass sie Angst vor mir haben. Ich bin ihnen fremd geworden. Ihre einzige Tochter hat sie enttäuscht – das müssen sie nicht aussprechen, ich kann es in ihren stumpf gewordenen Blicken lesen, in ihrem Lächeln, das oft wie aufgesetzt wirkt.
Neulich abends, als ich wieder einmal nicht schlafen konnte, weil dieses Gedankenkarussell in meinem Kopf einfach nicht stillstehen wollte, habe ich mir in der Küche ein Glas Wasser geholt. Da habe ich aus dem Schlafzimmer die Stimme meiner Mutter gehört. »Was haben wir nur falsch gemacht? Warum ist sie so geworden?« Mein Vater hat geseufzt, dann hat er gesagt, dass er jeden Tag dafür betete, dass Kommissar Winter meinen Fall nicht noch einmal aufrollen würde.
Genau damit hatte mir Kommissar Winter nach meiner Entlassung gedroht. »So einfach kommst du nicht davon, Mädchen!«, hatte er gesagt und mir dabei fest in die Augen gesehen.
Er fühlte sich persönlich gekränkt, weil ich aus Mangel an Beweisen aus der Untersuchungshaft freigelassen werden musste. Als ich dann in der Klinik war, rechnete ich fast jeden Tag damit, dass er auftauchen und mich wieder verhören würde. Aber er war kein einziges Mal gekommen.
Hastig wende ich mich vom Zugfenster ab, als wir durch einen weiteren Tunnel fahren, als könnten sich dort seine kalten grauen Augen spiegeln und nicht meine. Ich weiß, dass das Unsinn ist, doch Kommissar Winter will einfach nicht aus meinen Gedanken weichen. Ich höre seine Stimme, so nah und deutlich, als würde er direkt neben mir sitzen und mir ins Ohr flüstern. »Tief in deinem Innern ist etwas, das die Tatsachen nicht sehen will, Mädchen. Glaub mir, das kommt öfter bei Tätern vor: Sie können und wollen nicht akzeptieren, dass sie es wirklich getan haben. Sie verdrängen die Tat so lange, bis sie von ihrer Unschuld überzeugt sind. Oder schlimmer noch – bis sie glauben, die ganze Welt hat sich gegen sie verschworen und will sie hinter Gitter bringen.« Immer und immer wieder hatte Winter mir diese Sätze gesagt. Einmal hatte dabei ein triumphierendes Lächeln auf seinen Lippen gelegen.
Ich kann nicht glauben, dass ich zu dieser Sorte gehören soll, aber was weiß man schon von sich selbst? Von seinen Abgründen, von dem Düsteren, Dunklen, das da irgendwo in den tiefsten Winkeln der Seele haust.
Deshalb bin ich unterwegs. Deshalb habe ich mich auf den Weg nach Kinding gemacht, denn solange ich diese Verstecke nicht erforscht habe, habe ich Angst, dass es wieder passieren könnte. Dass ich es wieder tun könnte. Mich quält dieses schwarze Loch in mir. Es fühlt sich an, als lebe dadrin im Verborgenen ein böses, wildes Tier, das nur auf eine Gelegenheit wartet, auszubrechen und sich auf ein neues Opfer zu stürzen. Ich fürchte mich vor mir.
Würzburg. Laut Fahrplan bleiben mir noch zwei Stunden bis Prien am Chiemsee. Mehrere Leute steigen zu, ein älteres Pärchen mit Rucksäcken und Teleskopstöcken sucht sich einen Fensterplatz auf der anderen Gangseite. Wandern fand ich immer langweilig, aber während der Zeit im Gefängnis hab ich mich plötzlich danach gesehnt, auf einen hohen Berg zu steigen und vom Gipfel aus in eine grenzenlose Weite zu schauen. Ein junger Asiate mit Reiseführer in der Hand geht an meinem offenen Abteil vorbei, zögert kurz, setzt sich aber dann doch woandershin. Ich atme auf.
Die Tage im Knast haben mich empfindlich gemacht. Fünf Meter hohe Mauern mit Stacheldraht, vergitterte Fenster, Eisentüren. Selbst wenn am Morgen die Zellen aufgeschlossen wurden, blieb das Gefühl der Enge. Und am Abend dann wieder das Klappern der Schlüssel, das kalte, metallische Klicken, wenn die Tür ins Schloss fällt. In engen Räumen fürchte ich zu ersticken und Körpernähe macht mich nervös. Auch die Monate in der Traumaklinik, in der ich nach der Untersuchungshaft in einem Einzelzimmer untergebracht war, konnten die Gefängniszeit nicht auslöschen.
Endlich fährt der Zug wieder an. Stillstand kann ich kaum noch ertragen. Ich liebe es, stundenlang spazieren zu gehen. Wenn ich über längere Zeit in einem Raum sein muss, fange ich irgendwann an, auf und ab zu gehen, wie die im Zoo eingesperrten Tiger und Löwen.
Meine Schrift ist krakelig, aber ich habe keinen Platz mehr an einem Tisch bekommen, also muss ich das Schreibheft auf die Knie legen, es geht nicht anders. Dr. Pohlmann hat gesagt, dass es mir helfen könnte, wenn ich die Sachen, an die ich mich erinnere, aufschreiben würde. Wenn ich überhaupt schreiben würde. Meine Gedanken ordnen. Das Karussell anhalten.
Gleisanlagen, Industriebauten ziehen vorbei. Regentropfen klatschen an die Zugfenster. Ich betrachte sie, wie sie in viele kleine zerspringen und am Glas herunterrinnen wie unzählige Tränen, bis der Wind sie schließlich wegwischt.
Die ersten Tage im Gefängnis habe ich jeden Tag geweint. Doch dann hörte es auf. Ganz plötzlich. Es war, als wäre in meinem Innern etwas zerbrochen und als könnte ich danach keinen Schmerz mehr empfinden. Als könnte ich überhaupt nie wieder irgendwas empfinden.
Sie mieden mich, die Mädchen, die auf ihren Prozess wegen Ladendiebstahl, Raub oder Sachbeschädigung warteten, manche hatten sogar Angst vor mir. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern. Das war der schlimmste. Ich wurde von den Mädchen gemustert, jeder Schritt, jedes Wort, jede Handbewegung wurde genau registriert. Denn schließlich hatte ich ja etwas viel Schlimmeres getan.
Ich mochte nur eine. Katie. Sie hat nie erzählt, weshalb sie saß. Sie sagte überhaupt nur sehr, sehr wenig. Aber jeder Satz hat mich zum Nachdenken gebracht.
Dann wurde ich taub. Hörte nicht mehr die Gespräche meiner Zellengenossinnen über ihre Ängste, dass sich ihre Freunde eine andere suchten, oder über Stars, deren Affären sie begierig in abgegriffenen Zeitschriften verfolgten. Währenddessen lag ich auf meinem Bett und grübelte.
Immer wieder wurde ich befragt, immer wieder habe ich dieselben Antworten gegeben. Und immer wieder stieß ich dabei auf das große schwarze Loch, die Frage, warum ich mich nicht mehr erinnern kann.
Nachdem es passiert ist, sind meine Eltern von Kinding nach München gezogen. In ein anonymes Hochhaus am südlichen Stadtrand. Ihre Tochter mache eine Ausbildung, haben sie erzählt, wenn Nachbarn nach Kindern fragen.
In den ersten Tagen nach meiner Entlassung aus der Klinik habe ich mein Zimmer überhaupt nicht mehr verlassen. Dabei hatte ich mich so nach dem freien Himmel über mir gesehnt. Aber ich hatte Angst vor den Menschen, vor ihren Blicken, vor ihren Bewegungen, ich hatte panische Angst, auf der Straße angesprochen zu werden. Jede Minute fürchtete ich, dass sich eine Hand auf meine Schulter legte und jemand zu mir sagte: Du gehörst doch hinter Gitter!
Vor drei Monaten hat mein Vater einen neuen Job in Köln gefunden. Seitdem wohnen wir dort. Wieder in einem anonymen Wohnblock, als müssten meine Eltern sich mit mir ihr Leben lang verstecken.
Endlich, nach Stunden, so kommt es mir vor, dabei können nur Minuten vergangen sein, sind keine grauen Gebäude mehr zu sehen. Die Landschaft, die jetzt am Zugfenster vorbeifliegt, ist üppig grün. Ein verregneter Sommer. Hoffentlich fällt das Sommerfest am See nicht ins Wasser, denke ich.
In den Tagen im Gefängnis, als ich den Himmel nur als Quadrat über dem Hof und durch die Eisengitter der Zelle gesehen habe, wünschte ich mir oft, im Freien in einer grünen Landschaft zu stehen und mich vom Regen durchweichen zu lassen. Eines Morgens schrieb ich den Song. Er kam wie von selbst.
Raindrops are fallingOutside not hereI wish I were thereWhere rivers flowAnd the wind whistlesOur song
A sunray is fallingInto my prison cell.Do you still rememberThe color of my eyes?The sound of my voice?Time is the enemy.
Ich sang den Song ganz leise, wenn ich nicht schlafen konnte, auch später in der Klinik, und ich singe ihn immer noch. Er hilft mir zu überleben.
Ich schließe die Augen. Sie brennen. Ich schlafe ja kaum.
Vielleicht haben wir uns gestritten? Oder es waren der Alkohol und diese verfluchte kleine Pille? Ich kann mich nicht erinnern.
Die Nacht der Sommerparty. Maurice und ich. Dann sehe ich alles vor mir, wie Schnappschüsse in einem Fotoalbum. Maurice und ich im Bootshaus. Das Boot schaukelt im Wasser, auf dem sich glitzernd das Mondlicht spiegelt. Seine Hände in meinem Nacken. Sein Gesicht, das sich langsam dem meinen nähert. Der Kuss. Schließlich hebe ich das schwere, alte Holzruder auf – wir wollen mit dem Boot auf den See. Dann der dumpfe Schlag.
Und dann ... ja, dann folgt das große schwarze Loch, der aus meinen Erinnerungen ausgestanzte Moment.
Als ich wieder zu mir komme, halte ich noch immer das Ruder in der Hand. Und vor mir liegt Maurice, mit dem Hinterkopf an die Bootswand geschlagen. An der Schläfe eine blutende Wunde, die ich ihm mit dem Ruderblatt zugefügt habe.
Seine Augen sind leer.
Ich habe Maurice umgebracht.
2Vergangenheit
Ich bin ihm das erste Mal an meinem zweiten Tag in der neuen Schule begegnet. Eigentlich wollte ich nach dem ersten Tag schon gar nicht mehr dorthin. Das in Kinding war einfach eine andere Welt, in die ich definitiv nicht hineinpasste. Die Welt von D&G, Lacoste, Hilfiger und Co.
Keiner trug H&M-Jeans wie ich. Wirklich keiner. Ich kam mir vor, als hätte ich statt Klamotten Kartoffelsäcke an.
Keiner hatte ein so unschickes Handy wie ich – ein Nokia, das man zwar nicht gerade als altmodisch bezeichnen konnte, aber es war kein iPhone und auch kein BlackBerry.
Nie im Leben habe ich mich so sehr zweiter Klasse gefühlt wie an dieser Schule. Für die meisten war ich einfach Luft.
Aber meine Noten, besonders in Physik und Mathe, waren so gut, dass mich meine Eltern unbedingt auf die Schule mit den besten Lehrern schicken wollten. Tja, und das war nun mal leider das Augustinus-Gymnasium.
Er fiel mir also auf, als ich am Morgen über den Schulhof ging. Die Sonne schien, es war Frühsommer und die Luft roch nach Heckenrosenblüten und war noch ein bisschen feucht von der Nacht. Wir hatten in der ersten Stunde Geschichte und ich hoffte, dass sie hier im Unterricht nicht weiter waren als an meiner alten Schule. Meine Eltern erwarteten, dass ich meine Zwei halten konnte ...
Daran dachte ich, als er plötzlich da war – inmitten all der Gesichter sah ich auf einmal sein Gesicht. Dunkle Locken fielen ihm in die Stirn und seine Augen sahen direkt in meine, als hätte er nur auf mich gewartet. Um uns herum tobten und lachten und redeten alle, nur wir waren still und sahen uns an. Ich hatte das Gefühl, als würde die Zeit stehen bleiben, als würden seine Augen mich in sich hineinziehen, an einen Ort, nach dem ich so lange gesucht hatte.
Das war Quatsch, das wusste ich, aber trotzdem, in dem Moment empfand ich es genau so. Wir mussten uns schon früher begegnet sein. In einem anderen Leben.
Und dann wurde mir plötzlich bewusst, dass ich inmitten einer Menge Leute stand, die mich abschätzig grinsend musterte. Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss, und mein Gesicht fühlte sich knallrot an. Schnell wandte ich den Blick ab und hastete an ihm vorbei, die Augen fest auf meine Sneakers geheftet, die mir auf einmal viel zu alt und schmutzig vorkamen.
Du bist total bescheuert, Franziska!, schimpfte ich mich. Glaubst du wirklich, dass dieser Typ sich ernsthaft für dich interessieren würde? Er trägt wie alle anderen Designer-Jeans, die neuste Ray Ban und sein Hemd sieht auch verdammt teuer aus! Was soll so einer an dir schon finden?
Erleichtert atmete ich auf, als ich ihn in ein anderes Klassenzimmer gehen sah. Er war in der Parallelklasse. Gott sei Dank.
Trotzdem musste ich an diesem Tag dauernd an ihn denken. In der Pause lief ich quer über den Schulhof und hielt nach ihm Ausschau, konnte ihn aber nirgendwo mehr sehen. Am Nachmittag konnte ich mich kaum auf meine Hausaufgaben konzentrieren. Du spinnst, sagte ich mir, schlag ihn dir aus dem Kopf! Warum sollte er sich für dich interessieren, wo doch alle anderen Mädchen in deinem Alter viel besser aussehen! Sie hatten coolere Klamotten, waren schlanker, größer und blonder, sie hatten längeres Haar, längere Beine und waren perfekt geschminkt. Wenn ich in den Schulstunden saß und die Mädchen im Klassenzimmer verstohlen musterte, kam ich mir plump, hässlich und unreif vor. So miserabel hatte ich mich noch nie vorher gefühlt.
In meiner alten Schule war ich einfach der Durchschnitt gewesen. Kaum eine meiner Freundinnen kam geschminkt in den Unterricht oder trug irgendwelche teuren Klamotten. Wenn jemand mit dem Auto zur Schule gebracht wurde, dann mit normalen Kombis oder Kleinwagen. Aber hier in Kinding fuhren irgendwelche fetten Mercedes oder Geländewagen vor, immer blitzeblank poliert, nicht selten waren eine Tasche mit Golfschlägern und ein Labrador im Kofferraum.
Ich kam mit dem Fahrrad. Einem Mountainbike wenigstens, auch wenn es nicht mehr das neuste war. In meinem Alter hatten viele hier Motorroller oder ein Motorrad. Hätte ich auch gern gehabt. Aber meine Eltern fanden, dass Steuer und Versicherung viel zu teuer wären. Ich überlegte sogar, mir einen Job zu suchen, um mir einen Motorroller kaufen zu können. In den Sommerferien – wenn die anderen nach Sardinien oder Florida oder in die Schweiz fuhren ...
Er hieß Maurice, wie ich am darauffolgenden Morgen erfuhr, als ich mein Rad vor dem Schulhof abschloss. Er war aus einem schwarzen Mercedes-Allrad-Geschoss ausgestiegen und kam zu Fuß den Gehweg zum Schultor entlanggeschlendert, die Lacoste-Umhängetasche baumelte lässig über seiner rechten Schulter. »He, Maurice!«, riefen zwei Jungs, die gerade ihre Motorroller abstellten.
Ich nestelte an meinem Schloss herum, um dann »zufällig« aufzublicken, wenn er nah genug bei seinen Freunden angekommen wäre. Nicht rot werden!, befahl ich mir, zählte stumm bis fünf und hob schließlich den Kopf. Doch da hatte er sich schon umgedreht und ging mit seinen Freunden über den Hof zum Schulgebäude.
Ich ärgerte mich unheimlich über mich selbst. Warum hatte ich hier nur solche Hemmungen? An meiner alten Schule, in meinem alten Leben hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich es wert war, einen Jungen anzuschauen. Aber hier war alles um mich herum glänzender, größer, schöner, wichtiger, erfolgreicher ... und ließ mich dafür umso kleiner, hässlicher und losermäßig erscheinen.
Niedergeschlagen stapfte ich ins Schulgebäude.
Warum haben meine Eltern ausgerechnet hierherziehen müssen?, dachte ich wütend.
3
Ist da frei?«, schreckt mich eine Stimme auf.
»Ja«, sage ich, ohne aufzusehen, hoffe, dass er sich weder neben mich noch direkt gegenüber ans Fenster setzt. Er nimmt den Gangplatz schräg gegenüber von mir.
»Schriftstellerin, was?« Er deutet auf mein Schreibheft.
Ich sehe ihn an, ohne ihn wirklich zu sehen.
»Sorry, tut mir leid!« Er ist sofort ernst geworden und macht eine beschwichtigende Handbewegung. »Ich wollte nicht ...«
Ich wende mich von ihm ab und er spricht nicht weiter.
In meinem früheren Leben, ich meine, bevor das alles passiert ist, wollte ich immer nett und freundlich zu allen sein, wollte dazugehören. Was hätte ich darum gegeben, so zu sein wie meine Freundinnen! Jetzt ist es mir egal, was andere über mich denken.
Wenn du versuchst, so zu sein, wie die anderen dich haben wollen, gibst du ihnen bloß Macht über dich. Das war einer der wenigen Sätze, die Katie immer gesagt hatte.
Katie lachte nie. Ihr Haar war büschelweise ausrasiert und sie hinkte. Dabei fehlte ihr nichts, behauptete die Ärztin.
Mit dem Hinken und der räudigen Frisur hat sie ihre Grenze verteidigt, die sie um sich gezogen hat, glaube ich. Das hielt alle fern.
Der Regen hat aufgehört. Draußen hinter den Scheiben zeigen sich jetzt ausgedehnte gelbe Getreidefelder und Autos rollen wie Spielzeug auf der Straße, die den Schienen folgt. Ich nehme alles in mir auf, sauge es ein in diese weite, hungrige Leere.
»Entschuldigung, ich wollte wirklich nichts Falsches sagen«, kommt es wieder von dem Jungen, der mir schräg gegenübersitzt.
Ich habe ihn ganz vergessen und betrachte ihn nun genauer, während er mich genauso unverhohlen mustert wie ich ihn. Sein blondes Haar reicht ihm fast bis auf die Schultern und fällt ein Stück über seine Augen. Seine Haut ist sonnengebräunt, sein Poloshirt verwaschen, am Handgelenk trägt er ein Lederband und mehrere bunte Bänder und am Mittelfinger einen breiten silbernen Ring. Die Finger ruhen auf den Tasten seines Notebooks. Plötzlich treffen sich unsere Augen und mein Herz beginnt einen Moment lang schneller zu klopfen. Schnell wende ich den Blick ab.
Blau. Nicht braun. Zum Glück.
Maurice hatte dunkelbraune Augen. Maurice ... wenn ich an ihn denke, krampft sich in mir alles zusammen.
»Sprichst du Deutsch?«, fragt er, ohne zu lachen, und sieht von seinem Notebook auf.
Er meint es ernst, kann es wohl nicht ertragen, wenn man sich nicht mit ihm unterhält, dabei gibt er sich doch solche Mühe.
»Immer noch, ja«, antworte ich.
Er lacht, verstummt wieder. Sieht mir in die Augen.
»Ich heiße Benjamin.« Er räuspert sich. »Wenn du willst ... ich meine, du musst ja nicht ... dann kannst du mir auch ... äh ... deinen Namen sagen.«
»Paula«, lüge ich. Habe ich mir angewöhnt. Mit einem falschen Namen kann ich mich unschuldig fühlen.
»Paula? Schöner Name.« Dann weiß er nicht weiter.
Erstaunlich, wie schnell man manche Menschen verunsichert, wenn man nicht so reagiert, wie sie es erwarten.
Hi, ich heiße Franziska. Meine Freunde nennen mich Ziska. Was machst du, Benjamin? Du fährst nicht zufällig auch nach Prien, in die Provinz, was? Welche Musik hörst du? Echt cool ... blablabla ...
Fahrerwechsel. Fahrkarten vorzeigen. Meine Hand zittert, als ich der Zugbegleiterin meine Karte gebe. Sofort denke ich an die morgendlichen und abendlichen Appelle, als man sich vor seiner Zellentür aufstellen musste und durchgezählt wurde.
Man ... ich schreibe schon wieder man. Dr. Pohlmann hat mir erklärt, dass ich das tue, weil ich mich damit distanzieren will, von der Person, die das alles durchgemacht hat. »Versuche, diese Person anzunehmen und zu lieben, egal, was sie getan hat. Erst dann kannst du wieder leben«, hat sie zu mir gesagt.
Ich kann mich nicht annehmen. Ich fürchte mich sogar vor mir.
»Wir haben etwa zehn Minuten Verspätung in Prien«, sagt die Zugbegleiterin und lächelt mich an.
»Du fährst auch nach Prien?«, fragt Benjamin mich, als die Schaffnerin weitergegangen ist.
»Ja.«
»Kennst du Prien?«, fragt er weiter.
»Ja.«
»Wirklich? Super! Ich hab dort einen Job bekommen. Aber ich war erst einmal zum Vorstellungsgespräch da. Viel scheint in Prien ja nicht gerade los zu sein. Ich hab keine Ahnung, was man da so machen kann. Am Wochenende, meine ich.«
»Baden gehen«, sage ich, ohne nachzudenken. Und schon überfallen mich die Bilder vom Lagerfeuer am See, vom Bootshaus, vom Mond über dem Wasser. Er war voll. Eine glänzende, goldene Münze ... Auch dieses Jahr ist zur Abschlussparty Vollmond, ich habe schon im Kalender nachgesehen.
»Cool. Ja, der See ist perfekt«, sagt er.
»Perfekt. Perfekt für was?«, bricht es aus mir heraus. Ich erschrecke vor meiner eigenen Lautstärke. Perfekt für einen Mord?
»Äh ... für ...«
Ich habe ihn total verunsichert. Ihn, der wahrscheinlich sonst nur mit seinem beringten Finger schnippen oder sein blondes Haar schütteln muss, und schon werfen sich die Mädchen an seinen Hals. Ich merke, wie Wut in mir aufsteigt.
Er wartet darauf, dass ich nett bin. Dass ich lächle, damit er dann auch lächeln kann, was ihn erleichtern und sich wieder gut fühlen lassen würde.
Ohne eine Erklärung drehe ich mich zum Fenster. In meinem früheren Leben hätte ich längst Herzklopfen gehabt und wäre nervös gewesen, weil mich so ein cooler Typ anspricht. Jetzt bedeutet es mir nichts mehr. Das letzte Jahr hat mich härter gemacht.
Er schweigt.
Also ... wo war ich stehen geblieben? Ich blättere in meinem Notizbuch und überfliege die geschriebenen Seiten. Doch ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ich klappe das Heft zu, lege den Stift beiseite und sehe aus dem Fenster. Lasse die Landschaft vorbeiwischen. Die zwei Wochen im Gefängnis haben mich ausgehungert. Nach Farben und Tönen und anderen Gerüchen als denen nach Schweiß und billigen Parfüms. In meiner Zelle war ein Mädchen, deren Namen ich vergessen habe. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass sie jeden Morgen dieses ätzende, billige Parfüm benutzt hat. Wie früher vielleicht, als sie sich jeden Morgen für ihren Job als Supermarktkassiererin fertig machte. Das Parfüm war ein Teil ihrer Identität, an die sie sich verzweifelt klammerte, um sich in den grauen Gefängnismauern nicht ganz zu verlieren. Ich habe ihr Parfüm noch immer in der Nase, obwohl es schon fast ein Jahr her ist.
Ob das Mädchen wohl immer noch im Knast war? So wie Katie, die eine Haftstrafe von vier Jahren absitzen musste. Für Totschlag konnte man bis zu zehn Jahre bekommen. Mich musste man aus Mangel an Beweisen nach zwei Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen. Wenn es nach Kommissar Winter geht, würde ich bald wieder eingesperrt werden. Für ihn ist es ein ungelöster Fall, der an seinem Ego nagt und den er zu Ende bringen will.
Doch bevor ich wieder ins Gefängnis muss, will ich mich erinnern, was zwischen mir und Maurice passiert ist.
Die Bremsen quietschen: Prien.
4
Der Zug steht. Mir ist mulmig. Leonies SMS lautete: Hole dich ab. Die Frau vor mir hantiert an der Ausstiegstür. Und wenn sie es sich doch anders überlegt hat und in Kinding geblieben ist? Dann müsste ich hier in einen Bus steigen. Meine Handflächen sind feucht, ich wische sie an meiner Jeans ab.
Da ist wieder dieses Gefühl in mir, es überfällt mich wie ein dunkler Schatten: Ich hätte nie hierherkommen dürfen.
Nervös lasse ich meinen Blick über den Bahnsteig schweifen. Noch habe ich sie nicht entdeckt, aber das Türfenster ist zu klein und der Rücken der Frau, die immer wieder energisch den Türhebel nach unten drückt, verdeckt mir die Sicht.
Die Tür geht auf, ich hänge meine Reisetasche um und steige die Stufen hinunter. Ich sehe mich um. Viele Abholer. Doch weit und breit keine Spur von Leonie. Vielleicht hat sie sich ja verändert, seit ich sie vor einem Jahr das letzte Mal gesehen habe, hat ihr dunkles, langes Haar abgeschnitten oder blond gefärbt, trägt keine engen Sachen mehr, sondern lässig weite ...
Mein Herz stolpert. Einerseits freue ich mich so, sie wiederzusehen, andererseits habe ich wahnsinnige Angst davor. Wird Leonie mich noch genauso umarmen wir früher? Ihre Mails und Briefe haben mich immer wieder aufgebaut. Sieh nach vorn, Franziska, haben sie und Maya und Vivian geschrieben, das Leben geht weiter.
Plötzlich weiß ich, warum ich außerdem unbedingt hierherkommen musste, worum es hier auch geht: um Freundschaft. War es nicht das, was wirklich zählte? Die Briefe aus Kinding haben mir so viel gegeben, in der Zeit im Gefängnis und in der Klinik. Sie haben mir gezeigt, dass ich nicht alleine war.
Und wenn es nur aus Mitleid war?, meldet sich sofort wieder die zweifelnde Stimme in meinem Kopf. Wenn sie sich nur bei mir gemeldet hatten, weil ich ihnen leidtat? Wie viel hält eine Freundschaft wohl aus? Auch einen Mord? Verzeihen sie mir? Verzeihen sie mir, dass ich einen Freund von ihnen getötet habe?
Leonie hat Angst bekommen, denke ich auf einmal. Bestimmt. Plötzlich ist ihr klar geworden, dass sie unmöglich mit mir auf der Party auftauchen kann. Man wird sie mobben – und das würde noch das Harmloseste sein. Konnte unsere Freundschaft so viel Druck aushalten?
»He, Paula«, höre ich eine Stimme rufen.
Wie hieß er doch gleich? Richtig, Benjamin. Benjamin steht mit seiner Reisetasche und dem Laptop neben mir. Er ist ziemlich hartnäckig – und unerschrocken.
»Soll ich dich vielleicht mit dem Taxi irgendwohin ...«
»Nein«, falle ich ihm ins Wort. »Ich werde abgeholt. Sie kommt ein bisschen später.« Warum sage ich das? Um mir damit selbst Mut zu machen?
»Okay. Also ...«
Er geht noch immer nicht. Was will er denn noch? Er lächelt und zuckt ein bisschen verlegen die Schultern. »Wenn du mal einen Artikel von Benjamin Fischer liest, weißt du, dass ich der aus dem Zug bin. Chiemseer Echo.« Er muss lachen. »Du weißt schon, die ultimative Lokalzeitung hier, die, ohne deren Nachrichten man hier nicht überleben kann!«
Ein schwaches Lächeln kann ich mir abringen. Früher hätte ich laut mit ihm gelacht und gehofft, dass er mich nach meiner Handynummer fragt. So sage ich nur »Okay«.
Er geht, verschwindet im Gewusel in der Bahnhofsvorhalle und ich werfe wieder einen Blick auf mein Handy. Keine SMS. Bevor ich mir in meiner Fantasie noch länger ausmale, was Leonie dazu bewogen hat, ihre Entscheidung zu ändern, rufe ich sie lieber an.
»Franziska!« Leonie kommt auf mich zugerannt. Ihr Haar ist immer noch lang und schwer und sehr dunkel. Während der letzten sonnigen Wochen hat sie garantiert jeden Tag am See gelegen, so braun, wie ihre Haut ist. Und wie immer sieht ihre Schminke aus, als hätte sie stundenlang vor dem Spiegel gestanden. Sie strahlt übers ganze Gesicht.
Kurz vor mir bleibt sie stehen. Lässt die Schultern fallen, seufzt.
Einen Moment lang stehen wir uns so gegenüber.
Zum ersten Mal nach so langer Zeit spüre ich wieder ein Ziehen im Magen und in der Nasenwurzel. So wie früher, bevor ich weinen musste.
»Mensch, Franziska, du bist so dünn geworden!«, bringt Leonie noch hervor, dann fällt sie mir schluchzend um den Hals.
Und dann, erst ganz langsam und dann unaufhaltsam, drücken sich Tränen aus meinen Augen.
Wir stehen eine Weile so da, uns gegenseitig umarmend und weinend.
»Es tut mir so leid«, bringt Leonie schließlich hervor. »Wie schrecklich muss es für dich ...«, sie stockt, »... dort gewesen sein.«
Sie kann es nicht sagen, das Wort. Auch mir fiel es anfangs schwer: Gefängnis.
»Bitte, bitte, verzeih mir!« Sie schluchzt laut. Hinter ihr dreht sich ein Arbeiter in orangefarbenem Overall nach uns um.
»Wofür?«
Sie sieht mich an, noch immer schluchzend. Und ich muss an unsere Band denken. The Fling nannten wir uns. Es ist wie eine Erinnerung an eine andere Zeit. Lichtjahre her.
»Was soll ich dir verzeihen?«, frage ich noch mal.
Sie schluckt. »Dass ... dass ich dich nicht besucht habe.«
»Deine Eltern haben es verboten ...«, wende ich ein.
»Trotzdem«, sie schüttelt seufzend den Kopf, dann stiehlt sich ein Lächeln in ihre Augen, die noch feucht glitzern. »Wäre ja nicht das erste Mal, das ich was Verbotenes gemacht hätte«, murmelt sie und sieht mich dabei schief grinsend an.
»Mach dir keine Vorwürfe, Leonie. Es ist vorbei.«
Ihr Blick wird weich. »It’s over?«
Ich nicke. »It’s over.«
It’s over. Wir haben’s geschafft.Wir haben’s gemacht. Wir sind manchmal blind. Es ist die Zeit, die uns zeigt, wer wir sind.
Eine Strophe eines Songs unserer Band. Leonie hatte die Musik komponiert und ich den Text geschrieben. Maya spielte Bassgitarre und Vivian Schlagzeug. Wir traten bei Veranstaltungen unserer Schule und dann auch bei ein paar Sportveranstaltungen in der Gegend auf. Die Mädchenband vom Augustinus-Gymnasium in Kinding. The Fling.
Leonie tupft sich die Tränen ab, während sie die Melodie unseres Liedes summt und einen Autoschlüssel aus der Tasche zieht. »Fahren wir.«
Irritiert schaue ich sie an. Leonie wird erst in einem halben Jahr achtzehn. Sie ist ein Jahr älter als ich, weil sie einmal eine Klasse wiederholt hat. Trotzdem hat sie den Führerschein schon und darf in Begleitung ihrer Eltern fahren.
»Dein eigenes?«, frage ich, als sie den Schlüsselbund lässig um ihren Zeigefinger schwingt, und spüre wieder den altbekannten Stich in meinem Herz.
»Nein, mein Auto kommt erst nächsten Monat, irgendwas hat mit den Lieferzeiten nicht hingehauen.« Sie kichert.
»Hast du dir eine Speziallackierung bestellt, oder was?«, frage ich.
»Mhmm«, sagt sie und ihre Augen leuchten. »Cabrio. Tahiti Blau mit weißem Verdeck und weißen Ledersitzen!« Ihr Kopf zittert ein bisschen wie immer, wenn sie plötzlich von etwas begeistert ist. »Nicht schlecht, oder?«
»Cool«, sage ich und stelle mir vor, wie Leonie mit wehendem Haar in diesem Auto durch Kinding fährt.
»Zuerst fahr ich damit nach München!«, verkündet sie und bleibt auf dem Parkplatz vor einem silbernen Mercedes SL stehen und öffnet mit einer selbstverständlichen Geste die Türen mit der Fernbedienung. »Du weißt ja, meine Eltern sind nicht da. Dad hat einen Preis in Toronto gekriegt und danach haben sie sich für eine Woche ein Blockhaus an irgendeinem einsamen See dort gemietet.« Sie verdreht die Augen. »Immerhin haben sie dort ein Wasserflugzeug. Mein Dad war schon ganz aufgeregt, weil er mal wieder selbst fliegen darf.«
Als wir letzte Woche telefoniert hatten, hatte sie mir erzählt, dass ihre Eltern verreisen würden und ich deshalb bei ihr übernachten könnte. Zuerst war ich beleidigt, als Leonie mir sagte, dass ihre Eltern nichts von meinem Besuch erfahren sollten. Doch dann war ich sogar froh darüber. So ersparte ich mir wenigstens ihre verächtlichen, abweisenden Blicke und verletzenden Bemerkungen.
Selbst bevor es passiert ist, mochten sie mich nicht. In ihren Augen war ich die Tochter spießiger, langweiliger, ordinärer Tankstellenpächter. Kein Umgang für ihre Leonie und ihre Freundinnen, für die es das Normalste auf der Welt war, reiten und segeln zu gehen oder Golf zu spielen, die in den Ferien zum Sprachkurs nach London oder Paris geschickt wurden und zum Achtzehnten ein Cabrio geschenkt bekamen.
»Aber offiziell darfst du doch gar nicht allein fahren ...«, sage ich, als ich neben Leonie auf dem Beifahrersitz sitze.
»Nein, natürlich nicht«, sie zwinkert mir zu und dreht die Musik lauter, »aber das kleine Risiko kann ich schon eingehen.«
Ich schnalle mich an, lehne mich zurück und wünsche mir, die Fahrt würde ewig dauern. Aber Kinding liegt nur wenige Kilometer von Prien entfernt. Es ist klein und überschaubar. Jeder kennt jeden oder fast jeden – Geheimnisse lassen sich hier nicht bewahren. Bleib, wo du bist, oder du wirst es bitter bereuen. Meine Hand tastet nach dem Papierknäuel in meinem Pulli. Ich bin sicher, dass es schon viele wissen. Dass ich zurückgekommen bin.
5
Es ist seltsam, durch den Ort zu fahren. Da ist die Bäckerei Huber mit dem wagenradgroßen Holzofenbrot und den Zwetschgenfiguren im Schaufenster, daneben die Änderungsschneiderei Maria Paspalis mit dem weißen Spitzenvorhang, am Platz vor der restaurierten katholischen Kirche das Wirtshaus Zur neuen Post