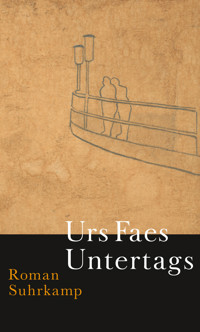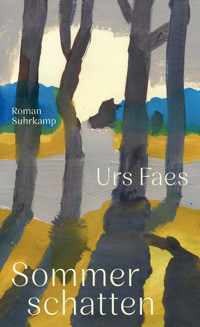
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Rückweg in seine Rebhütte im Schwarzwald bekommt der Erzähler einen Anruf, der alles verändert: Seine Partnerin Ina ist beim Freitauchen schwer verunglückt. Sie wird ins künstliche Koma versetzt, niemand weiß, ob ihr Gehirn Schaden genommen hat, ob sie je wieder aufwachen wird. In den folgenden Tagen bangt er um ihr Überleben, benachrichtigt er Freunde und Verwandte, erinnert sich an das tastende Kennenlernen, die geteilten Wege und Glücksmomente. Er harrt an Inas Krankenbett aus, spricht zu ihr, liest ihr vor, hofft, sie möge endlich aufwachen, zurückkehren zu ihm. Sein Erzählen ist Notwehr gegen das Gefühl des Verlassenseins, die Angst, sie endgültig zu verlieren.
Sommerschatten ist ein einfühlsamer Roman über eine späte Liebe und die Kraft der Erinnerung. Als Brücke zurück in den Alltag, ins Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Urs Faes
Sommerschatten
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung: Leanne Shapton, Sunday Walks One, 2011
eISBN 978-3-518-78207-1
www.suhrkamp.de
Motto
Mein Schlaf ist vorausgegangen.
Ich muß noch seinen bleiernen Mantel
und seine glühenden Schuhe abtragen,
muß den Stein seines letzten Traumes zerkauen,
dann darf ich ihm folgen.
Christine Lavant
Versprich mir wach zu bleiben, versprich
mir eine Rede an die Seele, in einem Gebinde aus
Weißdorn und Wacholder. Versprich mir aufzuwachen,
versprich mir, dich nie zu verlassen.
Marie T. Martin
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Vademecum
I
Ein Tauchen
Klinikum
Nachtflocken und ein grauer Morgen
Blicke und Rückblicke
Dinge und Erinnerung
Nachtstoffe und ein Morgen
II
Fernsein – sie schreiben
Gebirg und Halle
Ein Besuch und ein Gestänge
Schön machen – da sein
Eine Fahrt, eine Begegnung, eine Rede
Ein Brief
Novemberleuchten
Da sind zwei
Noch ein Sturz
III
Erster Tag am See
Zweiter Tag am See
Erwachen am See
Vierter Tag am See, Nachmittag
Letzter Tag am See
IV
Stufenende
Raue Weihnacht
Lesen unter den Winden
Ein jähes Erwachen
Dank
Nachweise
Informationen zum Buch
Sommerschatten
Vademecum
Erst die Rheinebene, Schilfbestände, ausgreifende Wasserarme, Kopfweiden, Wildwuchs, eine langsame Fahrt auf die Berge zu, ein dunkles Schimmern im Grün, vereinzelte Wolken, gelassen über den Hügelzügen, die aufragen. Und einer, der leicht spitz ins Blau wirkt, der hohe Berg genannt in alter Zeit, und jetzt den Namen einer Heiligen trägt, Mont Sainte-Odile.
Unterwegs durch Dörfer mit klingenden Namen: Goxweiler, Heiligenstein, Sankt Simonsbrunnen.
Mit der Fahrt wächst das Grün, werden die Dörfer kleiner, steigen die Rebberge an, mildes Spätsommerlicht. Barr heißt das Winzerdorf am Fuß der Vogesen, schmale Gassen mit Erkern und Dachreitern, Brunnen auf den Plätzen, Straßen, die in die Wälder ausmünden, wo hoch oben, zwischen Heidenmauer und Sandsteinfelsen, die Heilige ihr Kloster hat. Von Odilia geht die Legende, sie sei, blind geboren, durch ihre Taufe sehend geworden und habe auch Blinden zum Augenlicht verholfen. Und manch einem zu Worten.
Sie nehmen den steilen Trampelpfad, der auch im Sommer unter hohen Tannen lehmig ist, ein Ocker, krümelig an den Rändern, mit dem Duft von verdorrtem Gras und Rainfarn.
Sie und er, hintereinander, atemnah, ein Stapfen mit schweren Schuhen: Gehende im Grün.
Sie gehen langsam, zusammen und für sich, ein Räuspern manchmal, ein leises Keuchen, ein plötzliches Zuwenden: Du. Viel Unkraut überm Weg, Moos und Waldmeister. Wörter, eine Berührung, dann weiter, hinan auf dem steinigen Bettelpfad, eine Lichtung mit viel Kleinwuchs, Holunder, eine wilde Orchidee, Lilien. Mal ums Mal bleiben sie stehen, hören hin, lauschen, ein Käuzchenruf, ein Kohlmeisenschlag, der Gesang von Schwarzdrosseln, der Satz von der Rohrdommel in der Wüste.
Und manchmal ist da ein Summen über die Wipfel hin, ein Anflug von Wind, Sommerwind. Und was lastend und Alltag war, fällt ab, Tritt um Tritt. Da ist Heidekraut, ein Krähenkrächzen, dann wieder Stille. Die Blicke fallen auf das Kleine, oft Übersehene: ein Schattenspiel auf dem Weg, ein heller Stein, fein geädert, ein welkes Blatt, staubübermalt. Dann und wann eine Lichtung mit Sonnensprenkeln auf der trockenen Erde, bleiche Gräser, Flockenblumen, Seidelbast.
Von der Lichtung geht der Blick in die Tiefe, wo die Häuser klein erscheinen, die Dörfer geduckt; nur das Straßburger Münster ragt auf: ein Fingerzeig zu den Wolken hin. Stehen und schauen, wieder hinein in die verschlingenden Schatten, mit dem Geruch von Erde; am Wegrand rote Früchte, ein Purpur.
Sie gehen jetzt schweigend, das Kloster vor Augen, die Felsen; auf halber Höhe ist der Glockenschlag zu hören, die Vesper: ein Ruf ins Tal hinunter.
Die hellen Klänge im Ohr, die Türme und Mauern vor Augen lassen die Schritte schneller werden.
Hand in Hand gehen sie. Ein Erinnern summt, wird Sprache, die Schatten eines Sommertages, das Kind, das er war, Pilze suchen, Ritterlinge, Hallimasch, Totentrompeten. Ein Summen, das nach Noten sucht, Bilder, noch ohne Legende. Lichtfäden zwischen den Bäumen, weiß gestriemt. Nah rücken die Mauern, hell der Buntsandstein, von Kieseln durchsetzt.
Die letzten Meter sind ein Stationenweg, Porzellanfiguren in die Mauer geschlagen; vierzehn Bilder des Kreuzweges, ein blauer Grund auf der Felswand, dem Wetter ausgesetzt, dem Wasser und Pflanzengrün. Und da sind auch andere Wanderer, strömen hinzu, vertiefen, versenken sich. Nasses Moosgrün greift über den Stein, die Figuren, die Sätze, Wörter wieder, die auftauchen, von früher, gehörte und gelesene, die sich einstellen, jetzt da sind, als wäre er wieder das Kind, das geht an des Vaters Hand.
Sie treten durchs Tor, in den Klosterhof unter Linden, zu den Kerzen in der Kreuzkapelle; sie entfacht gleich drei. Für die, die nicht mehr da sind. Da verweilen, im Knistern, im Licht. Und wenn es Abend werden will, ein Bleib bei uns, Wind und Wort.
Andere stehen draußen im Hof, den Blick über die Berge in weißem Dunst, unten die Ebene, die Orte Flecken im Grün, Narben.
Sie reicht die Hand, geht zur Vesper am Abend, zuhören, leise mitsingen vielleicht. Er steigt die Steintreppe hoch zur Bibliothek, ein Saal unter Kreuzbogengewölben, mit Lederrücken alter Bände, handgeschriebenen Etiketten, auch Wiegendrucken aus Gutenbergs Zeiten, Episteln des heiligen Hieronymus. Da stehen Tische für Lesende, für Schreibende; in den Rundbogenfenstern staut sich das Licht. Einer liest und schreibt schon; er setzt sich nach hinten, hält fest das Land und den Ort: einer, der ein Beschreiber ist.
Etwas spricht doch, sagt der Dichter von der Memel, wir hören es doch. Immer zu benennen, auf Hoffnung hin: Immer bleibt zwischen den Worten ein scheues Weiß. Leicht schreibt da einer, bis die Sonne sinkt, die Nacht einfällt. Dem, der lange bleiben möchte, wäre ein Nachtlager bereit, mit Zimmer zum Hof; und ein Abendbrot im Refektorium gibt es auch: heute für sie beide. Ein Ort, der hält für eine Weile, wie die Liebe auch.
I
Ein Tauchen
Die Nachmittagssonne, versöhnlich hell für die letzten Novembertage, verhieß einen milden Spätherbstabend. Ina würde zu einem Glas sich einfinden, vielleicht, würde auf die Rheinebene verweisen und die Sammlung der Zugvögel für den Südflug. Sie kannte ihre Nist- und Sammelplätze, winkte den dichten Formationen zu: mit einem übermütigen Gruß.
Ich verließ Straßburg über die A35, die wenig Verkehr aufwies. Auf dem Umweg über Illkirch-Graffenstaden erstand ich im Estaminet à l'Agneau eine der berühmten Lachsrollen im Teig für den Abend. So fuhr ich gelassen auf die Rheinbrücke zu, zufrieden darin, dass ich noch vor der Dämmerung meine Rebhütte erreichen würde. Nachdem ich meine Wohnung in Straßburg aufgegeben hatte, war diese Hütte mein Unterschlupf geworden. Die Klause bot seit einigen Wochen ein vorläufiges Unterkommen, war so nahe bei Ina, dass ich mit ihr noch durch die Reben gehen und mir die verlassenen Nester der Kiebitze zeigen lassen könnte.
In Straßburg hatte ich an diesem Tag verschrobene Schriftliebhaber und Schmetterlingsforscher zu Gesprächen getroffen. Wir verfolgten das Projekt einer Monatsschrift mit topographischen Medaillons. Einer nannte unser Vorhaben, mit ironischer Anspielung, eine Parallelaktion, parallel zum Rhein, der uns trennte und verband; parallel aber auch zu unserer Zeit mit ihren Verschwörungen und Bitternissen, zu all den groß und wichtig scheinenden Phänomenen der Gegenwart. Wir hatten den ganzen Nachmittag im Roi et son Fou gesessen, einem Café in der wenig beachteten Rue du Vieil-Hôpital, und zum Kaffee den einen oder anderen Absinth getrunken, was zur unbekümmerten Stimmung beigetragen hatte, obwohl wir mit unseren Plänen für die Ortsbeschreibungen, Skizzen von vergessenen Landstrichen, Müllhalden und einsamen Flussläufen nicht weitergekommen waren; das Geld fehlte auf beiden Seiten des Rheins.
Ich liebte die Stadt, auch nach Jahren noch, die Bürgerhäuser mit ihren steilen Giebeldächern und vor allem das Licht, das diesen Ort so hell machte, ihm eine südliche Wärme verlieh.
In aufgeräumter Stimmung fuhr ich heimwärts. Am Morgen würde ich ein Protokoll verfassen; mit den Projektvorschlägen – Tabakpflanzungen in den Rheinauen, die Totenköpfe in Dambach und anderes mehr – an die Kulturbehörden weiterleiten.
Vielleicht würden Ina und ich noch einen Abendtrunk in der Waldhütte am Hasenhain nehmen, den weiten Blick in die Vogesen genießen, die im Glanz der Wälder als Schattenspiel über der Ebene flackerten. Hier holte Ina die Zweige, die sie für die Vögel in ihre Gartenlaube stellte, mit Nahrungstrauben behängt, den ganzen Winter über. Da stand sie dann, wenn sie heranflogen, sah ihnen zu, hob leicht die Hand, als wollte sie zu einer Vogelpredigt ansetzen wie einst der heilige Franz.
Die kleinen Gänge, nah beim anderen, horchend, lauschend, gehörten zum Ritual unseres Miteinanderseins. In dieser Zeit, in der die gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um den Erdball zurückkehrten, auch die Kriege, waren sie Orte der Zuflucht vor dem Schiffbruch der Welt. Traumland, in übler Zeit.
Ich hatte eben den Fluss Jll überquert, fuhr zwischen den Tümpeln dahin, gemächlich auf die Brücke zu, da gewahrte ich die stehende Wagenkolonne, verlangsamte das Tempo, reihte mich ein. Die Grenze am Rhein war meist problemlos zu passieren, Kontrollen fanden selten statt, kamen aber gelegentlich vor. Ausgerechnet heute, in der Vorfreude auf den Abend, auf Ina. Ich versuchte, den Klingelton meines Handys zu ignorieren, zögerte, legte die Hand daran, ließ es schrillen. Polizisten schritten die Kolonne entlang, leuchteten mit grellweißen Lampen ins Innere der Wagen. Ich schaute kurz auf das Display hinunter. Die Nummer kannte ich nicht, hörte gleich danach die Nachricht: Zurückrufen. Dringend. Eine panisch verängstigte Stimme. Ich nahm die nächste Ausfahrt: den Rastplatz zum Auen-Wildnispfad, den wir oft als Ausgangspunkt zu einem Bummel genommen hatten, den alten Rhein oder den Mühlbach entlang, in die Dschungelwildnis hinein, an Tümpeln und Gießen vorbei.
Ich wählte die Nummer, nach wenigen Sätzen erkannte ich die Stimme. Ich hatte Almut öfter an Inas Seite gesehen, im Sprechgesang zum Cello, eine nahe Freundin. Immer mal zu einem Scherz bereit.
Jetzt ließen die Wörter ihres Staccato mich zusammenzucken. Sieht schlimm aus mit Ina. Ohne Bewusstsein aus dem Wasser geborgen. Gerettet. Wiederbelebungsversuche, presste sie noch heraus. Ihre Stimme zitterte, ging in einen unverständlichen Wortschwall über, der kein Nachfragen zuließ, bis sie in Tränen ausbrach und abbrach.
Ich stand ans Auto gelehnt, benommen, vor den Kopf geschlagen, ließ das Handy in die Tasche gleiten.
Was war geschehen? Atem anhalten. Ein Spiel aus Kinderzeiten. Auch ein Sport. Ich wusste um die Gefahren des Freitauchens, das sie liebte, unter strengen Bedingungen im Verein, mal an einem der Seen, dann und wann als Training in der Halle, Streckentauchen in einem Atemzug: Wer kommt wie weit? Ein Kribbeln. Auch ein wenig Rausch. Aber immer in Begleitung. Überwacht. Kaum je ein Unfall. Eine besondere Erfahrung, sagte sie, besonders in den Seen, in einem der vielen Altwasserseen in der Gegend. Eine Welt von unten.
Ich versuchte zu ordnen, was ich gehört hatte. Kaum hatte ich das Handy losgelassen, fiel mir die Nachricht ein, die mich Tage zuvor erreicht hatte. Ich tippte an und las: »Liebster, der Nachtwind durchkämmt das Gras, greift ins Haar und vernebelt die Sicht. Alles hält ein, bleibt ohne Aussicht. Die Wege gehen zu, verlieren sich im Ungefähren. Und irgendetwas fragt: wie weiter? Überhaupt weiter?«
Ich hatte diesen Worten auch deshalb zunächst wenig Beachtung geschenkt, weil mich dann und wann Nachrichten solcher Art erreichten, als gehörte ein wenig Daseinsüberdruss, der auch mir nicht fremd war, zu Inas gelegentlichen Gemütslagen.
Hatte ich überhört, was sie mir sagen wollte? Manchmal nahm ihr Reden einen rauchigen Tonfall an, wies auch einen Zug zum Monologischen auf, bekam einen dunklen Sog.
Ich taumelte, verharrte unschlüssig, statt loszurasen. Die Wörter wirbelten in meinem Kopf. Der Aufruhr in der Halle, der Schreck in den Gesichtern, die reglose Gestalt Inas. Almuts Stammeln hatte etwas schneidend Kantiges gehabt, die Entsetzensschreie, das Heulen der Sirenen – ein Sperling hüpfte vor mir über den Kies, schnappte nach Krümeln oder Würmern, flog auf, Richtung Strom, hinter dem sich schwarz die Berge abhoben. Diesmal hat die heilige Odilia nicht geholfen. Das sagte Ina nach einem schweren Sturz mit dem Fahrrad vor zwei Jahren. Sie war für Minuten ohne Regung geblieben, aber rasch wieder bei Bewusstsein. Mit Schürfwunden und Rippenquetschungen glimpflich davongekommen. Für den Moment hatte ihr Gesicht einen ernsten Ausdruck angenommen.
Keine Angst vor dem Freitauchen, ein Sport mit Vorsicht geübt, einer schwimmt, einer schaut. Ich werde schon achtgeben, hatte sie beteuert. Hatte ich ihren Beschwichtigungen zu leichtfertig vertraut?
Und jetzt?
Wieder hörte ich Almuts Stimme.
Aufgefischt wie eine Ertrunkene.
Die Worte der Freundin drangen gepresst durch das Schluchzen, bis sie erneut darin erstickten.
Ich stand noch immer wie gelähmt, statt endlich mich auf den Weg zu machen. Ein Lichterbaum beim Aufgang der Brücke. Bald Advent, dann Weihnachten. Ein Zittern durchfuhr mich, dann setzte ich mich hinters Steuer. Noch bevor ich losfahren konnte, erreichte mich ein weiterer Anruf. Es war Frank, Almuts Freund. Die Ambulanz hätte Ina bereits ins Kreis-Klinikum überführt, in die Notfallstation. Ich solle mich dorthin begeben. Hier in der Halle sei die Gendarmerie mit der Abklärung der Umstände beschäftigt, Almut und die anderen würden befragt, besonders Thilo, der Aufsicht hatte.
Der Abendverkehr hielt sich in Grenzen; ich kam unerwartet schnell voran. Ich hatte Ina schon einmal ins Klinikum gebracht wegen Unterkühlung nach einer langen Nachtwanderung. Bald glitt ich an der ehemaligen Kaserne vorüber, Backsteinbauten aus den frühen Zwanzigerjahren, ein schütteres Ziegelrot. Nach dem Abzug der französischen Besatzungstruppen waren sie nach und nach restauriert worden; der Exerzierplatz im Innenhof war zu einer Parkanlage geworden, weite Grünflächen unter Platanen. Da waren wir oft geschlendert, durch feuchtes Gras, ihre Hand fest in der meinen verklammert.
Klinikum
Ich parkte am Kreis-Klinikum ein, stieg aus dem Wagen, eilte auf den Haupteingang zu, ein breites Portal mit Glastüren, Hecken zu beiden Seiten, eine Blumenrabatte, kahl schon, geharkt und gedüngt.
Ich blieb stehen, sah plötzlich Inas Gesicht vor mir, das reglos im Kissen lag, eingemummt, die Augen geschlossen, womöglich hinter Bandagen, Schläuche in den Armen, Herzrhythmusstörungen.
Tafeln mit Pfeilen verwiesen auf die verschiedenen Abteilungen. Eine davon zur »Unfallchirurgie«. Ich zögerte, wendete mich ab, schaute zurück auf die Straße, erkannte die kleine Imbissbude, in der wir nach dem Konzert in der nahen Marienkirche noch ein wenig gefeiert hatten.
Laudate Dominum lautete nach einem Chorstück der Titel eines Programms mit Psalmvertonungen, Schütz, Reger und Grieg. Ihr Gesicht, nah am Cellobogen, angespannt und heiter, der matte Glanz ihres dunklen Haares über dem schwarzen Kleid. Im Spiel zeichnete der Stoff die Bewegungen ihres Körpers nach, ihr leichtes Sich-Vorneigen, zu den Menschen hin, als folge sie den Tönen, geleite sie durch den Raum. Zuweilen streifte mich ihr flüchtiger Blick, und ich bezog die Zeilen aus der Grieg'schen Hoheliedvertonung ganz auf mich: »Mein Freund, du bist mein / Ja, mein. Ja, mein. / So lass mich für immer werden dein …« – es war ein Blick, der sich anschmiegte, blieb.
Ihr Lachen nach dem Konzert, beim Umtrunk in der Kneipe, ein großes Bier in der Hand. Die Hochstimmung, die uns gemach durch die Nacht schreiten ließ, bis zu den Rebfeldern mit dem weiten Blick ins Tal.
Das Portal sprang auf, die Frau am Empfang, Frau Resch, wie ich dem Namensschild an ihrer Bluse entnahm, gab sich zuvorkommend und freundlich, mit badischem Dialekteinschlag, aber in der Sache unerbittlich. Kein Besuch die nächsten vierundzwanzig Stunden, von niemandem.
Sie erlaubte mir nach einigem Zögern den Zutritt zur Intensivstation, um mich an die diensthabende Ärztin zu wenden, mich ihr vorzustellen.
Frau Doktor Boos, eine Frau um die vierzig, erläuterte mir in wenigen Worten, man versuche fürs Erste die Patientin zu stabilisieren und gleichzeitig eine Differentialdiagnose vorzunehmen. Sie könne mir versichern, dass alle lebensrettenden Erstmaßnahmen getroffen worden seien, vor allem die Stabilisierung von Atem und Kreislauf. Man tendiere dazu, sie in einem künstlichen Koma zu halten, für Tage, vielleicht für Wochen. Intensivstation, eine Verlegung sei möglich, ein IHT, Interhospitaltransport.
Die Situation sei sehr ernst. Ich müsse bis morgen warten. Und mit allem rechnen. Und sie schob ein Wort nach, das wie ein Stich mich traf: Schutzintubation.
Die Hände, bat ich in beinah flehendem Ton, wenn ich wenigstens ihre Hände sehen dürfte, nur die Hände. Frau Doktor Boos schüttelte den Kopf. Sie erlaubte nicht einmal einen Blick ins Zimmer. Morgen Abend vielleicht. Und ich möge doch am Empfang die Formalitäten ergänzen, die Patientenverfügung bringen, falls vorhanden, Angehörige nennen. Frau Resch werde mich informieren, was da vonnöten sei.
Ich wollte mich schon abwenden, als eine Frau von der Pflege hinzutrat, in ihre Schürze griff und mir einen Zettel übergab. Sie schaute mich durchdringend an, ernst und verbindlich. Der Zettel war für mich bestimmt. Die Pflegerin musste ihn zufällig in einer von Inas Taschen gefunden haben und überzeugt gewesen sein, dass nur ich der Adressat sein könne.
Das Blau ihres Stiftes, die Art der Buchstabenfolge, jeder einzelne sehr ausgeprägt, die i-Punkte als kleine Kreise, die Schleifen ausladend, eine Schrift wie ein Cartoon: fast schon ein gemaltes Bild. So fielen mir ihre Briefe im Postkasten schon immer auf, ragten aus allen heraus. Und ich las, las von ihrem Bedauern darüber, dass der gemeinsame Tag vor meiner Abreise missglückt war, Streit um Kekse und Kuchen. Aber wir würden uns schon wiederfinden.
Frau Resch saß noch hinter dem Tisch. Ich beantwortete ihre Fragen nach dem Hausarzt, den Angehörigen und Freunden, erwähnte den Bruder Nils in Kanada, die Eltern, die nicht mehr da seien. Das fragende Gesicht ließ ich unbeachtet. Nicht mehr da, wiederholte ich. Und Sie? Ich hob die Hand: kein Ring. Mein Status? Was sollte ich sagen? Ich würde nach der Patientenverfügung suchen, sagte ich rasch, eine Liste mit Namen von nahen Vertrauten vorbeibringen.
Ich trat in den Abend hinaus. In der Imbissbude wurden die großen Maß ausgeschenkt: ein dichtes Gedränge um den Spund.
Ich folgte der Straße, bis hin zum Friedhof und zum Blumengeschäft, wo ich manchmal Rosen kaufte. Von der Marienkirche schlug es halb acht. Erneut klingelte das Handy. Almuts Stimme klang jetzt ruhiger. Sie und Frank seien noch in der Halle, falls ich vorbeikommen wolle. Inas Sachen lägen in der Garderobe, die Kleider, die Tasche, falls ich …
In ein paar Minuten, sagte ich, bis gleich.
Die Schwimmanlagen erstreckten sich am südlichen Rand der Stadt, ein ausgedehntes Gelände, Freibad und Halle, nicht weit vom grünen Badesee. Ich hatte sie manchmal zum Schwimmen begleitet, zu einem der kleinen Seen, dem Pappelwaldsee, dem Matschelsee, ein Baggersee, der auch zum Tieftauchen reizte. Ina glitt beim Schwimmen wie eine Fünfundzwanzigjährige dahin, wieder ganz Mädchen. Gelegentlich schaute ich ihr bei Zeittauchübungen zu, der eine tauchte, der andere beobachtete, notierte, Dauer, Strecke. Mir war das unheimlich. Ich erinnerte mich ungern an die Kinderspiele mit dem Atemanhalten um die Wette. Mein eigener Bruder war einmal beinahe ertrunken. Ich hatte damals Gefahren eher in den Bergen kennengelernt durch einen Vater, der mich von klein auf in die Alpentäler geschleppt hatte, in Schnee und Eis, zu Klettereien auf krönende Gipfel.