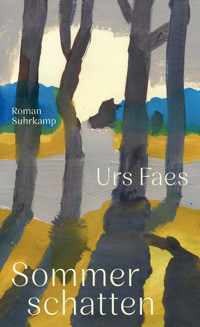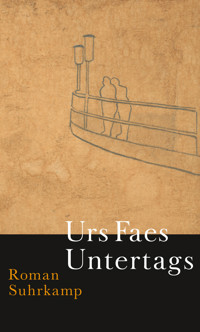14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine einfache, eine ganz gewöhnliche Geschichte, sagt Helen Melzer, die ihren Sohn ans häusliche Krankenbett gerufen hat. Urs Faes folgt in Sommerwende behutsam den Erzählungen dieser alten Frau. Ihre Erinnerungen führen zurück in den Spätsommer 1941, als die Lebensträume der damals Achtzehnjährigen von zwei Ereignissen erschüttert und zerstört werden. Helens Mutter wird niedergestochen, und bald darauf werden die jüdischen Familien heimatlos gemacht. Darunter ist Simon Levy, der Geliebte von Helen. Zwei scheinbar zufällige Geschehnisse, die »ein und derselben Geschichte« zugehören, denn der Mörder und antisemitische Brandstifter Alfred König ist selbst nur ein Opfer, verhetzt und irregeleitet von einer jener schweizerischen Frontistenorganisationen, die mit dem nationalsozialistischen Deutschland paktierten.
Mit leiser, sein Thema einkreisender Sprache, der alles angestrengt Forcierte fremd ist, spiegelt der 1947 geborene Schweizer Autor Urs Faes in Sommerwende ein Stück brisanter Schweizer Geschichte in Lebensgeschichten – heute aktueller denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Urs Faes
Sommerwende
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 3. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 1922.
© 1989, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-75277-7
www.suhrkamp.de
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Es gibt Erinnerungen, die wie schillernde Blasen sind. Nach vielen Jahren steigen sie plötzlich auf in einer Nachtstunde, wachsen und wachsen, wollen nicht zerplatzen, sondern blenden die Augen unter den geschlossenen Lidern. Und doch hat man diese Erinnerungen manchem erzählt – vielleicht nur um sie loszuwerden.
Friedrich Glauser
Wenn man das weiß: was das ist, Zeit. Das Gegenwärtige? Das schon immer, indem es bemerkt wurde, abgeschlossen ist, vergangen, Vergangenheit geworden. Die Vergangenheit? Abgeschlossen, abgetan, nicht mehr zu rufen, weil ohne Gehör. Erkennbar vielleicht in leblosen Gegenständen. Aber man blickt darauf...
Johannes Bobrowski
1
Komm nach Hause, bitte.
Sie hatte nur diese Worte geschrieben, und darunter mit der etwas ungelenken Schrift einer alten Frau: Mutter.
Melzer hatte sich im Lauf der Jahre an Mutters Wohlbefinden gewöhnt. Ihr Ruf kam überraschend.
Melzer rief den Arzt an.
Der Befund klang wenig dramatisch. Eine Alterskrankheit, kaum gefährlich.
Der kurze Brief irritierte Melzer.
Er konnte nicht sagen, warum. Vielleicht wollte sie ihn auch bloß wieder einmal sehen.
Wer weiß das schon.
Melzer entschied sich zu fahren.
Das Haus: noch dieselben Gerüche im Korridor, ein Gemisch aus Öl, Leder und Fett, aus verrauchten Vorhängen und Schimmel, der sich als pelzige Haut über die feuchten Wände zog. Er setzte sich in den Schränken fest und war stärker als Putzmittel und Farbe.
Das Haus lag nah am Fluß, der Feuchte preisgegeben, Nebel und Regen; der Putz blätterte schon nach wenigen Jahren, wurde immer wieder notdürftig ausgebessert, verkam zum Flickteppich.
Eigenbau eben, dachte Melzer. Eher improvisiert denn bewußt geplant, das Material hatte kostengünstig sein müssen.
Ein eigenes Haus, unser Zuhause, hörte er Mutter sagen. Etwas schief duckte es sich hinter die Buchsbaumhecken – mehr Hütte als Haus, sagte Mutter. Aber das kümmerte sie nicht.
Die Nachricht erreichte Melzer im Ausland.
Sie hatten einander geschrieben, Mutter und er, nicht häufig, aber doch regelmäßig. Mutters Briefe waren immer kurz. Alltägliches teilte sie mit, einen Todesfall in der Nachbarschaft, oder sie erwähnte ein Buch, das ihr gefiel; vom Schnee schrieb sie, vom Frost und den ersten Krokussen im Frühling.
Selten ein Satz über sich selbst.
Wozu Aufhebens machen von unsereins, pflegte sie immer zu sagen und wischte mit den Händen so energisch durch die Luft, als wolle sie ein lästiges Insekt vertreiben.
Er fand sie hochgebettet im elterlichen Schlafzimmer. Sie hatte ausdrücklich abgelehnt, ins Spital zu gehen. Alle Versuche des Hausarztes und ihrer Schwester Clarissa, sie umzustimmen, verwarf sie mit dem störrischen Trotz ihres Alters; so ließ man ihr den Willen. Nun lag sie im Bett, in dem sie seit ihrer Heirat, von wenigen Nächten abgesehen, immer geschlafen hatte; auch während der schlimmsten Krankheitstage ihres Mannes, als sein Stöhnen sie längst nicht mehr schlafen ließ, harrte sie neben ihm aus. An ihrer Seite war er auch gestorben.
Auf die Frage nach ihrem Befinden ging sie nicht lange ein. Eine Krankheit eben, das wird sich geben, sagte sie, so leicht bin ich nicht unterzukriegen.
Sie lachte.
– Aber etwas muß ich dir noch erzählen.
Eigentlich habe sie es aufschreiben wollen.
Doch Schreiben war nicht ihre Sache. Das wußte Melzer. Ihre Briefe – sie hatte jeweils lange nach Worten suchen müssen und sich geschämt, ihm soviel Nichtssagendes zu berichten, so weit in die Welt hinaus.
Das sei nicht einmal das Porto wert.
Die Reise, sagte sie zögernd und erklärte plötzlich bestimmt: Von der Reise muß ich dir erzählen, mit meinen Schwestern, Clarissa und Myrtha.
Mutter schmunzelte.
– Was machst du nun für ein Gesicht.
Melzer staunte.
Geheimnisvoll hatte sich seine Mutter nie gegeben.
Zu dritt sind sie gefahren, damals, sogar Myrtha haben sie zur Reise überreden können. Sie hat zwar ständig Valium geschluckt und gejammert, aber mitgekommen ist sie.
Melzer blickte in die anbrechende Dämmerung hinaus, in die vom Herbstwind zerrauften Bäume und Sträucher; hoch ragte der Kamin der stillgelegten Fabrik in den bläulich verschwimmenden Horizont hinaus, wo das hügelige Land abflachte, in die Ebene des Tales sich ergoß. Ein kühler Wind strich um die Häuser, wirbelte Laub auf, kräuselte die hellen Pfützen in den Gartenwegen. Im nahen Fluß stand das Wasser noch immer hoch, war schmutzig braun und führte Aste und Laub mit sich. Dämmriges Grau über dem Tal, dessen bewaldete Hügel sich als schwarze Linien in der Ferne kreuzten. Mutter, in einem Nachbardorf aufgewachsen, hatte das Tal kaum je verlassen. Man schlägt halt Wurzeln, wo man aufgewachsen ist und seine Toten hat, sagte sie.
Wie schon in der Stadt hingen auch hier im Quartier überall Wahlplakate für die Parlamentswahlen; viel von Grün und Umwelt in den Parolen, aber auch vom Kampf gegen Überfremdung und Asylantenströme: Bewahrt die Eigenart unseres Landes.
Melzer folgte mit den Augen dem Weg, der hinaus in die Felder und zum Fluß führte, vorbei an den langen Reihen der Hasel- und Holunderbüsche; und weit draußen das Gehöft des Saumhofbauern, dem er als Kind bei der Heuernte geholfen hatte und beim Rübenschneiden im Herbst.
Vieles hatte sich verändert im Dorf.
In der Landschaft der Kindheit.
Vom Kirchturm schlug es sechs. Die Schläge waren ihm schon immer lang und schleppend vorgekommen.
Melzer wandte sich vom Fenster ab.
Still lag Mutters Gesicht im Kissen.
Geschlossene Augen.
Es sei ihr nicht recht, daß er ihretwegen die lange Reise habe auf sich nehmen müssen, begann Mutter.
Nicht die Krankheit war der Anlaß ihres Schreibens.
Reden wollte sie.
Eine kleine Beichte, sagte sie, wenn dir das nicht zu übertrieben klingt.
Ein Brief –
Sie erkannte die Schrift nicht gleich, nach so vielen Jahren – aber sie zitterte, als sie beim Lesen merkte, wer der Absender war: Alfred –
Ein Spätsommertag des Jahres 41 –
Noch völlig verstört durch die Nachricht von diesem gräßlichen Tod, dieser schlimmsten von allen Todesarten, geht sie langsam, widerstrebend, auf das Elternhaus zu, die Sonne in den Bäumen, trocken die Erde auf den Blumenbeeten vor dem Haus, dahinter die Felder, die in der Hitze zittern. Sie bleibt am Tor stehen und blickt nur auf den Garten, die Sträucher, die Hecken der Straße entlang, verfilztes Gestrüpp. Die Düfte des Gartens steigen ihr in die Nase; süßlich und schwer, eindringlich, die Düfte der Tollkirschenblüte, der Rosmarin- und Thymianblätter, körperlich beinah, ein dünnes Gewebe über diesen Garten ausgespannt. Gierig saugt sie diese Düfte ein, steht da, reglos, die Hände auf den Steinsockel des Gartentores gelegt, sie spürt die Kühle des leicht bröckligen Gemäuers auf den Handflächen, langsam schweifen ihre Blicke über den Garten hinweg zu den Fenstern des Hauses. Die Hängegeranien auf den Simsen schon fast blütenlos, beinahe bleich das Grün, matt glänzend in der Sonne; und unter dem Fenster die Holzbank, auf der die Eltern verweilten. Und immer eindringlicher, betäubender diese Spätsommergerüche, daran muß sie auch später immer zuerst denken.
Immer werden es diese Sommerdüfte sein, die über dem Tag stehen, sagte Mutter und richtete sich ein wenig in den Kissen auf. Auch beim Lesen von Alfreds Brief, schon nach wenigen Zeilen, dachte sie wieder an das Bild des Gartens an diesem Spätsommertag –
Ein Mädchen von achtzehn Jahren, das unschlüssig am Gartentor steht, zum Haus aufsieht, zu seinen Fenstern, dem Spalierobst, das die Fassaden überwächst. Und in der Ecke die Sommerlinde, schon leicht verfärbt die Blätter, ungeordnet, wild verwachsen die Zweige, in deren Schatten sie oft sitzt, liest oder einfach vor sich hinträumt.
Hingeträumt hat, damals.
Betäubt verharrt sie am Tor, alles sträubt sich in ihr, wendet sich gegen den einen Gedanken. Dieses Haus ist ein Totenhaus, in einem der Räume liegt der verstümmelte Leib der Mutter, schon erstarrt – und mit ihm alles, was ihr lieb gewesen ist.
Langsam öffnet sie das Gartentor, tastet sich mit den Händen die Sträucher entlang, spürt die leise Berührung des Laubs auf der Innenfläche der Hand. Mit jedem Schritt durch den Garten auf das Haus zu wächst die Angst, ein Zögern, ein Stocken geht durch ihre Glieder, als verklumpe sich etwas in ihr. Eine Schwere, die sie nie zuvor gekannt hat. Nicht einmal beim Tod ihres Vaters. Und ihr ist, als komme eine Verdüsterung über diesen Garten, ein dunkler Schleier, vermischt mit dem fauligen Geruch der Jauche, der vom Hof herüber dringt, ein säuerlich-bitterer Gestank; und noch einmal, nah der Haustür, blickt sie zurück in den Garten, flehend beinah, als müsse irgendeine Antwort aus diesen Hecken und Büschen kommen, müsse etwas sich regen in diesen Zweigen und Blättern. Doch nichts bewegt sich, nur das matte Spätsommerlicht, laubig gefiltert, mustert mit ausgefransten Schatten die Erde.
Sie wendet sich ab, drückt die Türklinke.
Ich bin ins Haus gegangen, sagte Mutter.
Sie setzte sich im Bett auf, öffnete die Schublade ihres Nachttischchens und klaubte einen Brief heraus. Sie legte ihn vor sich auf die Bettdecke, strich mit den Händen über das Papier, drückte die verkrümmten Ecken nach unten.
Sie hielt den Brief in den Händen, reichte ihn dem Sohn.
Lies, sagte sie.
Sehr geehrte Clarissa, Myrtha, Helen,
ich habe nicht mehr lange zu leben und möchte noch einmal mit Euch reden, um meine Schuld nicht mitzunehmen in den Tod.
Besucht mich doch, da ich Euch nicht mehr besuchen kann, weil ich ans Bett gebunden bin. Auch einer, der sich vergangen hat, muß doch ein Anrecht haben auf Verzeihen.
Kommt doch und laßt uns reden nach so langer Zeit. Denn die Gewißheit verstärkt sich, daß ich ohne diesen letzten, auch für mich bitteren Schritt nicht in Ruhe sterben kann. Das ist der einzige Wunsch, den ich noch habe. Auch wenn es Euch nicht leichtfällt, mir noch einmal gegenüberzutreten, tut es doch.
Ich bitte Euch darum.
Alfred
Zuerst waren wir gegen den Besuch, sagte sie. Keine wollte zu Alfred fahren.
Am heftigsten hat Myrtha reagiert.
– Das könnte dem Kerl passen.
Jetzt plötzlich so kommen.
Nach all den verpfuschten Jahren.
Dieser Halunke.
Aber Clarissa lockte die Reise, von Anfang an.
Sie habe oft daran gedacht.
So fanden die drei Schwestern zum Gespräch, wie seit langen Jahren nicht mehr. Keine hätte das noch für möglich gehalten.
2
Alfred noch einmal sehen, nach so langer Zeit – sie war fasziniert gewesen von dem Gedanken –
Leben im Krieg. Aus dem Radio täglich die Siegesmeldungen des Großdeutschen Rundfunks. Kämpfe im Westen, Kämpfe im Osten. In den Illustrierten die Bilder von Städten in Schutt und Asche, fremde Namen, die plötzlich Bedeutung bekamen und in Erinnerung blieben: Dünkirchen, Sedan, Warschau, Smolensk.
Angst und Unsicherheit im ganzen Land.
Wann sind wir an der Reihe?
Die Frontisten organisierten Fackelzüge, forderten eine Einheitsfront mit dem nationalsozialistischen Deutschland, wetterten gegen die Verjudung von Wirtschaft und Beamtentum. Häufiger die Flugblätter in den Briefkästen: Kauft nicht bei Juden. Mittellose Emigranten mußten sich bei den Behörden melden und wurden in Arbeitslager gesteckt, vorsorglich; politische Agitation gegen Deutschland könnte das nationalsozialistische Regime provozieren.
Manche Nacht standen die Schwestern am Fenster und horchten nach dem Dröhnen der Bomber, das die Menschen aus dem Schlaf schreckte. Freund oder Feind? Die Behörden warnten vor Saboteuren und Spionen. Seid wachsam, der Feind ist unter euch.
Mobilmachung der Armee. Grenzbesetzung. Der Bundespräsident wandte sich ans Volk, sprach von der notwendigen Anpassung an die neuen Verhältnisse in Europa, auch die Schweiz müsse die Chance zu innerer Wiedergeburt wahrnehmen. Ausgefahrene Wege verlassen. Den alten Menschen ablegen. Den Blick vorwärts wenden. Sich dem Rhythmus der neuen Zeit anpassen. Der Regierung folgen als einem sicheren und opferwilligen Führer. Mut, Entschlossenheit, Opfergeist und Selbstaufopferung als rettende Tugenden an den Tag legen.
Anpassung statt Widerstand.
Melzer kannte die These, die dazu diente, die Anlehnung an das nationalsozialistische Deutschland zu rechtfertigen: Waffenlieferungen an die Nationalsozialisten, Rückweisung von Emigranten, Zurückhaltung in der Judenfrage, Pressezensur.
Das war lange her, August 41 –
Früh am Morgen sitzt sie mit der Mutter noch draußen am runden Blechtisch, das graue Morgenlicht tropft durch die Bäume, sie trinken Kaffee, Mutter gähnt, klagt über Schmerzen im Kreuz, über die Nöte des Alltags. Sie kann die Lebensmittelkarten nicht mehr finden, braucht dringend Mehl und Zucker. Der Krieg rückt näher, klagt die Mutter, nicht mal mehr das Brot reicht aus, sie bittet die Tochter, bei ihrer Chefin um Mehl nachzufragen.
Helen verspricht es, küßt die Mutter, die sitzenbleibt, eine Pille in den Kaffee fallen läßt, sich schüttelt beim Trinken.
– Abscheulich.
Das hört die Tochter noch, läßt das Tor ins Schloß fallen.
– Bis zum Abend.
Die Mutter nickt, winkt der Tochter zu, senkt das Gesicht. Am späten Nachmittag kehrt sie zurück, bummelt durch die Gluthitze des Tages, die schmale Dorfstraße entlang, sie sieht das Schwinden des Lichtes über den sommerlichen Dächern, unschlüssig geht sie, tändelnd, langsam rückt das Haus heran, die Luft zittert über dem roten Ziegeldach, sie weiß und will es doch nicht wissen, die Mutter lebt nicht mehr –
Amalie Anna Leber, geborene Mehlin 1896–1941.
Goldbuchstaben auf schwarzem Granit.
Melzer hatte mit Mutter manchmal das Grab der Großmutter besucht. Sie war während des Krieges gestorben, das wußte er, ganz überraschend, eine seltene Krankheit.
Mehr hatte Mutter dem Kind nicht sagen wollen.
Der kleine Friedhof lag außerhalb des Dorfes auf einer Anhöhe. Unten die schmale Ebene, durch die sich der Fluß schlängelte, gesäumt mit hohen Pappelreihen, die Dörfer als dunkle Kleckse inmitten der Wiesen und Äcker ausgebreitet.
An föhnhellen Tagen rückten die Berge mit den weiß verschneiten Spitzen heran.
Das Kind, das du damals gewesen bist, dachte Melzer.
Dem Kind waren diese Gänge zum Friedhof zuwider, es fand Ausflüchte, um Mutter nicht begleiten zu müssen. Es fürchtete sich vor der Stille zwischen den Gräberreihen und dem fauligen Geruch verwelkter Blumen, der ihm ansteckend schien wie eine Krankheit; Mutters stilles Verweilen vor dem Grab berührte es peinlich, es hielt sich abseits, blickte verstohlen auf Mutter, die betend vor dem Grab kniete, die Blumen ordnete, verwelkte wegtrug und neue pflanzte oder in kleine Metallvasen steckte.
Es wehrte sich immer öfter mitzugehen, und gab es wieder einmal nach, so ließ es die Mutter auf dem ganzen Weg seinen Unwillen spüren, trat in Pfützen, kletterte auf Bäume, beschmutzte sich die Kleider.
Ein unartiges Kind.
Melzer lachte.
Das letzte Wegstück zum Friedhof führte über einen schmalen abschüssigen Trampelpfad, der an Regentagen aufgeweicht und glitschig und nur durch einzelne, aus Rundhölzern gefertigte Stufen leicht gestützt war. Oft setzte sich das Kind auf eine dieser Treppenstufen und weigerte sich, die letzten Meter bis zum Friedhof zu gehen. Mutter ließ ihm meist den Willen, machte die letzten Schritte allein. Das Kind hörte das schmiedeeiserne Tor ins Schloß fallen, sah über der Friedhofsmauer Mutters dunklen Schopf.
Auch als Großmutters Grab nach fünfundzwanzig Jahren beseitigt wurde, pilgerte Mutter manchmal zum Friedhof, legte Blumen auf irgendwelche Gräber und verweilte betend, wie sie es immer getan hatte.
Sie verriet Melzer nie, wer ihr Gott war und wie sie es mit dem Glauben hielt. Und sie hatte wohl seit dem Tod der kleinen Schwester mit diesem Gott gehadert.
Ihr wäre es am liebsten, hatte sie einmal zu Melzer gesagt, wenn ihre Asche weit über die Felder, durch die sie so oft in ihrem Leben gebummelt war, verstreut würde. Nur die Erinnerungen sollten bleiben, die man in den Menschen zurückgelassen hat.
Mutter sah Melzer an.
Ja, es seien alte Geschichten, an die sie da rühre, aber eben doch nicht vergessen.
Nicht erst seit dem Brief – schon lange stand Alfreds
Gestalt überdeutlich vor ihrer Erinnerung.
Trotzdem konnte sie nie darüber sprechen, hätte es wohl manchmal gerne getan.
Eine alte Geschichte, sagte ihr Mann.
Fang nicht wieder davon an.
Der Brief hatte etwas in ihr aufgerührt, das nun eine sonderbare Gewalt über sie bekam. Clarissa muß es ähnlich gegangen sein. Auch sie war für die Reise.
Nur Myrtha nicht, sie wollte nicht mitgehen.
Melzer drehte sich um.
Der Schein der Nachttischlampe tauchte das Zimmer in mattgelbes Licht. Auf dem Nachttischchen das Wasserglas, inmitten von Schachteln und Dosen mit Pillen. Mutter war selten krank gewesen, er konnte sich nicht daran erinnern, daß sie einmal länger als einen oder zwei Tage im Bett lag. Das Zimmer hatte sich nicht verändert in all den Jahren. Noch der gleiche hellgraue Teppich zwischen Bett und Schrank.
Über dem Nachttischchen, dunkel abstechend von der weiß geriffelten Wand, eine braune Korkplatte, auf der Mutter mit Stecknadeln jene Fotos befestigt hatte, die ihr wichtig waren: die Bilder der Kinder, Vaters Bild, das Hochzeitsfoto, auf dem Mutter ein junges Mädchen war mit welligem Haar, das ihr in breiten Bahnen über Nacken und Schulter floß, fröhlich lachend, daneben das Bild der Schwestern, junge Mädchen alle drei, Tante Myrtha, die Jüngste, vielleicht siebzehn, mit einem breitrandigen Hut auf dem Kopf, Mutter in einer weißen Rüschenbluse. Ganz am Rande der Platte, leicht schräg, das Foto eines jungen Mannes, den Melzer nicht kannte, ein scharfgeschnittenes, knochiges Gesicht, in dem die dunklen Augen auffielen. Das schwarze Haar war leicht in die Stirn gezogen.
Dieses Foto hatte Melzer noch nie gesehen.
– Alfred?
– Nein, Simon, Simon Levy.
– Ein Jugendfreund?
– Mehr als das.
– Du hast nie etwas erzählt.
Melzer nahm das Foto von der Wand.
Er stutzte.
– Noch eine Geschichte?
– Ein und dieselbe.
3
Melzer schenkte sich ein Glas Roten ein.
Das Foto hing noch immer im Wohnzimmer, hinter Glas in einem billigen Holzrahmen. Die Schwestern am Gartenzaun, das schulterlange Haar mit Schnallen aus der Stirn gesteckt, runde Gesichter alle drei, mit einem gequälten Lächeln um die Mundwinkel, alle gleich gekleidet, Deux-pièces, leicht tailliert und zugeknöpft, der lange Spitzenkragen nach außen gelegt, knielang die Jupes, die Socken in die Wade gerutscht, die Hände in die Hüften gestützt, trotzig abgehoben vom Garten hinter dem Zaun. Kartoffelstauden in den hochgezogenen Furchen.
Sommer 41.
Anbauschlacht. Gemüsegärten wurden ebenso in Äkker verwandelt wie Fußballplätze und Parkanlagen, um den Brotgetreideanbau zu steigern und die Versorgung des Landes sicherzustellen. Kriegsvorsorge.
Mutter hielt zu ihren Schwestern keinen engen Kontakt. Besonders mit Myrtha, die mit einem bernischen Bankbeamten verheiratet gewesen war, hatte sie nach einem Streit kaum noch Verbindung. Doch war Mutter nie bereit, auf die Hintergründe des Streites einzugehen, zu peinlich schien ihr diese Angelegenheit zu sein.
Am besten verstand sie sich mit Clarissa, der Ältesten, die einen Dachdecker zum Manne hatte, der aber noch vor seiner Pensionierung seinen übermäßigen Alkoholkonsum mit einem Herzversagen bezahlt und die Dachdeckerei seinem Schwiegersohn hatte überlassen müssen. Auch Myrthas Mann starb frühzeitig bei einem Autounfall.
Melzer waren Mutters Schwestern als – mit zunehmendem Alter jedenfalls – leicht verschrobene, aber doch liebenswürdige Frauen in Erinnerung, bei deren Erscheinen man aber doch am besten Leine zog und sich bis zu ihrem Abgang nicht mehr blicken ließ. Mit dem Dachdecker hatte er sich noch am besten verstanden, weil er ihn manchmal mit seinem Studebaker zur Arbeit mitnahm, ihn früh auf Dächer klettern und auf diese Weise die Welt von oben anschauen lehrte. Seine Seelenruhe verlor der Dachdecker nur, wenn seine Frau ihm im Laufe des Abends den Schnaps sperren wollte, was vor allem geschah, wenn Tante Myrtha und ihr Mann anwesend waren. Tante Myrthas Mann wäre eigentlich gern Kriminalbeamter geworden, Fahnder, wie er sagte, aber als er die Prüfung für den Eintritt in die Polizeifachschule nicht bestand, wandte er sich dem Bankgewerbe zu, wurde Kassierer einer Raiffeisenkasse im bernischen Seeland. Und das war immer noch eine berufliche Stellung, die Tante Myrtha veranlaßte, sich über ihre beiden Schwestern erhaben zu fühlen. Sie wurde nicht müde, die Verantwortung, die auf einem Bankbeamten ruhte, ihren Schwestern gegenüber herauszustreichen, wobei in ihrer Stimme ein Unterton von Mitleid über deren Los mitschwang. Was waren schon ein Dachdecker und der Angestellte einer Transportfirma, Güterarbeiter, sagte Tante Myrtha, gegenüber einem Bankbeamten. Myrtha litt zwar unter der Tatsache, daß ihr Mann zeitlebens in der gleichen Bank blieb und es nicht zum Prokuristen oder gar Verwalter einer größeren Bank brachte. Sie schrieb dies einer Intrige in der Bankhierarchie zu, die darauf abzielte, ihren Mann in diesem Kaff versauern zu lassen.
Auch wenn Mutter sich mit Tante Myrtha nie besonders gut verstanden hatte, so bedauerte sie doch deren gänzlichen Rückzug. Verständlich, daß Tante Myrtha wenig Lust hatte, mit den Schwestern Alfred zu besuchen.
Alfred Kronig. Simon?
Melzer hätte am liebsten gleich alles wissen wollen.
Geheimnisse im Leben seiner Mutter – damit hatte er nicht gerechnet.
Er ergriff die auf dem Tisch liegende Zeitung. Journal du Jura. Seit wann las Mutter französische Zeitungen. Melzer schüttelte den Kopf. Sie konnte doch kein Französisch.
Er blätterte und brauchte nicht lange zu suchen. Die Meldung war rot umrandet:
Avis mortuaire.
Il est entré dans la Paix de Dieu, muni des sacrements de l’Eglise. Sonceboz, le 5 juin.
Alfred Kronig. Melzer las die kurze Meldung nochmals.
Seltsamer Name.
Er faltete die Zeitung zusammen und entdeckte ein zweites Blatt, vergilbt und wasserfleckig, eine Zeitung aus der Kriegszeit, 12. August 41, eine knappe Meldung auf der Lokalseite.
Auf dem Tisch lag auch ein Reiseführer der Baltischen Staaten mit einem Bild der Stadt Riga. Für Helen herzlich Simon.
Melzer eilte nach oben.
Mutter schlief noch immer, als er das Zimmer betrat; nur die kleine Nachttischlampe brannte, warf ein trübes Licht auf ihr zur Seite gewendetes Gesicht. Ihr Haar, seit Jahren von einem hellen Grau, fast weiß, schien von einer sonderbar gelblichen Färbung, die ihm früher nicht aufgefallen war, und gelb erschien auch ihre Haut, trocken und matt, weiß um Mundwinkel und Augen. Es mochte am Licht liegen oder an seinen Augen, die, noch geblendet vom hellen Schein der Neonröhren im Korridor, sich erst ans Halbdunkel im Zimmer gewöhnen mußten.
Melzer zögerte, blieb unvermittelt stehen. Mutters Hände lagen verkrampft auf der Decke, in die Daunen festgekrallt, gelblich die Haut um die Nägel, die gläsern erschienen.
Melzer bezwang seine Neugier, ließ die zum Klopfen erhobene Hand sinken.
Unbeweglich verharrte er mitten im Raum, die Hände in den Taschen. Er musterte die Gegenstände im Zimmer, als sähe er sie zum erstenmal: das breite Holzbett, zweigeteilt, ein kleiner Graben in der Mitte, handbreit vielleicht, der die Matratzen trennte, die niedrigen Nachttischchen aus dem gleichen dunkelbraunen Tannenholz; und über dem Nachttischchen das gerahmte Bild des Ehepartners, so wie er damals war, als man dieses Bett kaufte und anfing, die Nächte miteinander zu verbringen, getrennt durch den kleinen Graben dazwischen, nah genug, um den Atem des andern zu vernehmen und die Unruhe, die seinen Schlaf störte, und doch zu weit, um wirklich Nähe zu fühlen. Jeder auf seiner Seite, jeder mit einem Hocker neben dem Bett für die abgelegten Kleider, jeder mit dem Bild des andern an der Wand. Und Jahre waren hingegangen über dieses Zimmer, der Lack auf den Möbeln war abgeblättert, rissig das Holz, der Spiegel stockfleckig geworden; und die Gesichter in den Betten paßten immer schlechter zu den Gesichtern auf dem Bild, und immer seltener suchte wohl die Hand über den Graben hinweg die Hand des andern. Was führten die Eltern für ein Leben? Eine Mutter, die litt, ein Vater, der ihm immer fremd geblieben war.
Melzer maß immer von neuem die Gegenstände, Bett, Kommode, Schrank, Hocker. Er stellte sich die Gesichter vor, die Körper, die um diese Gegenstände sich bewegten, all die Jahre, die Veränderungen, die an diesen Körpern vor sich gingen, die Gespräche, die seltener wurden, kürzer der Schlaf in der Nacht, dünner und unruhiger, von Bildern geplagt, von Gedanken; naß vom Schweiß der Schlafanzug, kein Mut, Licht zu machen, aus Angst, den andern, der jenseits des Grabens in seinen Laken sich hin und her wälzte, zu stören. Und der andere hing vielleicht den gleichen