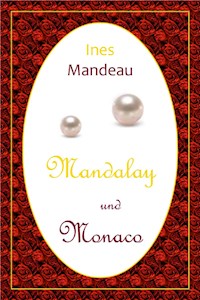Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf Geschichten handeln jeweils vom Verschwinden einer Person. Man könnte meinen, es werde gemordet, aber es fließt kein Tropfen Blut; und ein Täter zeigt sich auch nicht. Es sind Frauen, die es trifft: Rosmarie verblasst, die patente Monika stürzt ab, Frau Müller verhungert, die ominöse Rossi dürfte erstickt sein und eine gewisse Wanda langweilt sich zu Tode.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Siehe Ende des E-Books.
Inhalt:
Fünf Geschichten handeln jeweils vom Verschwinden einer Person. Man könnte meinen, es werde gemordet – aber es fließt nicht ein Tropfen Blut, und Täter zeigt sich auch keiner.
Rosmarie verblasst.
Monika stürzt ab.
Frau Müller verhungert.
Rossi erstickt,
und Wanda langweilt sich zu Tode.
Hier sind sie:
1. Rosmarie färbt ab – Wie eine Welt im Rosenrot ertrank
2. Philemon und Baucis – Eine verhängnisvolle Liebe zu Bäumen
3. Die stille Frau Müller – Bartleby, der Schreiber, lebt
4. Eine haarige Begebenheit – Krimigroteske
5. Der ausgezogene Ehemann – Ein kurzes Stück über die lange Weile
1. Rosmarie färbt ab – Wie eine Welt im Rosenrot ertrank
Einen Tag vor dem Familienfest, das Rosmarie zu ihrem eigenen fünfzigsten Geburtstag sorgfältig und längst fertig vorbereitet hat, erwacht sie nach schwerem Nachtschlaf früher als gewöhnlich. Benommen rutscht sie auf die Bettkante und will sich gerade die Pyjamahose hochziehen, da bemerkt sie rote Flecken, die die Haut ihrer Beine beschatten wie dunkle Wolken. Sie beugt sich vor und tastet über die auffälligen Stellen, die sich ohne erkennbares Muster von den Füßen bis zu den Oberschenkeln ausbreiten. Ein Gefühl von wallender Wärme strömt zum Bauch hinauf. Ansonsten ist nichts zu spüren, kein Schmerz, keine Spannung, nichts dergleichen.
Eine vorübergehende Irritation, denkt Rosmarie, das wird morgen abgeklungen sein. Sie verbringt den Tag wie üblich, um sich in der vertrauten Arbeitsroutine eine Verschnaufpause vor dem mit Sicherheit turbulent werdenden Geburtstagsfest zu verschaffen. Die roten Flecken vergisst sie. Erst vor dem Schlafengehen begutachtet sie erneut ihre nackten Beine. Die Rötung ist zwar nicht verschwunden, aber doch sichtlich schwächer geworden. Beruhigt fällt Rosmarie in ihr Bett und schläft die Nacht durch.
Am nächsten Morgen, als sie sich im Badezimmer die Augen frei rubbelt, hält sie plötzlich inne und starrt in ihr Spiegelbild. Ein vollkommen rotes Gesicht schaut ihr entgegen, und die Hände sind ebenfalls rot. Rasch steigt sie aus dem Pyjama, dreht sich vor dem Spiegel und sieht: Rot ist der ganze Körper, als ob er in der Nacht trotz Morpheus’ Wache von geheimen Geisterkräften durch eine Färbetunke gezogen worden wäre. Nicht ein Fleckchen der gewohnt blassbleichen Haut ist übrig; nicht der winzigste, tröstliche Abdruck eines Lindenblattes auszumachen.
Rosmarie staunt, spürt indessen keinen Schmerz, kein Jucken, kein Brennen, nichts, noch nicht einmal ein Missbehagen und auch nicht das geringste Grauen. Trotzdem, denkt sie, es ist wohl besser, ins Krankenhaus zu gehen und die Sache untersuchen zu lassen, zumal dies kaum einen Aufwand bedeutet, da sich das Landesklinikum praktisch gegenüber ihrem Wohngebäude befindet. Sofort läuft sie los und erreicht die Ambulanz zu Fuß in wenigen Minuten. Niemand begegnet ihr, es ist früh am Morgen und ein dunkler Herbsttag.
In der Notaufnahme nimmt man Rosmarie auf der Stelle ihre Kleider und Schuhe weg – das sei Sondermüll –, und ordnet mit Nachdruck an, dass sie sich auf eines dieser rollenden Betten legen müsse. Widerstrebend tut sie wie verlangt. Eine Schwester breitet ein weißes Laken über ihren Körper, reine Vorbeugungsmaßnahme, erklärt sie, es handle sich möglicherweise um eine Epidemie. Rosmarie protestiert nun, sie habe nicht die mindesten Beschwerden und wolle lediglich wissen, was gegen diese Hautirritation zu unternehmen sei.
Psst, beschwichtigt die Schwester und zieht das Laken straff, wir bringen Sie jetzt ins Labor.
Rollend geht es um eine Reihe von Ecken, und dann weiter mit einem Lastenaufzug hinunter ins tiefe Innere des Krankenhauskomplexes. Hier, in einem Laboratorium, warten Ärzte und Helfer, die einen mit weißen, die anderen mit blauen Kitteln bekleidet. Sie sind gerüstet und wirken besonnen. Niemand spricht mit Rosmarie, deren Kopf zugedeckt bleibt, während die Fachleute ohne Umschweife den roten Körper untersuchen. Sie betasten die Haut, zwicken ins Gewebe und zerren daran, streichen und drücken es, ja sie beklopfen es sogar mit ihren Fingerknöcheln, und wollen nicht aufhören mit dieser Prozedur.
Rosmarie lässt alles schweigend geschehen und lauscht angestrengt, um vom Expertengenuschel etwas zu verstehen. Es fallen medizinische Fachausdrücke, die Rosmarie nicht begreift. Endlich sagt jemand: Wir müssen sie unter Beobachtung halten, Quarantäne, die Sache könnte ansteckend sein und außer Kontrolle geraten.
Zwei Pfleger schieben das Bett mit der Patientin in ein Zimmer, dessen einziges Fenster einen Durchguck gewährt auf eine Betonmauer in Griffnähe; dort draußen ist nur ein Luftschacht, aber das kann Rosmarie nicht mehr sehen.
Ihr Bett wird in der Mitte des gänzlich unmöblierten Raumes abgestellt. Die vier Rollen rasten in exakt bemessene Fußbodenvertiefungen ein, sodass ein Bewegungsspielraum restlos ausgeschlossen ist. Vom Plafond strahlen unterschiedlich grelle Leuchten in Violett- und Blautönen, die die Haut beruhigen sollen. Rosmarie sagt noch einmal und ein letztes Mal, dass sie sich nicht krank fühle und ihr diese Behandlung übertrieben erscheine, und sie gerne nach Hause möchte zu ihrem Geburtstagsfest.
Ja, ja, murmelt der Pfleger und schnallt sie auf der Bahre fest, das kriegen wir schon hin. Sie müssen jetzt ganz entspannt liegenbleiben, das ist alles zu Ihrem Besten. Zum Schutz der Augen stülpt er Rosmarie eine Maske, die aus zahlreichen Schichten engmaschiger Mullbinde gefertigt ist, übers Gesicht. Dann geht er.
Er kommt nicht wieder.
Die Zeit verrinnt.
Rosmarie liegt regungslos.
Sie wird vergessen.
Sie hat vergessen.
Eines Abends jedoch ist ein zartes Rascheln und Raunen zu hören. Das Rot blättert von der Haut und fällt ab wie trockenes Herbstlaub. Rosmarie liegt in einem Haufen luftiger Schuppen und Flocken. Ihre Haut strahlt frisch und hell und prickelt wundersam. Ich bin gesund!, jubelt sie und hüpft von der Bettstatt, nackt und rosig. Sie saust aus dem Zimmer und läuft jauchzend durch ein menschenleeres Gängelabyrinth, springt wie ein Reh die verwinkelten Stiegen nach oben und landet beim Empfangstresen des Krankenhauses, als hätte sie sich an einem roten Faden bis genau hierher gehangelt.
Der Rezeptionist zeigt nicht das leiseste Anzeichen von Erstaunen, er zeigt überhaupt keine Regung, sondern händigt ohne Worte die Entlassungspapiere aus und deutet mit einer Geste an, sie möge das Gebäude unverzüglich verlassen.
Eine Welle nie gekannter Freude durchglüht sie. Eine jede Menschenseele solle wissen, dass sie wieder gesund und in der Welt ist. Sie rennt zum Ausgang. Hinter ihr fällt das Tor in ein klackendes Schloss.
Sie schleudert beide Arme in die Lüfte und will ihr Glück hinausposaunen, wirft aber dabei versehentlich einen Blick zu Boden – und erstarrt vor Entsetzen. Ihre Fußsohlen stecken in einer rosa Lache, einer sattfarbenen Tunke, die sich träge ausbreitet und den grauen Asphalt bedeckt; sie beginnt zu rinnen und fließt die Auffahrt hinunter, zunächst lautlos, dann mit einem brausenden Geräusch und immer rascher – so strömt und stürmt sie voran, die Straße entlang, wächst und überzieht den Boden in Blitzeseile mit einer rosa Tünche, einem flüssigen Film; und als der Boden bis hin zum fernen weiten Horizont vollends rosa und das letzte Fleckchen Erde einverleibt ist, da erhebt sich die rasende Tünche und schwappt in die Höhe und tränkt die Menschen und Autos im Abendverkehr, die betonierten Fassaden der städtischen Häuser, die nahtlos die Fahrstraße säumen; und die kahlen Alleebäume neben dem Trottoir; sie verschlingt jegliches Ding, jede dingliche Gestalt, einfach alles – unaufhaltsam, immer schneller, ein Furor sondergleichen.
Rosmarie steht angewurzelt.
Sie ist weiß wie Kalk.
Und dann verblasst sie an Ort und Stelle, während der Rest der Welt sich rosen färbt bis in den Himmel hinein.
*****
2. Philemon und Baucis – Eine verhängnisvolle Liebe zu Bäumen
Rien ne va plus
Nun hat es mich doch mitten ins Oktoberfest verschlagen. Allerdings nicht auf die Wiesn in München, wo der Rummel am heutigen letzten Samstag im September bereits auf Hochtouren läuft und meine Spezln im Augustiner-Bräu ohne mich feiern werden, nein, ich sitze fast tausend Kilometer entfernt auf der Terrasse des Café de Paris in Monte Carlo an einem der eng gestellten Bistrotischchen und beobachte die Vorbereitungen für ein Oktoberfest, das wohl in Kürze hierzulande über die Bühne gehen soll. Man könnte meinen, einer der Münchner Festwirte wäre mitsamt seines Wiesn-Inventars ausgewandert und hätte sich im Fürstentum an der Côte d’Azur niedergelassen. Was für ein Gewimmel und Gewusel!
Und was für eine putzige Dekoration! Bunte Girlanden und grüne Kränze, saftig und prall, ich glaube gar, frische Eichenblätter sind’s, und die blau-weiße Plane, die über den schmalen Platz zwischen dem Café und dem langgestreckten Casinogebäude gespannt ist, ein Minimundus-Bierzelt sozusagen, schaut bayerischer aus als bayrisch. Neben seinem Eingang hängen ganze Trauben Lebkuchenherzerl und drüber sehe ich ein schnuckeliges Schild mit der Aufschrift Oktoberfest, genau so, in deutscher Sprache, und es ist das einzige Wort, das ich verstehe inmitten dieser französischen Klangkulisse. Ich kann kein Französisch, und Monaco kannte ich bis zum heutigen Tag auch nicht, geschweige denn, dass ich von der Existenz eines angeblich original Münchner Oktoberfestes nächst der Heiligen Hallen des Casinos Monte Carlo gewusst hätte.
Dieses Fest ist jedenfalls nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Ich wundere mich über die Maßen, überhaupt hierher gereist zu sein, so hastig und unbedacht, dass ich mir an den Kopf greifen muss. Alter schützt vor Torheit nicht, wie wahr, wie wahr. Wenigstens schmeckt der Cappuccino genial. Wie viel mich das edel servierte Getränk kosten wird, will ich gar nicht wissen; ich habe die Rechnung mit zugekniffenen Augen unter das Silbertablett geschoben und spare mir den Schock im Geldbörserl für später auf.
Meine dicke Jeans drückt grauenhaft und um dem armen Bauch ein bisschen Erlösung zu verschaffen, öffne ich den Knopf am Hosenbund und ziehe den Reißverschluss ein Stückchen nach unten. Dabei schaue ich mich verstohlen um, aber keiner der Gäste dieses noblen Cafés scheint mir und meinem kleinen Striptease Aufmerksamkeit zu schenken. Entschlossen knöpfe ich meine Hemdbluse so weit auf, wie es die Sittsamkeit gerade noch erlaubt, und lasse das nackte Dekolleté und mein Gesicht von der milden satten Spätsommersonne wärmen. Bald wird sie hinter dieser markanten Bergnase verschwinden, die den Horizont im Westen dominiert und deren Namen ich zu gern wüsste. Wenn es dunkel wird, so gegen zwanzig Uhr, werde ich zum Bus sausen, der mich zum Flughafen nach Nizza bringt, für den späten Rückflug nach München, auf den ich eingebucht bin. Bis dahin vertreibe ich mir die Zeit auf der Terrasse des schicken Café de Paris und kann meine konfusen Gedanken ordnen.
Mein Blick schweift über das begrünte und bepflanzte Rondell zwischen den Bistrotischen und dem gegenüberliegenden Hôtel de Paris nur einen Steinwurf entfernt. Vielleicht entdecke ich hier Zypresse, Johannisbrotbaum und Oleander? Wegen ihnen bin ich nämlich nach Monaco geflogen. Ich bin schon viel und aus verschiedensten Gründen gereist, allerdings noch nie, um irgendwo im Ausland drei Bäume aufzustöbern. Genauer gesagt suche ich sechs Bäume zu drei Paaren gruppiert. Das klingt ziemlich kompliziert und es kommt noch schlimmer, denn neben den jeweils zwei Zypressen, Johannisbrot- und Oleanderbäumen will ich eine Linde und eine Eiche finden, kirchturmhohe Giganten, die ebenfalls in Monte Carlo zu sehen sein sollen.
Meinen Freunden habe ich von dieser Baummission nichts erzählt, wegen der berechtigten Befürchtung, sie könnten mir den Vogel zeigen. „Jetzt übertreibt sie mal wieder mit ihrer Naturbegeisterung, unsere Moni“, würden sie vermuten. Aber meine Naturbegeisterung ist nicht der Grund für diesen Trip! Und Bäume habe ich bei mir in München genug, dafür brauche ich nicht weiß Gott wohin fahren. Ich bin hier, weil ich vor zwei Wochen eine Geschichte gehört habe, die mir keine Ruhe lässt.
Ein Erzählfest in der Burg
Angefangen hat alles vor etwa drei Monaten, im Juli, als ich in meinem Büro die Anmeldungen bestätigte für eine Seminarwoche, die ich per Internet organisierte. Es handelte sich um das Treffen einer Runde von Erzählkünstlern aus dem süddeutschen Raum, die sich regelmäßig jedes Jahr in einer Südtiroler Burg zum Gedankenaustausch und zur Weiterbildung zusammenfindet. Eine gewisse Monika W. aus Monaco erkundigte sich per E-Mail, ob einer der angebotenen Kursplätze für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse noch vakant sei. Jawohl, einen davon hatte ich noch zu vergeben, dann wäre die Mannschaft komplett mit ihren insgesamt zwölf Personen.
Monika? Wie nett, dachte ich, sie heißt wie ich. Und wohnhaft in Monaco? Interessant! Eine Monegassin hatte ich bisher nicht unter den Teilnehmern der vielen Workshops und Vergnügungsfahrten und dergleichen Veranstaltungen, die ich in meiner langen Berufslaufbahn in der Reisebranche schon gedeichselt habe. Ein Schuss südländisches Flair tut den Kopfarbeitern sicherlich gut, überlegte ich und da die makellos formulierte Anfrage der Interessentin aus Monaco keinen Zweifel an der Beherrschung der deutschen Sprache ließ, nahm ich Monika W. als Novizin in die heurige Gruppe auf. Sie würde sich bestimmt behaupten können unter den gelernten Wortjongleuren.
Die meisten von denen kennen sich bereits seit halben Ewigkeiten, und mich kennen sie auch bestens, denn ich begleite sie zum wiederholten Male auf ihrer Reise und verbringe die Woche mit ihnen. Diese Septembertage im Gebirge sind der liebste Urlaub, den ich mir wünschen kann. Untertags wandere ich nach Lust und Laune zwischen Apfelbäumen und Rebstöcken, durch Föhrenwälder und auf Almwiesen und abends darf ich – quasi in der Rolle des Publikums – im holzgetäfelten Turmzimmer der Burg den Wörterhelden zuhören, die ihr aktuelles Bühnenprogramm, großteils im unfertigen Werkentstehungsprozess, den Kollegen vom Fach vorspielen und miteinander besprechen.
Erzähler sind ein Völkchen, das ich besonders gerne mag. Sie haben ein unglaubliches Talent, Begeisterung zu wecken und Herzensfeuer zu entfachen. Es wird gelacht und gescherzt, gesungen und getanzt, und nichts ist zu spüren von der Müh und Plag, die es braucht, um eine gescheite Geschichte auszudenken und spannend herzurichten und sie frei aus dem Gedächtnis einem Publikum vorzutragen. Ich könnte das nicht und bewundere diese Mundwerker, wie sie sich selber nennen, über alles, und freue mich jedes Jahr auf die Woche mit ihnen im traumhaft schönen Südtirol.
Kursleiter Roland besteht darauf, immer zwei oder drei von ihm sogenannte Novizen mitzunehmen, unter anderem deshalb, um an frischen Probanden zu prüfen, wie die didaktischen Konzepte für das Erlernen der Erzählkunst zu verfeinern wären. Die Auswahl dieser Kandidaten ohne Vorkenntnisse überlässt er mir. Heuer pickte ich einen jungen Mann aus Düsseldorf aus der Bewerberliste, um den stark frauenlastigen Künstlerzirkel mit einem maskulinen Element zu würzen, sowie eben besagte Monika aus Monaco, die von allen Anfragenden die meiste Neugier in mir geweckt hatte.
Mit dem Zug werde sie kommen, schrieb sie kurz vor Seminarbeginn, und könne voraussichtlich beim gemeinsamen Essen, das um achtzehn Uhr angesetzt war, nicht dabei sein, denn ihre Anfahrt dauere zehn Stunden und wer wisse schon, ob alle Anschlüsse beim Fünf-Mal-Umsteigen klappen würden.
Es klappte nicht. Spätnachmittags erhielt ich eine SMS von Monique – unter diesem Namen hatte ich ihre Nummer gespeichert – mit dem Inhalt, die Ankunft verschiebe sich auf zwanzig Uhr und ob ich sie vom Bahnhof abholen könne. Ich informierte die Tischrunde im Speisesaal, die inzwischen genauso gespannt war auf den aus Monaco anreisenden Spätankömmling wie ich. Die Leute wollten nichts verpassen und blieben nach der Mahlzeit bei einem weiteren Glas Wein sitzen. Unterdessen flitzte ich zum Bahnhof.
Es war bereits dunkel und nieselte, als ich vor dem kleinen Stationsgebäude wartete. Dem Regionalzug entstiegen nur wenige Menschen, Wanderer mit ihren Rucksäcken zumeist, aus denen die Exotin sofort herausstach: Eine hochgewachsene, schlanke Gestalt in dunkler Hose und hellem Blazer, einen Rollkoffer hinter sich herziehend, das musste die Monegassin sein.
Sie winkte, ich winkte zurück. Bei der Begrüßung kam sie mir zuvor, eine lebhafte Person, der ein wippender Pferdeschwanz, zu dem sie ihre langen Haare zusammengebunden hatte, eine jugendliche Silhouette verlieh. Nichts war ihr anzumerken und kein Wort verlor sie über die mit Sicherheit strapaziösen zwölf Stunden in der Eisenbahn, ja sie entschuldigte sich sogar, zum Abendessen und damit zur ersten Gruppenzusammenkunft nicht pünktlich erschienen zu sein. Ich hörte den schwäbischen Akzent in ihrer Rede mitklingen und sollte später erfahren, dass sie ihre Kindheit am Bodensee verbracht und im Übrigen zu Bayern eine enge Beziehung hatte. Sie freue sich auf die kommende Woche, sagte sie mehrmals, während ich mein schwachbrüstiges Miniauto durch die eckigen Dorfgassen steuerte und mit den wenigen Pferdestärken die Anhöhe zur Burg hinaufruckelte.
Die freie weite Aussicht talein- und talauswärts dürfte es anno dazumal den gräflichen Bauherrn angetan haben, als sie auf diesem paradiesischen Flecken Erde die Errichtung einer Stammburg befohlen hatten. Das Herrschaftshaus und seine Nebengebäude sind großräumig von einer annähernd quadratisch angelegten, hohen Steinmauer umgeben, auf deren hangabwärts gelegenen Front ein gewaltiges, geschmiedetes Portal Einlass in das Innere der Anlage gewährt. Davor befindet sich der sauber gekieste Parkplatz. Ich stellte mein heiß gelaufenes Wägelchen ab, wir stiegen aus und mein Gast rief: „Ah, wie herzergreifend wunderschön!“
Herzergreifend wunderschön? Ich folgte dem Blick der offenbar entzückten Frau und sah das sanft ausgeleuchtete doppeltürige Portal, zu dessen Flanken die mächtigen Stämme von zwei alten Walnussbäumen Wache hielten, deren beider Laubkronen oberhalb des Torbogens ineinander wucherten und den Eingang zur Festung mit dichtem, noch sommergrünem Blätterwerk umkränzten.
„Fein, dass Sie sich wohlfühlen“, griff ich auf mein Profi-Vokabular zurück und ärgerte mich über diesen platten Satz, denn in Wirklichkeit fand auch ich die Stimmung schlicht und einfach herzergreifend wunderschön. Doch Sentimentalitäten schienen mir im Moment unpassend, ich war im Dienst und hatte dafür zu sorgen, die nach und nach eintrudelnden Kursteilnehmer zu empfangen und einzuweisen, und Dienst ist Dienst, da kenn ich kein Pardon. „Ich zeige Ihnen zuerst Ihr Zimmer im Gästehaus und wenn Sie mögen, stelle ich Sie gleich unserer Runde vor. Sie sind alle zusammen im Speisesaal drüben.“ Ich deutete mit meinem Zeigefinger die Richtung an.
„Dann wollen wir sie nicht länger warten lassen“, sagte meine Begleiterin freundlich.
Das Gästehaus war ein nagelneuer Trakt; man hatte es kürzlich an die Ostseite der Außenmauer zugebaut, um den Teilnehmern von Klausuren und Seminaren praktisch im Burggelände eine Herberge zu bieten. Die Einbettzimmer sind klein geschnitten und karg möbliert, und vermitteln mit ihren weißgekalkten Wänden das Flair eines klösterlichen Exerzitienhauses. Die Abwesenheit von Komfort-Schnickschnack soll die geistige Einkehr anregen. Lediglich beim Fußboden wurde auf Luxus gesetzt; er ist aus Vollholzplanken und beheizt, was mir überaus genehm ist.
Ich hoffte, die Monegassin wäre nicht allzu enttäuscht von der nüchternen Unterkunft, und dachte insgeheim: Hoffentlich meckert sie nicht.
Das tat sie nicht. „Sehr gut“, sagte sie, als sie im Zimmer rasch die Hände am Wasserbecken wusch und heiter hinzufügte: „Dann wollen wir mal.“
Wir liefen quer über das Geviert hin zu dem Gebäude, das früher den Nutztieren als Stall gedient hatte, nun jedoch zu Küche und Speisesaal umfunktioniert ist. Ich liebe diese Küche! Dort werkt eine Brigade tüchtiger Frauen unter dem Kommando von Anna, der Chefköchin, die bodenständig und gekonnt die Früchte aus den Gärten und Wäldern der Umgebung in g’schmackige Gaumenfreuden zu verwandeln versteht.