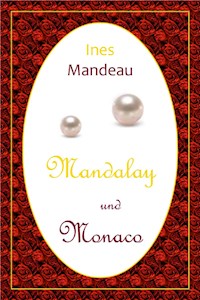Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hält ein altes Paar zusammen? – Eigentlich sollte es kein Problem sein, das Geburtstagsfest für einen teuren Freund auszurichten, vor allem wenn man wie Rosa Sternauer in Monaco wohnt und in früheren Jahren eine umtriebige Geschäftsfrau war. Sie jedoch ist von einer Krankheit geschwächt und im Grunde ihres Wesens eine spröde Person mit poetischen Anwandlungen und anderen Marotten, die wenig hilfreich sind, um das Nötige für eine vernünftige Feier zu besorgen. Rosa will zwar ernsthaft die tüchtige Organisatorin hervorkehren, tatsächlich aber schweift sie planlos durch die Gegend, betrachtet Bäume, Blumen und Gesteine und dichtet aus dem Stegreif sonderbare Verse. Dabei versinkt sie in Erinnerungen an eine bäuerliche Kindheit in den Bergen und an jene Zeitenwende, zu der Vitus, der Jubilar, in ihr junges Leben eingetreten ist. Es scheint, als würde der Festakt sehr dürftig ausfallen, zumal es keine Partygäste gibt. Glücklicherweise ist Vitus ein begnadeter Koch und rettet zumindest das leibliche Wohl von Geburtstagskind und Gratulantin. Nach dem gemeinsamen Kochen, Essen und Trinken brechen die beiden Helden auf in eine Vollmondnacht, erkunden den Skulpturenpark von Fontvieille und probieren sich im Künstlertandem: er als eifriger Fotograf, sie als Möchtegern-Aktrice. Irgendwie gelingt diese schräge FÊTE DE DEUX; am Ende freilich, da ist jemand tot. – Ein hohes Lied auf die Kunst des guten Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Copyright © Juli 2017
Text und Gestaltung: Ines Mandeau
Kontakt: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Bildnachweis:
pixabay.com/Creative Commons
Verlag: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN: siehe Verlagsangabe
Dieser Titel erscheint auch als Printbuch.
Die Geschichte und ihre Figuren verdanken sich der Fantasie des Autors. Die genannten Orte sind großteils real, ihre Beschreibung hingegen ist fiktiv.
Das sind die Lieblingsorte, wo ich träumte,
Die Wiesen, deren Blumen ich besang.
Amable Tastu
Kapitel
1. Marillenbäumchen
2. Tour Odéon
3. Die Wiese und das Mädchen
4. Töchter des Lichts
5. „Was wünschst du dir?“
6. Das blaue Heldenglied
7. Mama Else ohne Enkel
8. Die Wanderin
9. Schälen und schaben
10. Zwischen Herd und Tisch
11. Brotlose Kunst
12. Ich will nicht hängen an der Wand
13. Abgespült und aufgeschminkt
14. Verknotet
15. Servi Muti
16. „Glaubst du, es wird Früchte tragen?“
17. Auflösung
1. Marillenbäumchen
Unerbittlich naht Vitus’ Geburtstag. Was kann ich einem Mann schenken, der augenscheinlich alles hat und auf Nachfrage hin stets beteuert, er brauche nichts? Mit Dingen wie Krawatten und Parfums, Büchern, iPods und generell mit Apparaten jeglicher Art, ist er kaum zu beglücken und auch Urlaubsreisen, Restaurantbesuche und derlei öffentliche Veranstaltungen sind ihm eher Pein als Vergnügen. Und sonst? Was wäre denn ein akzeptables Präsent anlässlich eines Ehrfurcht gebietenden, siebenundsechzigsten Geburtstages?
Mir will partout nichts einfallen und das ist ein jämmerlicher Befund, ein blamables Zeugnis meiner Kompetenz, weil ich nach über drei Jahrzehnten Lebensgemeinschaft eigentlich wissen sollte, was mein getreuer Gefährte sich insgeheim wünscht. Seit Wochen streife ich durch die Stadt und studiere die Schaufensterauslagen im Hinblick auf eine gelungene Überraschung für Vitus, aber ich mühe mich vergebens, nicht eine Sache in den mit Sachen reich bestückten Vitrinen spricht mich an. Je näher der Feiertermin rückt, desto nervöser werde ich angesichts meines offenkundigen Versagens, etwas Hübsches zu beschaffen, du liebe Güte, was ist daran schon kompliziert!
Am ersten Samstag im März, vier Tage vor der Party, stehe ich immer noch mit leeren Händen da. Während ich eilig die morgendliche Hausarbeit erledige, beschließe ich, die unbestimmte Sucherei nach einem passenden Geschenk an ein Ende zu bringen. Jawohl, heute schreite ich zur Tat und kaufe etwas, irgendetwas für den Jubilar, um in dieser leidigen Geschichte zu einem Schlusspunkt zu gelangen und meine innere Ruhe zu finden. Gleich vormittags breche ich auf, die Füße eingepackt in Wollsocken und ausgetretenen Turnschuhen für den Fall, dass die Shoppingmission einen längeren Marsch durch die Stadt erfordert, und beflügelt von dem entschiedenen Vorhaben, nicht ohne Beute in die Wohnung zurückzukehren.
Das nächstgelegene Geschäft, in dem ich fündig werden könnte, ist Carrefour, ein Supermarkt in Fontvieille, wo wir unsere Güter des täglichen Bedarfs besorgen, im Wirtschaftsbuch kurz GTB genannt. GTB klingt ziemlich unspektakulär für meinen feierlichen Vorsatz, aber Carrefour ist das Lieblingsgeschäft von Vitus, der hier mit Hingabe und Begeisterung jene Zutaten auswählt, die er zum Kochen benötigt. Schlimmstenfalls, so das Kalkül, kann ich ein paar käuflich erwerbbare Spezereien und Gustostückerl zu einem gefälligen Paket zusammenstellen. Das ist zwar nicht besonders originell, erhielte jedoch sicheren Zuspruch, da Vitus einen jeden Gaumenschmaus zu schätzen weiß.
An den Samstagen ist der Laden noch verstopfter als gewöhnlich mit Menschen und den stählern blitzenden Einkaufswägen, deren Körbe so großzügig bemessen sind, dass nebst den Bergen von Produkten je ein oder zwei Kinder darin Platz haben. In einem solchen Kampfrollator sind die Sprösslinge gut aufgehoben und gehen nicht verloren in dem Gewimmel und Getümmel, das zwischen den Regalreihen und Verkaufstruhen aufgeführt wird wie ein furioser Bühnenakt in Endlosschleife. Die beengten Verhältnisse in diesem Tempel der Genüsse wirken auf empfindsame Gemüter schnell beklemmend und können leicht den Fluchtreflex auslösen, was ich an Touristen des Öfteren beobachte, die mit entsetzten Mienen auf der Schwelle kehrtmachen und lieber mit hungrigen Mägen das Weite suchen, als sich vorzuwühlen zur Theke mit dem begehrten pan bagnat, dem mediterranen Mega-Sandwich.
Hier im Ladeninneren ist es nun mal so bestellt wie allerorts im kleinen Fürstentum: Eine Unmenge an Menschen hat sich mit äußerst begrenztem Territorium zu begnügen. Als mehrjährige Residentin bin ich mit den Maßstäben im Zwergenstaat vertraut und nehme den Wirbel ohne Wimpernzucken hin gleich den meisten Einheimischen. Wenn das Gedränge im Carrefour dennoch beginnt, meine Nerven zu strapazieren, dann drossle ich das Tempo, halte mich an den Rändern der Trampelpfade und lasse sie vorbeirauschen, die hetzenden Leute mit dem Tunnelröhrenblick.
Momentan bewege ich mich denn auch im Modus einer Landschildkröte durch das überlaufene Konsumparadies. Ich tripple hautnah an den mannshohen Regalaufbauten entlang, wobei meine Augen das Warenangebot von oben nach unten, von links nach rechts abscannen, als würden sie den Inhalt einer Exceltabelle von Zelle zu Zelle und Spalte zu Spalte kontrollieren; dabei den einen oder anderen interessanten Artikel vormerken und ihn im Geiste abspeichern für einen möglichen Kauf. Ernstlich zugreifen werde ich erst, wenn sämtliche Alternativen erwogen sind und ich somit für eine optimale Entscheidung gerüstet bin.
Als ich im Exotensegment bei den produits du monde fündig zu werden hoffe und konzentriert einen nächsten Schritt zur Seite setze, stößt mein Fußknöchel hart an eine Holzpalette, auf der eine Charge Zimmerpflanzen in Kunststoffkübeln angeliefert worden ist. Ich gerate ins Schlingern und wäre fast in den grünen Wald hineingekippt, doch mit knapper Not balanciere ich meinen taumelnden Körper ins Lot, fasse mich und bin erleichtert, dass die Unachtsamkeit keine bösen Folgen hat, und außerdem ein bisschen stolz, trotz meines Alters so reaktionsflink zu sein, einen halben Sturz abfangen zu können.
Während ich den verrutschten Riemen des Schulterbeutels zurechtrücke und am zerknautschten Blazerärmel zupfe, fällt mein Blick auf ein buntes Schildchen, das aus dem dichten Blätterwerk herausleuchtet. Nanu, was ist denn da im Busche? Ich beuge mich vor und lese: apricotier nain – Marillenbaum, genauer: ein Zwergmarillenbaum. Tatsächlich, zwischen den Yuccalanzen und Palmenwedel, den gummigen Fici und fleischigen Philodendren, lugen dürre Zweige hervor, die einem kaum kniehohen Stamm entwachsen und von winzigen schwellenden Knospen übersät sind. Ein paar wenige davon sind bereits „aufgegangen“, wie mein Vater, der zahlreiche Obstbäume um seinen Bauernhof gepflanzt hat und auf diesem Feld bewandert ist, zu sagen pflegt, wenn sich die Knospen zu Blüten öffnen.
Ich gehe in die Hocke, um die delikate Entdeckung unter die Lupe zu nehmen. Die weißen, rosa angehauchten Kronblätter schimmern samtig und scheinen so weich und verletzlich, dass ich mich frage, wie sich aus diesem dünnen zarten Nichts des gros fruits entwickeln sollen, fette Früchte, und das schon im Juli, in fünf Monaten? Schwer zu glauben, aber auf dem Plastikkärtchen, das dem Stamm umgehängt ist, steht es versprochen, Ernte im Juli, heißt es da.
Und plötzlich fällt mir unser Marillenbaum ein. Ächzend richte ich mich auf und knicke dabei wieder halb um, als ein vorbeistürmender Einkaufspanzer mit einem quiekenden Knirps im Ausguck mein Hinterteil streift und mein krummes Gestell in bedrohliche Schieflage versetzt. Erschrocken stammle ich eine Entschuldigung für die Karambolage, doch der energische Shopper steuert seinem anvisierten Ziel, einer Gefriertruhe mit Sonderangeboten, ungerührt entgegen, als hätte er die Frauengestalt, die sich aus dem botanischen Dickicht schälte, gar nicht bemerkt. Dem Mann sei vergeben, er ist gestraft genug, samstags einsam seinen Einkaufswagen zu schieben statt mit den Kumpels Fußbälle auf dem Sportplatz zu kicken.
Ich stehe still wie angewurzelt und schaue in die Zimmerpflanzen. Schließlich haben sie mich aus der Bahn geworfen und nicht etwa ein flotter Athlet vom Typ Wochenendpapa. Mein Blick sucht die schlichten kleinen Blütenbecher mitten unter all der prallen Subtropenopulenz, und vor dem inneren Auge entspringt deutlich und lebhaft jener Marillenbaum, den Vitus und ich vor zwei Sommern im Parc Paysager entdeckt haben, dem gärtnerischen Juwel im Herzen von Fontvieille.
Hier, im westlichsten Bezirk Monacos, sind – im Gegensatz zur übrigen Stadt aus kahlem Beton – provenzalisch aufgeputzte Wohnanlagen charakteristisch und verleihen dem Viertel ein eigenes Flair. Die pastellfarbenen Gebäudekörper ähneln Waldorfspielklötzen in Riesenproportionen, die lose und lässig ineinander verschachtelt den annähernd birnenförmigen Park umranden. In einem dieser Klötze wohnen wir, einem Quader mit fünf strahlenförmig angeordneten Seitenflügeln, der auf den poetischen Namen Étoile de Mer getauft worden war, Seestern, und das Gefühl, von einem Seestern behaust zu werden, war seinerzeit das Zünglein an der Waage für den Entschluss, vom geschäftigen Monte Carlo in das ruhigere Fontvieille umzusiedeln. Gegenüber des Hauptaufgangs befindet sich eben jener Parc Paysager, ein Landschaftsgarten von exquisiter Mannigfaltigkeit, ein Kaleidoskop an Farben und Formen so kunterbunt und artenreich, wie ich es in meinem kühnsten kindlichen Märchenkosmos nicht prächtiger hätte ausmalen können. Nie und nirgends, scheint mir, habe ich einen schöneren, von Menschenhand gestalteten Park gesehen als diesen.
Dort entdeckten Vitus und ich im ersten Sommer nach unserem Einzug jenen Marillenbaum, der mir nun so hell und groß im Sinne schwebt. Seine Zweige trugen reife Früchte in Massen und wir fragten uns, ob wir davon welche abbekämen? Wir schlichen uns an, versuchten den dicken Stamm zu schütteln, vergeblich, nicht eine der verlockenden Kugeln wollte sich lösen und uns entgegen kollern. Alle hingen sie zu hoch, um mit gestreckten Armen an sie zu gelangen. „Wir müssen warten, bis sie von selbst herunterpurzeln“, sagte ich, die kundige Bauerstochter.
„Ich könnte sterben für Marillen“, schmachtete Vitus, der Gourmand.
„Besser nicht“, lachte ich und lenkte den potentiellen Märtyrer zurück zum gepflasterten, mit marmornen Randsteinen gesäumten Fußgängerweg, der in Mäandern durch das Gelände führt und die Flaneure abhalten soll, den Rasen zu betreten oder sich, in welcher Absicht auch immer, ins Gebüsch zu schlagen.
Fortan gingen wir in jenem Juli so ziemlich jeden Tag zum Marillenbaum, um nachzusehen, ob von seiner sonnengoldenen Last etwas zu Boden gefallen war. Wir waren nicht die Einzigen, die Gusto hatten auf die Leckerlis: Ständig begegneten uns Spaziergänger, die ebenso beiläufig und rein zufällig wie wir mit gesenkten Köpfen ein paar Runden unter der Laubkrone kreisten. Hin und wieder bückte sich Einer, und hin und wieder waren es Vitus und ich. Die aufgelesenen Früchte schmeckten himmlisch.
Indem ich die grauen Zweiglein inmitten des Blattgewuchers der Supermarkt-Topfpflanzen betrachte, plätschert der Speichel in meinem Mund und die Lippen schmatzen, und mit einem Male bin ich sicher, absolut sicher: Dieser Marillenzwerg ist mein Geburtstagspräsent für Vitus. Flugs packe ich den Kübel, damit mir niemand zuvorkommt und das rare Angebot vor der Nase wegschnappt. Dann sichte ich eine Steige mit Thymianstöcken und rieche sie sogar, da die knackigen Duftbomber, wie ich umgehend feststelle, von einem aufmerksamen Regalbetreuer mit Wasser besprenkelt worden sind. Ich beschließe, kurz vor der Party am Mittwoch einige dieser Kräutertöpfe zu kaufen.
Alles zusammen werde ich in die bauchige Amphore aus Terrakotta einsetzen, die unsere italienischen Vormieter ohne Befüllung in der Loggia des Appartements zurückgelassen hatten, weil es zu umständlich gewesen war, das mächtige Gefäß einem Umzug zu unterziehen. Es ist wirklich groß und dick und wird dem Bäumchen und den Kräutern genügend Raum bieten für eine gesunde Wurzelbildung. Ich muss allerdings einen Haufen Gartenerde auftreiben, diese in die Wohnung schaffen und dort verborgen halten bis Dienstagnacht. Wenn Vitus schläft, werde ich meine Geschenke pflanzen – heimlich und leise, einem Heinzelmännchen gleich.
2. Tour Odéon
„Na, mein Röslein, froh und munter heute“, sagt Vitus, der Kaffee trinkt und beobachtet, wie ich Orangenmarmelade in verschwenderischem Ausmaß auf das Butterbrot häufle.
„Bin ich das nicht von früh bis spät?“, frage ich kokett.
„Das bliebe zu klären“, schmunzelt er.
„Es ist die Marmelade. Du hast sie köstlich gemacht!“
Vitus ist der beste Koch der Welt. Ich kann mir keinen Besseren vorstellen. Sein jüngstes kulinarisches Experiment galt der Verwertung jener wildwachsenden Pomeranzen, die ich letztes Wochenende aus dem Jardin des Douaniers, eines neulich in Cap d’Ail eröffneten Gemeindeparks, mitgebracht hatte. Meines bescheidenen Wissens nach ist es schwierig, saure Orangen in deliziöse Marmelade zu verwandeln, doch Vitus glückte das Pilotprojekt auf Anhieb. Das Resultat schmeckt auf spannende Weise bitter und süß gleichzeitig, ohne zu bitter oder zu süß zu sein.
„Wie hast du bloß diese tolle sämige Konsistenz hingekriegt? Mit Gelierzucker?“
„Wo denkst du hin! Nein, da kommt einzig Rohrzucker in Frage. Rohr, nicht Rübe.“ Leidenschaftlich legt er los: „Den gibt es in der Bioecke im Carrefour. Ich nehme also von dem getrockneten Rohrsaft, nur ein paar Löffel voll, sonst wird’s zu zuckerig, sodann von den Orangen alles, was orange ist“, – und weiter redet er über einen Trick, wie Kerne auszulösen und weiße Häute ohne Substanzverlust abzutrennen seien, und endet mit dem Tipp: „Händisch rühren, bis der Kochlöffel schwitzt und das Kasserol singt. Pausenlos rühren – das macht’s!“
Diese Ausdauer am Herd möchte ich auch haben, aber das wird ein frommer Wunsch bleiben. „Köstlich“, sage ich noch einmal. „Kann in Serie gehen.“
„Okay, wenn du die Zutat pflückst und mich belieferst.“ Daran soll es nicht scheitern. Ich liebe es, auf den Ausflügen in die Natur die diversesten, in unserer Küche verwendbaren Gewächse zu sammeln und heimzubringen. Seit Weihnachten reifen an den unzähligen Zitrusbäumen in und um Monaco die Früchte, die leider meist höher hängen als ich mit den Händen hinkomme. Ich kenne nicht viele Bäume, deren untere Äste ich ohne Hilfsmittel, eine Leiter etwa, abklauben kann. Am Boden liegende Früchte hebe ich nur auf, wenn sie den Aufprall ohne Riss in der Haut überstanden haben, so auch die Pomeranzen im Jardin des Douaniers, meine aktuellste, höchst befriedigende Ausforschung zum Thema erntereife Wald- und Flurgenüsse.
„Du grunzelst vor dich hin, als wärst du schon in Feierlaune“, sagt das Geburtstagskind und schiebt die Marmeladenschale näher zu mir. Seine grünen Augen funkeln im Licht der Morgensonne, das zur Stunde beinahe waagrecht über den Esstisch hinweg bis tief in die Küche strömt. Ich schlecke meinen Löffel sauber und kichere völlig unmotiviert.
„Die Vorfreude ist es, mein Lieber, die Vorfreude. Ich kann deinen Ehrentag kaum erwarten. Noch dreimal schlafen bis dahin. Ganz schön kindisch, oder? Nicht mal Kinder sind so kindisch.“
„Hm, dann schmeißen wir halt eine Lolly-Poppy-Baby-Party, wär’ das was?“ Lüstern schlürft er an der Kaffeetasse und macht andere schlüpfrige Geräusche mit seinem Mund.
So kaspern wir herum und necken uns, und mampfen in Mengen wie Bergsteiger, die eine Kalorien zehrende Gipfelerklimmung vor sich haben. Dabei möchten wir bloß unseren üblichen Sonntagsvormittagsbummel durch das Städtchen unternehmen. Heute besichtigen wir den Tour Odéon, ein mit Pomp lanciertes Wolkenkratzerprojekt, das fast bezugsfertig ausgeführt ist und bereits den Rang eines neues Wahrzeichens von Monte Carlo genießt. Vitus, der die Baustelle gelegentlich inspiziert hat, will den nun abgerüsteten Turm fotografieren.
Während er seine lederne Umhängetasche der Marke Opa mit den Kamera-Utensilien packt, verrichte ich die morgendliche Hygiene und ziehe meinen Vintage-Trainingsanzug an, der eher durch sein florales Stoffmuster auffällt denn eine wie auch immer geartete Sportlichkeit. Zum wiederholten Male werfe ich einen Blick in das klimperkleine fensterlose Kabinett hinter dem Bad, zu dem Vitus keinen Zutritt hat und wo ich die gestrige Besorgung verstecke. Ich habe den gewichtigen Kübel mit dem Marillenbäumchen eigenhändig vom Carrefour zum Étoile de Mer transportiert und an meinem Mitbewohner vorbei in das Abstellkämmerchen geschleust. Hoffentlich wird es in diesem schummerigen Gefängnis die Zeit bis zum Mittwoch überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Die Thymiantöpfe werde ich erst dienstagabends aus dem Supermarkt holen, denn lagerte ich sie jetzt in unseren vier Wänden ein, könnten die harzwürzigen Aromaschwaden die Geschenkeaktion auffliegen lassen, weil Vitus’ Nase eine verdächtige Sache wittert und ihr auf den Grund gehen will.
„Du darfst bald raus“, flüstere ich dem Bäumchen zu und verriegle die Tür zum Kabinett.
Als die gläserne Automatiktür unseres Hauseinganges zur Seite surrt und ich ins Freie trete, schießt ein altvertrauter Vers durch meinen Kopf, der lautet: „Biene Blume Hungga“, und stammt von meiner Tante Burgi. Heilige Güte, aus welchem toten Gedächtniswinkel kommt denn das hervorgeblitzt, dieses Gsatzl, wie die Tante es bezeichnet? Sie fügt die drei Worte stets ihrem „Grüß Gott“ hinzu, wenn wir uns begegnen, als wären sie eiserner Bestandteil einer speziell ausgefeilten Begrüßungsformel. „Grüß Gott!“, schmettert Burgi, die Bäuerin mit Stentorstimme, wechselt sodann in Sopranhöhen und rezitiert, langgezogen und süßlich: „Bie – nee – Blu – mee – Hungg – ahh!“
Der Art des Vortrags nach zu schließen könnte es sich um ein Zitat aus einer bedeutsamen lyrischen Avantgarde-Schöpfung handeln, doch Tante Burgi beteuert, dies seien meine ersten Worte als Kind gewesen. „Biene Blume Hungga“ – das soll ich gesagt haben? Glauben tu ich’s nicht und wissen kann ich es nicht, denn an meine frühkindlichen sprachlichen Ergüsse fehlt die Erinnerung und überhaupt: Ich habe jetzt keine Lust auf ein Nachgrübeln über Bienen und Blumen, was ohnehin ergebnislos enden würde, sondern ich will mit Vitus losmarschieren und dabei nicht von einem dummen Tantenspruch verfolgt werden. Es lockt ein heller linder Tag voller Verheißungen an den Frühling, den ich uneingeschränkt auskosten möchte und gewiss nicht diesen paar Silben opfere, die sich allzu leicht in das Bewusstsein nisten und dort ihr brütendes Unwesen als Ohrwurm treiben. Solche Nervensägen gehören ignoriert, und damit basta!
Ich ziehe den Zipper des Trainers bis zum Kinn und schalte die Beine in den vierten Gang, wie Vitus zu sagen beliebt, wenn ich turbodampfrasante von dannen springe.
„Nicht so fix!“, ruft er prompt.
„Nun mach schon, Oldie!“, gebe ich zurück und bremse mich ein bisschen ein, indessen Vitus einen Zahn zulegt. Wie gewöhnlich dauert es eine kleine Weile, bis wir uns auf einen synchronen Schritt eingependelt haben und, Seite an Seite gehend, über Dies und Das zu sprechen beginnen.
„Was hältst du vom schicken Odéon?“, frage ich Vitus, den Fachmann im Bereich der Sanierung von historischer Gebäudesubstanz. Ein halbes Leben hat er auf Baustellen in Wien verbracht und bespricht immer noch gerne Immobilienangelegenheiten, obwohl er sein österreichisches Unternehmen vor einigen Jahren an einen Konzern verkauft hat und aus dem Geschäft raus ist – zu meinem heftigsten Bedauern übrigens.
„Mal schauen, wie das derzeit aussieht“, sagt Vitus. „Die Baugrube war gewaltig. Zehn Tiefgeschosse mindestens, schätze ich“, und er redet über die Widrigkeiten und die Vorzüge des Bauens auf felsigem Grund, selbiges man hier eindrücklich habe verfolgen können. Vitus nennt den Turm in anglizistischer Manier Odeon-Tower, was uns Ausländern gnädigst nachgesehen wird.
„Na schön, der Tower steht. Mensch, bin ich gespannt auf diesen Stängel.“
Der „Stängel“ hatte im Laufe von Planung und Bauzeit für Debatten gesorgt und sogar gröbere Kontroversen mit den Anrainern entfacht, die vor Gericht geschlichtet werden mussten. Es soll eines der gegenwärtig höchsten Wohngebäude Europas sein und ist auf spektakuläre Weise aus einer unglaublich kleinen und obendrein verwegen abschüssigen Parzelle in Randlage von Monte Carlo herausgewachsen. Wir sehen den Turm in seiner vollen Länge erst, als wir um eine Häuserecke biegen und das Überdrüberkonstrukt frontal vor uns emporragt.
Ich neige den Kopf in den Nacken und schaue die gebogene, bläulich schimmernde Fassade von rund fünfzig Etagen hinauf bis in den Himmel. „Das sind ja zwei Türme! Teils steckt der eine drin im andern. Sieht aus, als wären es siamesische Zwillinge.“
„Interessant“, meint Vitus. „Elliptischer Grundriss.“ Er guckt sich die Augen aus und sagt nichts mehr. Mit geübtem Griff dreht er sein ASM-Schildkäppi exakt um einhundertachtzig Grad, zückt den Fotoapparat und macht sich schweigend an das Shooting.
„Imponierend“, bemerke ich höflich und denke, als ich zum Gebäudegiebel hochschaue: „Was für ein seltsamer Zacken. Wie ein schnödes Geodreieck.“ Ich ziehe die Stirn in Falten. „Der arme Himmel. Er wird von dem Betonspitz da oben durchstochen.“
Das ist natürlich eine Einbildung. Der Himmel ist in sicherer Ferne und sein Blau rein und unverletzt bis auf den Kondensauspuff eines Flugzeuges, der einen scharfen weißen Strich ins sphärische Gewölbe ritzt.
Ich senke den Kopf in Normalposition, bewege die steifen Halswirbel hin und her und überlege, warum diese sterile Wohnmaschine den musischen Namen „Odeon“ verliehen bekommen hat. Mit Wehmut denke ich an das Wiener Odeon Theater, das sich in einem monumentalen Neorenaissance-Gebäude befindet nebst der österreichischen Börse für landwirtschaftliche Produkte und manch anderen Etablissements. Wie hatte mich dieses feudale Palais fasziniert, als ich es das erste Mal sah und seine hehren Säulenhallen betrat! Kein dergleichen prickelndes Gefühl regt sich heute angesichts des funkelnagelneuen Bauwerks vor mir. Da kann es noch so schillern und prangen und ein exzellentes Zeugnis der Stahlbetonkunst und des Glasfronten-Hightech liefern, mich lässt diese Demonstration postmoderner Leistungen kalt.
Vitus ist auf Motivjagd, besser gesagt Perspektivensuche, um die Vertikale seines Zielobjektes in ein rechtes Bild zu rücken. Mein alter Weggefährte biegt und wendet seinen massigen Körper und federt in den Knien in einer verblüffenden Geschmeidigkeit; er ist beneidenswert agil, und indem ich seinen kindlichen Eifer beim Knipsen beobachte, denke ich, vielleicht stimmt ja doch, was er von sich behauptet. Er sei ein Künstler, beharrte er stets, und kein Geschäftsmann, und ich glaubte ihm nie. „Du bist sehr wohl ein Geschäftsmann, ein begnadeter, ein echter Unternehmer, das spürt jeder!“, pflegte ich hitzig zu entgegnen. „Wie kannst du nur sagen, du seist es nicht?“