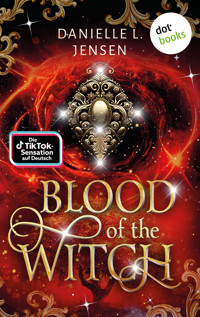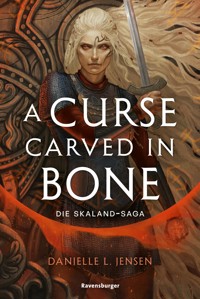Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: dotbooks VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Malediction
- Sprache: Deutsch
Die Schöne und das Biest: Der Fantasyroman »Song of the Witch« von Danielle L. Jensen jetzt als eBook bei dotbooks. Eine junge Frau, bestimmt für die Bühne. Ein Prinz, gefangen im Reich der Dunkelheit. Ein magisches Bündnis, das alles verändern wird. Vor Jahrhunderten wurde die Insel des Lichts von Trollen mit magischen Kräften beherrscht – bis eine Hexe sie in den Untergrund verbannte. Nur eine Frau mit rotem Haar und Engelsstimme hat die Macht, sie zu befreien. So kommt es, dass Cécile de Troyes in das Königreich von Trollus entführt wird. Mit ihrem Gesangstalent und dem feuerroten Haar soll sie die Trolle zurück zum Licht führen. Cécile hat keinesfalls vor, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Doch während sie die Flucht plant, kommt sie den Trollen und dem unberechenbaren Prinzen näher. Plötzlich muss sie sich entscheiden: In welche Welt gehört sie, und wie viel ist sie bereit aufzugeben? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romantic-Fantasy-Highlight »Song of the Witch« von Danielle L. Jensen ist der erste Roman in ihrer »Malediction«-Trilogie und wird Fans von Sarah J. Maas und Elise Kova begeistern. Die Printausgabe und das Hörbuch sind bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine junge Frau, bestimmt für die Bühne. Ein Prinz, gefangen im Reich der Dunkelheit. Ein magisches Bündnis, das alles verändern wird.
Vor Jahrhunderten wurde die Insel des Lichts von Trollen mit magischen Kräften beherrscht – bis eine Hexe sie in den Untergrund verbannte. Nur eine Frau mit rotem Haar und Engelsstimme hat die Macht, sie zu befreien. So kommt es, dass Cécile de Troyes in das Königreich von Trollus entführt wird. Mit ihrem Gesangstalent und dem feuerroten Haar soll sie die Trolle zurück zum Licht führen.
Cécile hat keinesfalls vor, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Doch während sie die Flucht plant, kommt sie den Trollen und dem unberechenbaren Prinzen näher. Plötzlich muss sie sich entscheiden: In welche Welt gehört sie, und wie viel ist sie bereit aufzugeben?
»Song of the Witch« erscheint außerdem als Hörbuch und Printausgabe bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über die Autorin:
Danielle L. Jensen ist Autorin mehrerer Romantasy-Reihen. Bekannt wurde sie mit ihrer »Malediction«-Trilogie, die prompt die Bestsellerlisten stürmte. Nun erscheint die Erfolgsserie des BookTok-Stars erstmals auch auf Deutsch.
Die Website der Autorin: danielleljensen.com
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin in ihrer
»Malediction«-Reihe bisher die Romane »Song of the Witch« und »Heart of the Witch«; als Print- und Hörbuchausgaben auch bei SAGA Egmont erhältlich.
***
eBook-Ausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2014 unter dem Originaltitel »Stolen Songbird« bei Strange Chemistry.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2014 Danielle L. Jensen
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2024 Danielle L. Jensen und SAGA Egmont
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von © Adobe Stock / safia sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-133-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Song of the Witch« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Danielle L. Jensen
Song of the Witch
Roman. Malediction 1
Aus dem Amerikanischen von Anne Masur
dotbooks.
Kapitel 1CÉCILE
Meine Stimme erhob sich um eine Oktave, hallte über den Marktplatz von Goshawk’s Hollow und übertönte auf ihrem Weg das Blöken der Schafe und das Hämmern des Schmieds. Zahlreiche bekannte Gesichter legten ihre Arbeit nieder, ihre Mienen waren gleichermaßen nervös, als sie dem Ton lauschten, vor dem ich mich seit einem Monat fürchtete. Es gefiel ihr, dass mein Versagen vor Publikum stattfand.
Ein Beben durchfuhr meinen Körper, meine Handflächen waren schweißnass. Madame Delacourtes Blick brannte zwischen meinen Schulterblättern, ihre geringen Erwartungen spornten mich an. Ich würde mich nicht brechen lassen.
Nur um Haaresbreite widerstand ich dem Drang, meine Hände zu Fäusten zu ballen, und legte meinen letzten Atem in das Crescendo des Stücks. Fast geschafft. Mehrere Leute traten vor, die ermutigenden Worte auf ihren Lippen gingen in der Enormität meines Liedes unter. An dieser Stelle brach meine Stimme. Jedes Mal.
Heute jedoch nicht.
Als ich fertig war, entbrannte Jubel auf dem Markt. »Gut gemacht, Cécile!«, rief jemand, und ich machte einen kleinen Knicks, während mir die Mischung aus Verlegenheit und Freude Röte in die Wangen trieb. Das Echo meines Liedes hallte über die vom Frühling grün gefärbten Felder und Täler. Kurz darauf ging jeder wieder seiner Arbeit nach.
»Bild dir bloß nichts darauf ein«, sagte Madame Delacourte hinter mir. »Es ist kein großes Kunststück, diesen Haufen rückständiger Landbewohner zu beeindrucken.«
Mein Rücken verspannte sich, und ich drehte mich, um ihrem von Falten umgebenen Blick zu begegnen.
»Du bist gut«, fuhr sie fort, ihre Lippen waren zu so dünnen Linien verzogen, dass sie kaum noch sichtbar waren. »Aber nicht so gut wie sie.«
Sie. Meine Mutter.
Den Großteil meiner Kindheit hatte ich so gut wie nichts über sie gewusst – die Frau, von der mein Vater mit einer Ehrfurcht sprach, dass man denken könnte, sie wäre eine Königin. Ich wusste nur, dass mein Vater in seiner Jugend nach Trianon gereist war, wo er sich verliebt und eine junge Sopranistin namens Genevieve geheiratet hatte. Aber als mein Großvater starb und mein Vater die Farm erbte, hatte sie sich geweigert, mit ihm zurückzugehen.
»Ein Mädchen aus der Stadt, die den Gedanken an ein Leben auf dem Land nicht ertragen konnte«, grummelte Gran immer, wenn ich sie nach meiner Mutter fragte. »Aber welche Art von Frau ihren Mann und ihre drei Kinder einfach verlässt, ist mir schleierhaft.«
Verlassen war ein starkes Wort. Sie besuchte uns. Gelegentlich. Lange Zeit dachte ich, sie hätte uns so selten aufgesucht, weil sie uns nicht genug liebte, aber jetzt verstand ich die Entscheidung, die meine Mutter getroffen hatte. Die Frau eines Bauern bekam nie eine Pause von der Arbeit – noch vor dem Morgengrauen aufstehen und als Letzte ins Bett gehen. Tiere versorgen, Mahlzeiten zubereiten, Butter herstellen, Wäsche machen, das Haus putzen, Kinder erziehen … Die Liste war endlos. Die Ehefrauen in Goshawk’s Hollow alterten alle vor ihrer Zeit, hatten spröde Hände, wettergegerbte Gesichter, und ihre Mundwinkel schienen permanent wie von Geisterhand nach unten gezogen zu werden, während meine Mutter schön blieb: ein Star auf der Bühne. Sie sah mehr wie meine ältere Schwester als meine Mutter aus.
»Sind wir für heute fertig, oder wollen Sie, dass ich es noch mal singe, Madame?« Meine Stimme tropfte so zuckersüß wie Honig, und ich wusste, dass sie in starkem Kontrast zu meinem harten Gesichtsausdruck stand. Seit fast vier Jahren war sie wie ein Dorn in meinem Rücken und gab ihr Bestes, etwas, das ich liebte, in eine gefürchtete Pflicht zu verwandeln. Sie hatte versagt.
»Nächste Woche um diese Zeit wirst du darum flehen, nach Hause zurückkommen zu dürfen.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und schlenderte von der Veranda zurück in das Wirtshaus, ihre schwarzen Röcke flatterten. Mit ein bisschen Glück wäre dies der Moment, dass ich meine Gesangslehrerin zum letzten Mal sah. In einer Woche würde ich von der besten Opernsängerin lernen, die auf der Insel des Lichts lebte.
Ungewollt erhob sich das Bild meiner Mutter vor meinem inneren Auge, zusammen mit der Erinnerung an den Tag vor vier Jahren, als sie mein Schicksal besiegelt hatte. »Sing«, hatte sie gefordert, und ich hatte ein Lied gewählt, das bei den Scheunentänzen beliebt war, das einzige Lied, das ich kannte. Als sie ihren Mund verzog, dachte ich, ihre Enttäuschung würde mein Herz zerbrechen lassen.
»Jeder talentlose Schlucker könnte das schaffen«, sagte sie, ihre Iriden waren blau, genau wie meine, doch die ihren wirkten kalt wie der Winterhimmel. »Sing mir nach.« Sie sang ein paar Zeilen aus einer Oper, ihre Stimme war so lieblich, dass mir Tränen in die Augen schossen. »Jetzt du.«
Ich ahmte ihr nach, zunächst zögerlich, aber dann mit mehr Selbstvertrauen. Sie hatte gesungen, und ich hatte es wiederholt wie ein Singvogel, der eine Flöte imitierte.
Sie hatte gelächelt. »Gut gemacht, Cécile. Sehr gut gemacht.« Meine Mutter hatte sich an meinen Vater gewandt, der uns aus der Ecke beobachtet hatte, und gesagt: »Wenn sie siebzehn ist, werde ich sie mitnehmen.« Als er anfing zu argumentieren, hob sie ihre Hand und brachte ihn zum Schweigen. »Sie ist stark, clever, und sobald sie aus diesem unbeholfenen Alter herausgewachsen ist, wird sie auch schön genug sein. Und ihre Stimme ist göttlich.« Ihre Augen hatten bei diesen Worten gefunkelt. »Hier auf dem Land würde niemand ihr Talent erkennen, auch wenn man es ihnen direkt vors Gesicht hielte, das wäre eine Verschwendung. Ich werde arrangieren, dass sie Tutoren bekommt, die sie in Goshawk’s Hollow unterrichten – ich will nicht, dass sie mit den Manieren einer Milchkuh bei uns ankommt.«
Dann hatte sie sich an mich gewandt, eine goldene Kette von ihrem Hals gelöst und sie mir umgelegt. »Schönheit kann erschaffen werden, Wissen erlernt, aber Talent kann weder gekauft noch gelehrt werden. Und du hast Talent, mein liebes Mädchen. Wenn du auf der Bühne stehst und singst, wird die ganze Welt dich lieben.«
Jetzt umschloss ich diesen Anhänger mit meiner Faust und starrte auf die Tür, die Madame hinter sich geschlossen hatte. Die ganze Welt würde mich lieben.
Der Ruf meines Namens lenkte meine Aufmerksamkeit weg von meinen Erinnerungen. Ich hüpfte die Holzstufen hinunter und wich Pfützen aus, als ich mich meiner besten Freundin Sabine näherte, die an einem Zaunpfahl lehnte und mit einer ihrer Locken spielte. Sie grinste und überreichte mir einen Korb mit Eiern. »Du hast es geschafft.«
»Aller guten Dinge sind hundert.« Ich hakte mich bei ihr unter und zog sie in Richtung der Ställe. »Ich muss schnell zurück zur Farm. Gran braucht diese Eier für den Kuchen, den sie für meine Abschiedsfeier heute Abend backen will.«
Sabines Miene verfinsterte sich.
»Ich habe dich eingeladen«, erinnerte ich sie. »Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Und über Nacht bleiben. Die Kutsche wird auf unserem Weg nach Trianon durch die Stadt kommen, also wäre es ein Leichtes, dich morgen früh wieder hier abzusetzen«, erwiderte ich beiläufig, als würde jeden Morgen eine gemietete Kutsche auf mich warten.
»Ich weiß …« Sie blickte nach unten. »Aber meine Ma hat den Gig heute Morgen mit zur Renard Farm genommen. Sie sagte, ich solle sie nicht vor dem Morgen zurückerwarten.«
Ich zog eine Grimasse und ersparte mir die Mühe, ihr vorzuschlagen, ihr Pony zu satteln und zusammen mit mir zu reiten. Sabine hatte schreckliche Angst vor Pferden. Verfluchte Felsen und Himmel, warum hatte ich heute Morgen nicht daran gedacht, Fleur vor den Karren zu spannen, anstatt einfach in die Stadt zu reiten? Und wo auf Gottes grüner Erde war mein Bruder? Frédéric hätte schon vor Stunden in Trianon ankommen sollen. Hinter ihm wäre Sabine vielleicht mitgeritten, weil sie schon seit einer Ewigkeit von ihm schwärmte.
»Ich muss immer daran denken, dass dies vielleicht das letzte Mal ist, dass wir uns sehen«, sagte Sabine leise und unterbrach meine Gedanken. »Dass du, sobald du in Trianon mit deiner Mutter auf der Bühne stehst und auf alle möglichen Feiern gehst, das Hollow vergisst. Und mich.«
»Das ist völliger Blödsinn«, verkündete ich. »Ich werde so oft zu Besuch herkommen, dass du schon ganz genervt von mir sein wirst. Du weißt, dass Frédéric zurückkommt, wann immer er freihat.«
»Seit dem neuen Jahr ist er noch nicht zurückgekehrt.«
Es stimmte, dass Fred seit seiner letzten Beförderung zum Unterleutnant weniger Gelegenheiten gehabt hatte, zu Besuch zu kommen. »Dann werde ich alleine reiten.«
»Oh, Cécile.« Sabine schüttelte ihren Kopf. »Das kannst du nicht mehr machen – das ist nicht sehr vornehm. Die Leute werden reden.«
»Aber es ist in deinem Interesse«, erinnerte ich sie. Der Stalljunge brachte Fleur zu uns, aber ich wollte noch nicht aufbrechen. Sabine und ich waren schon unser ganzes Leben lang beste Freundinnen, und bei dem Gedanken, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen, breitete sich Kälte in meinem Inneren aus.
»Ich werde nach Hause reiten, Gran die Eier geben und dann den Karren anhängen und zurückkommen, um dich zu holen«, entschied ich. »Geh und zieh dein blaues Kleid an. Ich bin im Handumdrehen wieder zurück.«
Sie biss sich auf ihre Haarsträhne. »Ich weiß nicht …«
Einen langen Moment hielt ich ihren Blick. »Du wirst in dem Wagen mit mir kommen und mit uns feiern«, sagte ich bestimmt.
Sabines Blick wurde leer, und für einen Wimpernschlag schärfte sich alles um mich herum. Die Geräusche des Marktes. Die feste Erde unter meinen Füßen. Die Brise, die über uns wehte und Sabines Haare durcheinanderbrachte. Sie lächelte. »Natürlich. Das will ich auf keinen Fall verpassen.«
Es gab nichts, was genug Willensstärke nicht bewerkstelligen konnte.
Ich schwang mich in den Sattel und nahm die Zügel auf, um mein tänzelndes Pferd zu beruhigen. »Ich werde nicht länger als eine Stunde weg sein. Halte Ausschau nach mir!« Mit einer Hand hielt ich den Korb mit Eiern, die andere klammerte sich an die Zügel, als ich das Tier mit meinen Fersen antrieb und aus der Stadt galoppierte.
***
Unsere Farm lag nah genug am Hollow, dass wir fast als Stadtbewohner durchgehen konnten, aber weit genug entfernt, sodass der Geruch der Schweine nicht die Nasen derer beleidigte, die weniger an das Landleben gewöhnt waren. Ich hätte den ganzen Weg durchgaloppieren können, aber nach ein wenig mehr als der Hälfte hielt ich an und ließ Fleur zu Atem kommen. Ihre Hufe klopften leise auf die feuchte Erde, als wir gemächlich über die Straße trabten. Der Duft von Kiefern lag schwer in der Luft, und von den Bergen wehte eine kühle Brise herüber, die mein langes, rotes Haar hinter mir im Wind tanzen ließ.
Eine Bewegung in meinem Augenwinkel ließ mich anhalten und den Wald zu beiden Seiten akribisch absuchen. Bären und Bergkatzen waren in dieser Gegend durchaus verbreitet, aber wenn meine Stute einen Räuber gewittert hätte, wäre sie bereits unkontrollierbar. Der Wind rauschte durch die Bäume, und mir schien, als hätte es im Unterholz geknackt, doch ich war mir nicht sicher. Mein Puls beschleunigte sich, ein ängstlicher Schauer lief mir über den Rücken. Wegelagerer? So weit nördlich auf der Meerstraße waren Überfälle eher eine Seltenheit, aber möglich wäre es.
»Hallo?«, rief ich und nahm die Zügel neu auf. »Ist da jemand?«
Keine Antwort, aber jemand, der mich überfallen wollen würde, würde sich höchstwahrscheinlich auch nicht zu erkennen geben. Meine Unruhe wuchs. Ich war schon bei Regen, Schnee und Sonne über diese Straße geritten, und nie hatte ich einen Moment der Angst verspürt. Unter mir fing Fleur an zu tänzeln, sie vernahm mein Unbehagen.
Wieder machte sich der Wind bemerkbar, doch glich er nicht mehr der sanften Brise von zuvor, sondern schien mit wütenden Fingern an meinen Haaren zu zerren. Die Sonne versteckte sich hinter einer Wolke und ließ die Luft merklich abkühlen. Unbewusst wanderte mein Blick zum Verlassenen Berg, der sich in der Ferne erhob. Ich befand mich auf halbem Weg zwischen meinem Zuhause und der Stadt, doch die Farm von Jérôme Girard war in der Nähe. Ich könnte dorthin reiten und seinen Sohn Christophe bitten, mich den Rest des Weges zu begleiten.
Aber was, wenn er mich auslachte, weil ich so eine Idiotin war, die sich vor einem Geräusch um Unterholz fürchtete, das wahrscheinlich nur ein Eichhörnchen oder eine Schlange verursacht hatte? Mein Leben lang hatte ich versucht zu beweisen, dass die Situation anders lag. Doch es verhielt sich bereits jeder so, als wäre ich ein Stadtmädchen, und das würde ihren Standpunkt nur untermauern. Ich drehte mich und schaute in die Richtung zurück, aus der ich gekommen war. Ich könnte zurückreiten und auf meinen Bruder warten, aber was, wenn er in Trianon aufgehalten worden wäre und gar nicht kommen würde?
Ich entschied, nach Hause zu galoppieren. Wer auch immer in den Wäldern lauerte, könnte sein Glück versuchen, mich zu erwischen. Als ich Fleur erneut herumdrehte, riss ich abrupt an den Zügeln. Der Korb fiel mir aus der Hand und prallte zu Boden, die gelben Eidotter vermischten sich mit dem Schlamm.
Ein verhüllter Reiter blockierte mir den Weg.
Mein Herz raste. Fleur wirbelte herum, und ich trieb sie mit dem Ende der Zügel an. »Ha!«, rief ich, als sie nach vorn schoss.
»Cécile! Cécile, warte! Ich bin’s!«
Eine vertraute Stimme. Diesmal zerrte ich sanfter an den Zügeln und warf einen Blick über die Schulter. »Luc?«
»Ja, ich bin es, Cécile.« Er ritt langsam zu mir und zog seine Kapuze zurück, um sein Gesicht zu offenbaren.
»Warum schleichst du dich so an?«, fragte ich. »Du hast mich zu Tode erschreckt.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich war mir zuerst nicht sicher, ob du es bist. Das mit den Eiern tut mir leid.«
Diese Antwort erklärte nicht, warum er sich überhaupt erst in den Büschen versteckt hatte.
»Ich habe dich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wo warst du?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte. Sein Vater war Wildhüter auf einer Farm nicht weit von unserer entfernt, aber vor einigen Monaten war Luc nach Trianon gegangen. Mein Bruder und die anderen Stadtbewohner hatten Wind davon bekommen, dass Luc Glück dabei hatte, auf Pferde zu wetten und Karten zu spielen, und nun führte er ein Leben in Saus und Braus, in dem er seine Gewinne verschleuderte.
»Hier und da«, meinte er vage und ritt in einem Kreis um mich herum. »Man erzählt sich, dass du nach Trianon ziehst, um bei deiner Mutter zu leben.«
»Ihre Kutsche holt mich morgen ab.«
»Dann wirst du singen. Auf der Bühne?«
»Ja.«
Er lächelte. »Du hattest schon immer die Stimme eines Engels.«
»Ich muss jetzt nach Hause«, sagte ich. »Gran erwartet mich – und auch mein Vater.« Ich zögerte und sah die Straße hinunter. »Du kannst mit mir reiten, wenn du willst.« Ich hoffte, dass er ablehnen würde, aber reiten war immer noch besser, als hier alleine mit ihm zu verweilen.
»Heute ist dein Geburtstag, nicht wahr?« Er führte sein Pferd nah neben das meine.
Ich runzelte die Stirn. »Ja.«
»Siebzehn. Du bist jetzt eine Frau.« Luc sah mich von oben bis unten an, als würde er etwas betrachten, das gekauft werden könnte. Ein Pferd auf dem Markt. Oder etwas Schlimmeres. Er kicherte leise, der Laut ließ mich zusammenzucken.
»Was ist so komisch?« Mein Herz raste, meine Instinkte sagten mir, dass etwas schrecklich falschlief. Bitte lass jemanden über die Straße zu uns kommen, betete ich innerlich.
»Ich musste nur gerade daran denken, dass uns das Schicksal manchmal findet, wenn wir es am wenigstens erwarten«, meinte er kryptisch. Bevor ich reagieren konnte, griff er zur Seite und schnappte sich Fleurs Zügel. »Du musst mich begleiten. Es gibt ein paar Personen, die sehr gerne deine Bekanntschaft machen würden.«
»Ich werde nirgendwo mit dir hingehen, Luc«, sagte ich und versuchte, meine Stimme ruhig zu halten – ich wollte nicht, dass er wusste, wie groß meine Angst war. »Meinen Bruder würde es nicht freuen zu hören, dass du mich in Schwierigkeiten gebracht hast.«
Luc schaute sich um. »Komisch, aber ich sehe Frédéric hier nirgendwo. Scheint, als gäbe es nur dich und mich.«
Damit hatte er zwar recht, aber wenn er dachte, ich würde kampflos mit ihm gehen, hatte er sich geirrt.
Ich stieß meine Fersen in Fleurs Seite, und sie ging hoch, ihre Hufe schlugen aus und traten Lucs Hand fort. »Ha!«, schrie ich und stürzte im Galopp die Straße entlang. Die Stute spürte meine Angst, legte ihre Ohren an und rannte schneller als jemals zuvor. Aber Lucs Hengst war größer – wenn ich auf der Straße blieb, würde er uns mit Leichtigkeit einholen. Als eine Abzweigung vor mir erschien, lenkte ich uns auf den Nebenpfad.
Zweige rissen an meinen Haaren und Röcken, als wir über gefallene Bäume sprangen und durch das Unterholz krachten. Ich überließ der Stute die Führung und konzentrierte mich darauf, den Kopf gesenkt zu halten und im Sattel zu bleiben. Hinter uns hörte ich die Hufe des großen Pferdes über den Pfad donnern, zusammen mit Lucs Fluchen und abscheulichen Drohungen. Wir näherten uns der Girard-Farm. Ich konnte das Ende des Waldes bereits vor mir erkennen, dahinter lagen ihre Felder. »Chris!«, schrie ich wohl wissend, dass ich noch zu weit entfernt war, als dass sie mich hätte hören können. »Jérôme!«
Ein Blick zurück zeigte mir, dass Luc knapp hinter mir war. Er war nah genug, um die Wut auf seinem Gesicht ausmachen zu können. Ich durfte nicht zulassen, dass er mich erwischte. Unter gar keinen Umständen würde ich mich ergeben. Doch kurz darauf schlug ein Ast gegen meine Brust und schleuderte mich nach hinten. Fleur verschwand unter mir, und ich fiel, meine Augen fixierten die Sonne, die durch die grünen Blätter der Bäume hervorlugte.
Dann sah ich nichts mehr.
Kapitel 2CÉCILE
Ein grau behaartes Vorderbein war alles, was ich sah, als ich meine Augen öffnete. Die Bewegungen des Pferdes ließen meinen Körper vor- und zurückschwanken. Der Knauf eines Sattels drückte sich schmerzhaft in meinen Bauch, und mein Kopf fühlte sich an, als würden einhundert wütende Riesen versuchen, sich ihren Weg nach draußen freizuhämmern. Wo war ich?
Ich wand mich, doch konnte mich kaum bewegen. Meine Hände und Füße waren an das Pferd gefesselt, mein Mund geknebelt.
Luc.
Furcht durchfuhr mich wie das Wasser eines gebrochenen Damms, und ich zuckte und strampelte, versuchte mit aller Kraft, mich zu befreien. Als der Hengst zur Seite wich, erhaschte ich einen Blick auf den dichten Wald.
»Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre.« Lucs Stimme klang gesellig, als würden wir einen Ausritt durch den Park machen. »Er hat die leidige Angewohnheit, zu steigen und sich auf den Rücken zu werfen, wenn er sich erschreckt, und das würde nicht gut für dich enden.«
Ich erstarrte.
»Wahrscheinlich fragst du dich, wohin ich dich bringe. Ich würde es dir wirklich gerne verraten, aber leider wurden mir von meinen Partnern eine Reihe von Einschränkungen auferlegt.«
Tränen der Frustration liefen mir seitlich über die Schläfen, als ich schmerzhaft den Hals verrenkte, um zu ihm aufzublicken. Er schmunzelte und klopfte mir auf den Hintern. »Du wolltest doch sowieso nicht wirklich nach Trianon gehen, oder? Die Theatermädchen sind im Prinzip nur hochpreisige Dirnen, und als die Art von Mädchen bist du mir nie vorgekommen. Du passt besser ins Hollow als in die Großstadt.«
Mir rutschte das Herz in die Hose, und ich presste meine Wange an die Schulter des Pferdes. Galle arbeitete sich durch meinen Hals empor, und ich hatte Mühe, meinen Mageninhalt unten zu behalten. Wenn ich mich übergab, während ich den Knebel trug, würde ich an meinem eigenen Erbrochenen ersticken. Denk nach, Cécile! Denk nach!
»Da sind wir.«
Luc stieg ab, und ich beobachtete seine Hände, als er den Knoten löste, der mich an das Pferd band. Sobald die Spannung in meinen Beinen nachgab, trat ich hart um mich und traf ihn im Gesicht.
»Verdammt noch mal!«, brüllte er.
Ich glitt nach unten und landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden. Sekunden später traf mich ein Stiefel in die Rippen und beförderte mich auf den Rücken. Ich schrie gegen den Knebel an, meine Augen fixierten Lucs blutiges Gesicht. Meine Handgelenke und Knöchel waren immer noch gefesselt – also war das Beste, was ich machen konnte, mich in eine sitzende Position zu drücken.
»Wir können das auf die sanfte oder auf die harte Tour machen«, zischte er und wischte sich mit einem dreckigen Taschentuch die Nase ab. »So oder so wirst du mit mir kommen.«
»Wohin?«, schaffte ich, um meinen Knebel herum halbwegs verständlich zu nuscheln.
Er zuckte mit seinem blutverschmierten Kinn nach vorn, und ich warf einen Blick über meine Schulter. Der Verlassene Berg ragte bedrohlich über uns auf. Sein funkelnder Südhang war so glatt wie der Messerschnitt durch ein Stück Butter. Die zerbrochene Hälfte ergoss sich in einem zerklüfteten Felsrutsch bis ins Meer. Ich spürte, wie meine Augen groß wurden. Die Alten erzählten immer von Goldschätzen, die unter den gefallenen Felsen ruhten, aber sie sagten auch, dass der Berg verflucht war. Schatzjäger hatten die Angewohnheit zu verschwinden, wenn sie loszogen, um sich zwischen den Steinen umzusehen. Für jede Geschichte, die einen der verschwundenen Männer betraf, kamen zehn weitere über diejenigen hinzu, die ihn sich geholt hatten.
Luc ließ mich weiter den Berg anstarren, während er das Pferd zu einem kleinen, mit Holz umrandeten Paddock führte. Ich zerrte an den Fesseln an meinen Knöcheln, aber die Knoten waren fest zugezurrt und meine Finger taub. Luc sattelte das Tier ab und war in diesem Moment abgelenkt. Ich versuchte, auf Knien und Ellbogen davonzukriechen, aber bemerkte rasch, dass es Zeitverschwendung war – ich kam nicht schnell genug voran, und meine Beine hinterließen offensichtliche Spuren in der Erde. Ich kniete mich hin und riss meinen Knebel herunter. Dann atmete ich tief ein und schrie, meine Stimme donnerte über den Berghang. Das Pferd wieherte auf und sprang von Luc weg, bevor es zur anderen Seite des Geheges galoppierte. Ich schrie noch einmal, betete dafür, dass jemand nah genug wäre, um mich zu hören.
Luc sprintete auf mich zu, aber ich schaffte es, ein letztes Mal um Hilfe zu schreien, bevor seine Faust auf meine Wange traf. Ich stürzte nach hinten, doch er zog mich an meinem Kleid nach oben und schlug mich erneut. Mein Gesicht pochte, meine Sicht verschwamm.
»Deine Lungen können sich wirklich hören lassen!«
Ich versuchte, wegzukriechen, aber er schnappte sich das Seil, das meine Beine fesselte, und zerrte mich einen Abhang hinunter, wobei meine Röcke nach oben bis über meine Taille wanderten. Als ich auf meinen nackten Beinen saß, befreite er meine Knöchel und band das Seil an einem von ihnen fest. Denn drehte er mich um und löste die Fesseln an meinen Handgelenken.
»Du musst schwimmen können. Nur so kommen wir unter den Berg.« Eine Hand griff nach dem Mieder meines Kleides und riss es herunter, während er meine Arme zur Seite stieß, die verzweifelt versuchten, ihn abzuwehren. »Keine Sorge, Cécile. Sie waren sehr deutlich dahingehend, dass deine Keuschheit unberührt bleiben muss.«
»Wer?«, fragte ich. »Von wem redest du? Wohin bringst du mich? Warum tust du das?«
Er schüttelte den Kopf. »Das wirst du sehr bald sehen.« Luc nahm das Seil auf, das um meinen Knöchel gebunden war, und zerrte mich in das eisige Wasser am Fuße der Felsen. Wenn ich nicht ertrinken wollte, musste ich anfangen zu schwimmen. Meine Atmung verwandelte sich in schwere Schluchzer, meine Angst baute sich auf, bis es schien, als könnte ich mich einfach selbst ertränken und Luc die Arbeit ersparen. Das musste er bemerkt haben, denn er schwamm zurück und griff nach meinem Arm.
»Reiß dich zusammen, Cécile! Ich habe dich nicht den ganzen Weg hierhergeschleift, nur damit du dich selbst in den Tod heulst. Auf der anderen Seite dieser Felsen befindet sich eine Höhle. Um dorthin zu kommen, müssen wir etwa vier Schritte tief tauchen und die Kante des Felsens passieren. Denkst du, dass du das hinbekommst?«
»Das ist Wahnsinn«, krächzte ich.
Luc tauchte ab. Ich hatte kaum noch die Gelegenheit, tief Luft zu holen, bevor das Seil an meinem Knöchel mich nach unten riss. Der Stein unter meinen Händen fühlte sich schleimig an, war scheinbar endlos. Ich schwamm angestrengt, das Seil hatte sich genügend gelockert, um ins Wasser treten zu können. Doch wo Luc war, konnte ich nicht sagen. Ich wusste nur, dass die Verbindung zu ihm mich hier unten halten würde, bis ich die Öffnung fand oder mir die Luft ausgehen würde.
Luftblasen entflohen meinen Lippen, schwebten frei an die Oberfläche. Meine Lungen brannten und schrien verzweifelt nach Luft. Mein Herz pochte schneller und schneller. Der Druck des Wassers über mir wurde stärker, bis meine Ohren ploppten. Dann verschwand der Fels und raubte mir sämtliche Orientierung in der undurchdringlichen Finsternis.
Kurz darauf fand ich den Rand des Felsens, aber als ich unter ihm hindurchschlüpfte, verdickte sich das Wasser für einen Moment wie Kleber und hielt mich wertvolle Sekunden lang fest. Meine Haut kribbelte, als stünde ich oben auf dem Berg inmitten eines Gewittersturms, in dem Blitze überall um mich herum durch die Luft zuckten. Ich erschauderte und kämpfte mich weiter nach oben.
Dann zerrte das Seil hart an meinem Knöchel, sodass mein Kopf plötzlich wieder heruntergedrückt wurde. Hände griffen nach meinen Handgelenken, und mein Kopf durchbrach die Wasseroberfläche. Ich atmete die süße, lebensspendende Luft ein. Um mich herum herrschte komplette Dunkelheit. Ich tastete blind herum, bis ich einen Felsen fand, der aus dem Wasser ragte, und klammerte mich ängstlich an seine Ränder.
Mit jeder Zelle meines Körpers spürte ich das eiskalte Wasser, das meinen Körper umgab, vernahm den rauen Stein unter meinen Fingern, roch die abgestandene, feuchte Luft und hörte das leise Plätschern, als Luc auf mich zuschwamm. Doch all meine anderen Sinne schienen unbedeutend gegenüber dem Verlust meiner Sehkraft zu sein. Ich erschauderte und wartete.
Schließlich durchbrach Lucs Stimme die Stille. »Alles in Ordnung?«
»Nein.«
Spannung baute sich zwischen uns auf, und ich verfluchte jede meiner Entscheidungen, die mich in diese Situation gebracht hatten. Wenn ich doch nur direkt nach Hause galoppiert wäre oder härter gekämpft hätte oder, verflucht noch mal, gesehen hätte, wohin ich reite, dann wäre ich vielleicht nicht hier.
Doch nun war es so. Ein krankhaft neugieriger Teil von mir wollte wissen, wieso. »Du schuldest mir eine Erklärung«, sagte ich.
»Aye, ich schätze, damit hast du recht«, lenkte er ein. »Aber zuerst brauchen wir Licht.«
Ich hörte, wie er aus dem Wasser kletterte und durch die Dunkelheit schlich. Dann ertönte das Klackern eines Feuersteins, und eine kleine Flamme leuchtete auf, die in diesem Augenblick dieselbe Wirkung auf mich hatte wie eine helfende Hand auf einen ertrinkenden Seemann auf stürmischer See. Vorsichtig kletterte ich aus dem Becken und ging darauf zu. Luc hielt einen brennenden Holzsplitter an eine Sturmlaterne. Als der Docht aufflammte, hob er sie hoch, sodass ihr angenehmer Schimmer den Raum erleuchten konnte.
Wir befanden uns in einer Art Höhle, auf allen Seiten umgab uns Stein. Abgesehen von dem nassen Eingang, durch den wir gekommen waren, war der einzige Ausweg ein dunkler Tunnel, der vom Wasser wegführte. Nichts deutete auf Schätze, Gold oder irgendetwas anderes von Wert hin. Es gab lediglich einen Stapel aus Vorräten und die Laterne, die Luc bei einem früheren Besuch hergebracht haben musste.
»Nun?«, fragte ich und schlang meine Arme um meinen eisigen Körper. Alles, was ich trug, waren ein Unterkleid und meine Stiefel. Der nasse Stoff verdeckte unbehaglich wenig. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dass er mir antworten würde, aber Luc war schon immer übermäßig stolz gewesen, also hätte es mich nicht überraschen sollen, als er es tatsächlich tat.
»Natürlich, natürlich.« Er lehnte sich näher zu mir, die Laterne warf einen Schatten über sein Gesicht. »Das ist einfach unglaublich. Ich selbst würde es kaum glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.«
»Komm zum Punkt, Luc!«
Er lachte, als hätte ich etwas außerordentlich Komisches gesagt. »Du wusstest eine gute Geschichte noch nie zu schätzen. Also schön, kommen wir direkt zur Sache. Ich habe die verschollene Stadt Trollus gefunden.«
Für einen langen Augenblick legte sich Stille über uns. Ich hatte einiges erwartet, aber nicht, dass seine Motivation mit einer mythologischen Stadt zusammenhing. »Soll das irgendein schlechter Scherz sein, oder hast du den Verstand verloren?« Meine Stimme hallte durch die Höhle. Verloren … oren … oren … oren … Wir zuckten beide zusammen und schauten uns unbehaglich um.
»Die Stadt ist nicht verschollen, Luc. Trollus wurde unter Felsen in der Größe eines halben Berges begraben.«
»Aye«, sagte er, und seine Augen verengten sich. »Begraben, aber nicht zerstört. Zumindest nicht vollständig.«
»Unmöglich. Nichts in dieser Welt wäre stark genug, einer solchen Last standzuhalten.«
»Das ist das Beste daran.« Er lehnte sich noch näher zu mir. »Es ist genau wie in den Geschichten: Sie haben die ganze Zeit über unter dem Berg gelebt!«
»Wer?«, fragte ich ängstlich, aber mindestens genauso neugierig.
Das orangefarbene Glühen der Flamme schimmerte in Lucs Augen, als er sich über die Lippen leckte und den Augenblick auskostete. »Die Trolle, Cécile. Sie sind hier!«
»Märchen«, flüsterte ich. »Geschichten, die unartigen Kindern Angst machen sollen.«
Luc lachte. »Oh, sie sind mehr als wahr und mehr als monströs. Und froh darüber, dass wir Menschen sie für Schatten in der Nacht halten. So machen ihnen die Leute keine Probleme oder versuchen, ihren Schatz zu stehlen.«
»Schatz.«
»Aye. Zimmer voll mit Gold und Juwelen.«
»Wenn sie Menschen so sehr hassen, warum sollten sie dich dann in die Nähe ihres Reichtums lassen?«, argwöhnte ich, während ich unbemerkt unsere Umgebung in mir aufnahm. Das Wasser lag direkt hinter mir. Wenn ich Luc überrumpeln könnte und es ins Wasser schaffte, hätte ich vielleicht eine Chance. Ich könnte mich bis zum Anbruch der Nacht im Wald verstecken und mich dann auf den Weg zur Farm machen, wenn mein Vater mich nicht vorher schon gefunden hätte.
»Seine Majestät hat es mir während unserer … Verhandlungen gezeigt.«
»Seine Majestät?« Ich lehnte mich zurück, stützte mich auf meinen Handflächen ab und stieß ein manisches Lachen aus. Dabei fiel mir auf, dass der Steinboden schräg war. Wenn ich mich mit meinem gesamten Gewicht nach hinten warf, würde ich ins Wasser rollen. »Ich wusste gar nicht, dass die Trolle ein Königshaus haben!«
»Oh, doch«, sagte er. »Sie sind diejenigen, die dich gekauft haben.«
Ich schnappte nach Luft. »Wofür?«
»Mit Gold«, sagte er, offensichtlich hatte er meine Frage missverstanden.
»Was haben sie mit mir vor?«, flüsterte ich.
Luc zuckte mit den Schultern. »Mit dem, was sie zugestimmt haben zu bezahlen, können sie dich auch in einen Kochtopf werfen, wenn es nach mir geht.«
Denn genau das taten die Trolle in den Märchen. Sie warfen dich lebendig in einen Topf mit kochendem Wasser, und dann nagten sie an deinem Fleisch, bis nur noch weiße Knochen übrig waren.
Ich kroch rückwärts auf das Wasser zu, meine Fingernägel rissen an den Steinen auf. Alles, woran ich noch denken konnte, war, dass ich einem der grausamsten Tode entgegengeführt wurde. Nichts, was Luc mir antun könnte, wäre schlimmer, als gefressen zu werden. Ich kämpfte mich zielstrebig zurück zum Wasser, aber Lucs Griff lag fest um meine Leine, und ich konnte es nicht mit seiner Kraft aufnehmen. »Hilfe!« Meine Stimme hallte vom Wasser und den Felsen wider, bis ich ein Dutzend Doppelgänger zu haben schien, die mich mit der Aussichtslosigkeit meiner Schreie zu verhöhnen schienen.
Luc schlug mir hart ins Gesicht. »Halt den Mund, sonst muss ich ihn dir wieder stopfen.« Er deutete auf das Glühen der Laterne. »Nimm die und dann geh los.«
Eine Kälte, die viel tiefer ging als nur bis in meine Haut, betäubte meine Hände, als ich Lucs Befehl Folge leistete.
***
Ich hatte angenommen, dass wir geradewegs in die Tiefe hineinlaufen würden. Doch stattdessen verbarg sich ein Labyrinth aus Tunneln, Felsspalten und Sackgassen unterhalb des Berges. Der Boden bildete einen unebenen Teppich aus Geröll und Steinen, durchzogen mit Rissen, die einem den Knöchel brechen oder jemanden sogar ganz verschlingen könnten. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, mit meinem Entführer im Nacken und dem Risiko eines gebrochenen Halses hinter jeder Ecke. Mein Unterkleid, das in der feuchten Dunkelheit einfach nicht trocknen wollte, klebte an meinem Körper und spendete keine Wärme. Das Licht der Sturmlaterne zitterte zusammen mit mir und warf seltsame Schatten auf den Stein, die mein Herz rasen ließen, bis ich davon überzeugt war, es würde aus meiner Brust springen.
Bei jeder Abzweigung waren unzählige Zeichen in den Stein geritzt oder mit Kreide darauf gemalt worden. Einige sollten offensichtlich die Richtung weisen oder Warnungen darstellen, andere Symbole hingegen hatten für mich keine Bedeutung. Logik verdrängte langsam meine Angst, und ich wusste, dass ich mir den Weg merken musste, sollte sich mir jemals die Gelegenheit zur Flucht eröffnen.
»Von wem sind die?«, fragte ich. Nach der langen Stille klang meine Stimme laut, obwohl ich in ruhigem Ton Sprach, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Selbst gut gelaunt reagierte Luc schnell über, und ich musste ihn am Reden halten.
»Schatzjäger.« Luc tippte mit seinem Messer gegen eins der seltsamen Symbole. »Jeder Sucher hat seine eigene Markierung, die ihm den Weg weist, den er für den schnellsten hält. Oder eher für den sichersten«, berichtigte er sich.
Ein Pfeil neben einem der in den Stein geritzten Symbole zeigte nach rechts, wo sich ein schmaler, nischenartiger Tunnel öffnete, der selbst für mich zu eng wirkte. Eine Handvoll Symbole besaßen Pfeile, die nach links zeigten, wo es im Vergleich zur anderen Richtung viel offener und einladender wirkte. »Warum nehmen wir nicht den anderen Weg?«
Luc schüttelte seinen Kopf und tippte auf zwei wellige Linien, die unter die Markierungen geritzt worden waren. »Die bedeuten, dass auf diesem Weg Sluags gesichtet wurden. Oder zumindest ihre Hinterlassenschaften.«
»Was ist ein Sluag?«
Ein beklommener Ausdruck schlich sich auf Lucs Gesicht, der nicht wirklich dabei half, meine Angst zu lindern. »Etwas Großes, dem man besser aus dem Weg geht«, sagte er. »Ich habe die Trolle nach ihnen gefragt. Sie meinten, wenn es mir gelingen sollte, nah genug an einen heranzukommen, würde ich nicht lange genug leben, um davon erzählen zu können. Sogar sie fürchten sich vor ihnen.« Er deutete nach rechts. »Die schmalen Gänge sind sicherer.«
Ich hielt die Laterne in den linken Gang, aber die wenigen Meter Sichtweite spendeten mir nicht den Trost, dass dort kein Sluag oder noch Schlimmeres lauerte. Mit an die Wand gedrücktem Rücken schob ich mich widerwillig in den Spalt. Die Felsspalte blieb noch lange schmal, und wir kamen nur erschöpfend langsam voran. Als sich der Gang endlich zu einem breiteren Weg öffnete, ließ ich mich erleichtert auf einen nassen Stein sinken. Luc trat kurz nach mir durch die Öffnung, sein Gesicht war genauso dreckig und erschöpft wie meines wahrscheinlich.
»Wir müssen weitergehen«, sagte er, bevor er einen tiefen Schluck aus seinem Trinkbeutel nahm und ihn dann mir reichte. »Die Trolle erwarten uns bei Einbruch der Nacht.«
Natürlich fand ich diese Erinnerung nicht besonders motivierend. »Wer hat dir überhaupt von diesen Tunneln erzählt? Oder erwartest du, ich würde glauben, dass du eines Tages ins Zentrum des Berges gekrochen bist, um zu sehen, ob du auf der anderen Seite wieder herauskommst?«
Luc grinste mich höhnisch an. »Niemand darf irgendjemandem von außen von diesem Ort erzählen – das stellen die Trolle schon sicher. Wenn du es den ganzen Weg bis nach Trollus schaffst und sie entscheiden, dass du nützlich genug bist, um nicht auf der Stelle umgebracht zu werden, lassen sie dich einen magischen Eid schwören, der dich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Deshalb konnte ich dir nichts sagen, ehe wir nicht die Felsen passiert hatten. Die Trolle, sie lieben ihre Eide. Und sie gehen nicht sehr zimperlich mit denen um, die ihr Wort brechen, also sollten wir besser weitergehen.«
Ich blieb wie angewurzelt sitzen, weigerte mich, den Weg fortzusetzen.
Luc warf verzweifelt seine Hände in die Höhe. »Na schön. Mir ist aufgefallen, dass dem alten Henri nie die Münzen auszugehen scheinen, um sich in der Stadt zu betrinken, obwohl er nicht einen Tag in seinem Leben gearbeitet hat. Also bin ich ihm gefolgt, weil ich dachte, er hätte irgendwo in der Nähe ein Geheimversteck im Wald. Wie sich herausstellte, hat er all die Jahre mit den Trollen Handel betrieben, und niemand hat etwas mitbekommen.«
»Handel womit?«
»Ausgerechnet mit Büchern.«
»Und du? Was hast du ihnen gebracht?«
Luc zuckte mit den Schultern. »Dieses und jenes. Sie zahlen gut, aber die Reise ist gefährlich. Als ich hörte, dass sie nach einem Mädchen suchten, deren Beschreibung zu dir passte, wusste ich, dass ich auf eine Goldgrube gestoßen war, und ich hatte recht. Ich durfte ihnen meinen Preis nennen.«
Meine Wut übermannte meine Angst vor einer Bestrafung. Er hatte mich verkauft, hatte mein Leben weggegeben, nur weil er zu gierig für ehrliche Arbeit war. Mein gestiefelter Fuß rauschte nach vorn und erwischte sein Knie. Ich beobachtete, wie er über die Kante des Felsens fiel, doch leider ließ sein Griff um das Seil nicht nach, und ich wurde mitgezerrt, bis meine Füße über dem Rand baumelten.
»Du willst einfach nicht aufgeben, oder?« Luc saß einen guten Meter unter mir in einer glibberigen Pfütze, deren ranziger Gestank mir in die Nase stieg. Er war nicht allein.
»Sieht aus, als hättest du einen Freund«, zischte ich und zeigte auf das Skelett, das neben Luc auf dem Boden lag. »Schade, dass euch nicht das gleiche Schicksal widerfahren ist.«
Luc blickte nach unten und verzog das Gesicht. Dann nahm seine Neugier überhand, und er sah sich die Leiche genauer an. »Leuchte mal mit der Lampe hierher, Cécile. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn bisher noch nie bemerkt habe.«
Ich gehorchte, aber nur, weil mir nichts anderes übrig blieb. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte er mich unweigerlich über den Rand gezerrt. Dem Zustand der Knochen nach zu urteilen, war dieser Mann schon eine ganze Weile tot. Erneut breitete sich Gänsehaut auf meinen Armen aus. »Was ist das für Schleim?«
»Ich weiß nicht … So was habe ich noch nie gesehen.« Er klang nervös, und seine Unsicherheit ging wie die Pest auf mich über.
»Wie oft bist du diesen Weg schon gegangen?«, fragte ich, als sich in mir die Angst breitmachte, dass wir uns vielleicht verlaufen hatten, ohne es zu bemerken.
Er hatte keine Zeit zu antworten, ehe die Höhle von einem seltsamen donnernden Brüllen erfüllt wurde. BAROOOM! Das Echo ebbte ab und wurde von dem feuchten Rascheln von etwas ersetzt, das in unsere Richtung schlitterte. Etwas Großes.
Lucs verängstigter Blick begegnete meinem, dann flüsterte er: »Lauf!«
Kapitel 3CÉCILE
Die Angst mochte uns Flügel verliehen haben, aber das Labyrinth des Verlassenen Berges zwang uns dazu, weiterzukriechen. Wir schlängelten uns um Felsbrocken herum, unsere Stiefel rutschten auf losem Geröll weg, und unsere Ohren waren gespitzt, lauschten nach dem verräterischen Rascheln des Sluag, der uns auf den Fersen war. Wenn er schnell genug war, uns zu erwischen, entschied er sich dagegen. Aber immer, wenn ich dachte, wir wären ihm entkommen, bogen wir um eine Ecke, und das glitschige Rascheln drang erneut an unsere Ohren. Es zwang uns dazu, umzukehren und einen anderen Weg zu nehmen – fast so, als würde er mit uns spielen. Die Erschöpfung holte uns ein, und wenn sie das tat, dann auch bald auch der Sluag.
Luc begutachtete die Markierungen, während wir beide keuchten und um Luft rangen. Wir standen an einer Kreuzung von drei Tunneln. »Da lang«, flüsterte er. »Noch ein bisschen weiter, dann erreichen wir ein schmaleres Loch. Wir müssen uns klein machen und hindurchkrabbeln, aber sobald wir die andere Seite erreicht haben, sind wir in Trollus. Dorthin wird uns der Sluag nicht folgen können.«
BAROOOM!
Ich rannte los, wollte dem Gang folgen, auf den Luc gezeigt hatte, doch er stieß mich zur Seite und ging als Erster. Nachdem er das schmale Loch erreicht hatte, ließ er sich auf den Bauch fallen und schlängelte sich hinein. Seine kleine Tasche blieb an der Ecke hängen, weshalb er zurückkriechen, sie abnehmen und vor sich durch den Tunnel schieben musste.
Raschel, raschel, raschel. BAROOOM! Triumph hallte donnernd im Brüllen der Kreatur wider, als sie näher kam.
»Schnell, schnell, schnell«, flüsterte ich und schaute in die Richtung, aus der wir gekommen waren.
Raschel, raschel, raschel.
Jetzt lugten nur noch Lucs Füße aus dem Tunnel hervor. Ich ließ mich auf meine Knie sinken und bereitete mich darauf vor, in dem Loch zu verschwinden, sobald er Platz gemacht hatte.
Raschel, raschel, raschel.
Lucs Sohlen verschwanden. Ich warf einen letzten Blick nach hinten, und das Licht der Laterne traf auf das Monster, das um die Ecke gebogen kam. Der Sluag brüllte, sein Körper war weiß und schimmerte wie eine riesige Nacktschnecke. Aus seinem Maul schoss eine Zunge, die einer Peitsche glich. Die Laterne zerschellte vor meinen Füßen und erlosch. Ich schrie und krabbelte in das Loch hinein.
Ich konnte nichts sehen – nur hören, wie Luc vor mir fluchte und das Rascheln des Sluag hinter mir lauter wurde. Ich kroch schneller, unsicher, wie weit ich bereits gekommen war und ob meine Knöchel noch weit genug herausragten, sodass sie vom Monster gepackt werden konnten.
BAROOOM!
Ich schrie auf, als etwas auf die Sohle meines Stiefels traf, die Kraft dahinter warf mich gegen Lucs Beine. »Schneller! Er kommt!«
BAROOOM!
Wir krabbelten weiter, doch der Tunnel erzitterte, als die Kreatur gegen den Felsen krachte. Ich kreischte, Schnodder und Tränen überzogen mein Gesicht, als ich mich gegen Lucs Füße drückte, um durch den engen Gang zu gelangen. Selbst als er die andere Seite erreichte und mich aus dem Tunnel zog, dauerte es einen langen Moment, bis sich meine Panik weit genug gelegt hatte, um wieder klar denken zu können. Ich war nicht in Sicherheit. Nicht nur, dass ich entführt worden war, mein Entführer war auch noch zu dämlich, um uns sicher zu denen zu bringen, an die er mich verkauft hatte. Es war alles umsonst. Ich würde so oder so sterben.
»Ich hasse dich«, krächzte ich. Bevor ich mich wiederholen konnte, musste ich schwer schlucken. »Ich hasse dich.« Es war immer noch nicht genug, also brüllte ich die Worte heraus. »Ich hasse dich, Luc!«
»Wo ist die Laterne?« Seiner Stimme fehlte es an jeglicher Emotion, aber ich spürte, wie er das Ende vom Seil aufnahm, das immer noch um meinen Knöchel gewickelt war.
»Am Ende des Tunnels bei dem Sluag – na los, geh und hol sie.« Doch fühlte ich mich bei dem Gedanken, wie diese Kreatur ihn herunterschlang, kein Stückchen besser. Ich wäre alleine in der Dunkelheit gefangen, ohne ein Gefühl für Zeit oder Orientierung. Meine Chancen, den Weg nach draußen zu finden, waren non-existent – ich würde hier unten verhungern, und niemand würde je erfahren, was geschehen war.
Luc stöhnte. »Du Idiotin! Was sollen wir jetzt bitte machen?«
Ich hörte, wie er in seiner Tasche herumkramte, und schaute mich um, sofern das in vollkommener Dunkelheit möglich war.
Oder vielleicht doch nicht so vollkommen.
In der Ferne lockte ein silberner Schimmer, der nur eins sein konnte: Mondlicht. Und Mondlicht bedeutete meinen Ausweg.
»Lass das Seil los«, flüsterte ich, irgendwie fanden meine Gebete ihren Weg in meine Stimme, Hoffnung gab ihnen Macht, die meine Angst überschattete.
»Was?«
»Ich sagte, lass das Seil los.«
Wasser tropfte. Lucs Atem wurde ruhig und gleichmäßig. Ein Luftzug ließ mich erzittern, dann lockerte sich das Seil um meinen Knöchel.
Aber bevor ich losrennen konnte, wurde es hell. Jemand Weiteres war in diesem Tunnel.
»Was zum …?«, setzte Luc an, doch dann stöhnte er und stürzte sich von hinten auf mich.
»Hilfe!«, keuchte ich, aber unter seinem Gewicht bekam ich kaum noch Luft. Ich schob einen Ellbogen unter mich und drückte mich hoch, bevor ich tief Luft holte und schrie. Lucs Faust traf auf meinen Hinterkopf und stieß mein Gesicht gegen den steinigen Boden, aber meine Stimme hallte bereits durch den Tunnel. Hilfe … Hilfe … Hilfe …
Ich wollte mich umdrehen, um mich gegen ihn zu wehren, aber Luc schlug gegen meinen Schädel, was ein Schwindelgefühl in mir auslöste. Licht flackerte vor meinen Augen auf, und plötzlich verschwand sein Gewicht. Mit einem gedämpften »Uff« und einem schmerzerfüllten Stöhnen fiel Luc neben mir auf den Boden. Jeder Zentimeter meines Körpers schmerzte, aber ich glaubte nicht, dass etwas gebrochen war. Ich konnte also immer noch rennen.
»Ich glaube nicht, dass das Teil der Abmachung war, Monsieur Luc.«
Ich erhob mich auf meine Knie und blickte zu dem Mann empor, der vor uns stand, seine Gestalt wurde von dem Mondlicht umrandet. »Helft mir«, flehte ich und zupfte an dem seidenen Stoff seines Mantels. »Bitte helft mir! Er hat mich entführt und will mich an die Trolle verkaufen.«
»Ist das so?« Seine Stimme übermittelte den lyrischen Tonfall des Hofes, obwohl ich überrascht war, dass ein Edelmann sich der Schatzsuche hingab. Doch ich war nicht in der Position, ihn zu beurteilen. Wenn ich Hilfe finden konnte, würde ich sie annehmen. Ich krabbelte auf Händen und Knien an dem Mann vorbei, brachte ihn zwischen Luc und mich. Jeder musste besser sein als Luc.
Meine Augen fixierten die glühende Lampe hinter seinem Kopf. Nein, keine Lampe – eine Kugel, die wie von selbst in der Luft zu schweben schien. Sie schwang herum und hing vor meinem Gesicht, blendete mich mit ihrer Helligkeit, aber strahlte nur wenig Wärme aus.
»Wie schwer bist du verletzt, Mademoiselle de Troyes?«
Ich hob meine Hand dem Licht entgegen, doch dann änderte ich meine Meinung und zog sie wieder zurück. Erst dann realisierte ich, dass er mich mit meinem Namen angesprochen hatte. Ich begegnete seinem Blick. Oder eher einem seiner Augen. Er stand eigenartig da und hielt sein Gesicht leicht abgewandt, sodass ich nur sein Profil erblicken konnte. Er könnte in etwa so alt sein wie mein Bruder und war äußerst attraktiv. Das Licht aus der Kugel schimmerte in seinem silbergrauen Auge, das von innen heraus zu leuchten schien. Noch nie in meinem Leben war ich jemandem mit solchen Augen begegnet.
»Ich befürchte, Ihr seid im Vorteil, Monsieur, weil Ihr meinen Namen zu kennen scheint, ich Euren jedoch nicht.« Mein Herz schlug schneller. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Vor Angst stellten sich mir die Nackenhaare auf wie bei einem Hund, als ich den Mann von oben bis unten musterte. Wer war er, und was hatte er unter dem Geröll des Verlassenen Berges zu suchen?
»Ich bitte um Verzeihung, Mademoiselle, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Marc de Biron, Comte de Courville.« Seine Aufmerksamkeit wanderte wieder zu Luc. »Du solltest sie unversehrt hierherbringen.«
»Ihr habt Glück, dass sie noch lebt – wir wären beinahe von diesem Sluag gefressen worden«, erwiderte Luc scharf.
»Ihr zwei hattet Glück, nicht ein halbes Dutzend von ihnen angelockt zu haben, so wie ihr euch verhalten habt. Ich wäre nicht überrascht, wenn euer Streit in ganz Trollus hörbar gewesen wäre, so verdammt laut wart ihr.«
»Nein«, flüsterte ich. »Nein, nein, nein.« Mein Instinkt sagte mir, dass ich rennen sollte, aber wohin? Ich hatte kein Licht, und unser Hinweg wurde von dem Sluag blockiert. In der anderen Richtung erstreckte sich jedoch der Weg, den er gekommen war, und er war … Ich erhob mich auf meine Füße und drückte mich gegen die Wand. »Ihr seid ein … Er ist ein …«
»Aye, Cécile«, sagte Luc, der mein Stammeln endlich zu bemerken schien. »Es stimmt, er ist ein Troll.«
»Aber du sagtest, sie wären Mon–« Abrupt drehte sich der Troll um, wandte sich mir komplett zu, und das Wort erstarb auf meinen Lippen, wurde von einem Schrei ersetzt. Luc hatte die Wahrheit gesagt.
Kapitel 4CÉCILE
Die beiden Seiten seines Gesichts, so makellos sie auch waren, wirkten wie die Hälften einer zerbrochenen Skulptur, die schief zusammengesetzt worden waren. Die fehlende Symmetrie war mehr als unbehaglich – sie wirkte schockierend, beinahe grauenhaft. Ein Auge saß höher als das andere. Ein Ohr tiefer als sein Pendant. Sein Mund schien permanent boshaft verzerrt zu sein. Ich wollte zurückweichen, doch stieß gegen Luc, der eine dreckige Hand über meine Lippen legte und meinen Schrei erstickte.
»Keine sehr kluge Idee«, flüsterte er mir ins Ohr, ehe er seine Hand wieder senkte.
»Tut mir leid«, sagte ich und wiederholte mich immer wieder, da meinem Verstand keine anderen Worte mehr einzufallen schienen. »Tut mir leid.«
Die Stille zog sich in die Länge. Als ich meinen Kopf hob, hatte das Licht sich hinter ihn zurückgezogen und sein Gesicht wieder in Schatten gehüllt.
»Komm«, sagte er. »Sie erwarten dich.«
Abrupt drehte er sich um, sein Mantel schwang mit, als er den Tunnel hinunterstapfte. Kurz darauf zögerte er jedoch und streckte zu meinem Entsetzen seinen Ellbogen aus. »Mademoiselle.«
Ich wollte mich nicht bei ihm unterhaken, denn das würde bedeuten, dass ich zustimmte, mit ihm zu gehen. Ich starrte den Weg hinunter, den wir gekommen waren – der Oberfläche entgegen, wo mein Vater und unsere Nachbarn schon panisch nach mir suchen mussten. Aber sie würden niemals vermuten, dass Luc mich geschnappt hätte. Ich musste mich auf meinen eigenen Mut verlassen, wenn ich fliehen wollte, aber dafür war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt – nicht, solange sie mit einem Fluchtversuch rechneten.
»Du hast mein Wort, Mademoiselle. Ich werde dir in keiner Weise Schaden zufügen.«
Etwas an der Art, wie er es sagte, ließ mich seine Worte glauben. Ich atmete tief durch, ging auf den Troll zu und legte meine Hand auf seinen Arm. Unter meinen kalten Fingern fühlte sich der Brokat seines Mantels warm und schwer an. Ich spürte auch Stärke – eingesperrt wie der Tiger in dem Zirkus, zu dem mein Vater mich einmal mitgenommen hatte. Etwas anderes jedoch schickte mir einen Schauer über den Rücken. Etwas wie das Prickeln eines sandigen Windes oder die Spannung in der Luft kurz vor einem Gewitter strömte durch mich hindurch. Obwohl ich es nie für möglich gehalten hätte, existierte hier unten Magie, die stark genug war, einen Mann anzuheben und die Dunkelheit zu erleuchten. Vielleicht war es naiv von mir, das sofort zu glauben, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass die Trolle Magie besaßen.
Meine Zunge fuhr über meine trockenen Lippen. Fürs Erste würde ich mitspielen. »Dann sollten wir sie nicht warten lassen.«
***
Er führte uns durch einen Irrgarten aus Tunneln und schien sich bei seiner Wahl stets sicher zu sein, obwohl es nichts für mein Auge Sichtbares gab, das sie voneinander unterschied. Ein Labyrinth, das dazu diente, einen Menschen hineinzulocken, ohne ihn jemals wieder herauszulassen. Obwohl ich mit aller Kraft versuchte, es zu unterdrücken, erschauderte ich.
Der Troll blickte auf mich herab. Schweigend löste er seinen Arm von meinem und öffnete seinen Mantel, ehe er ihn wärmend über meine Schultern legte. »Danke«, brachte ich hervor und wickelte den seidenen Stoff um mich. Ein silbernes Auge begegnete meinem Blick, sein Gesicht war so geneigt, dass ich nur sein Profil sehen konnte. Ich fragte mich, ob er sich immer so gab oder ob er seine Deformität nur zu meinen Gunsten verbarg. »Nicht dafür«, sagte er. »Ich bin angewiesen worden, sicherzustellen, dass du gut behandelt wirst.«
Hinter uns stieß Luc ein leises Schnauben aus. Ich ignorierte ihn und legte meine Hand wieder auf den Arm des Trolls.
Der Boden wurde ebener, war glatt getreten auf eine Art und Weise, die von den unzähligen Füßen zeugte, die diesen Weg über die Jahre hinweg gegangen waren. Schließlich wich der nackte Felsen Pflastersteinen, die ein Mosaik aus Schwarz, Grau und Weiß bildeten. An den Wänden des Tunnels war deutlich eine horizontale Linie zu erkennen, die den Bruch zwischen dem Berg und einem Gebilde aus menschengemachten oder vielleicht trollgemachten Strukturen trennte. Je weiter wir gingen, desto höher wanderte diese Linie, als würde eine unsichtbare Kraft den gefallenen Berg immer höher halten, während wir voranschritten und sich vor uns eine Stadt aus dem Schutt erhob. Ich wollte meine Fingerspitzen durch die scheinbar leere Spalte gleiten lassen, doch meine Hand zuckte zurück.
Es war warm.
Zögerlich hob ich meine Hand erneut und steckte meine Finger in die Lücke. Feuchte Hitze legte sich über meine Haut, spürbar, doch gleichzeitig auch nicht. Ich versuchte, etwas davon herauszuschöpfen, aber die Magie floss durch und um meine Hand und blieb an ihren Platz. Der Bruch erhob sich weiter, bis ich ihn nicht mehr erreichen konnte.
»Die Magie hält den Berg oben«, murmelte ich und betrachtete die Mauern, zwischen denen wir jetzt liefen.
»Das tut sie«, bestätigte der Troll. »Sie ist Teil des Baums.«
Baum?
Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass er mich beobachtet hatte. Der Ausdruck in seinem Auge wirkte berechnend, beinahe abschätzend. Es war jedoch das Mitleid in ihm, das meine Angst erneut schürte. Warum war ich hier? Was für einen Handel war Luc mit den Trollen eingegangen, und was für eine Rolle spielte ich dabei?
Als wir um eine Kurve bogen, wurde unser Weg von einem Metalltor versperrt. Dahinter glühte ein silberner Schimmer, den ich für Mondschein gehalten hätte, hätte ich es nicht besser gewusst. Eine sanfte Brise wehte durch den Korridor, Nebel befeuchtete meine Wangen, gefolgt von dem Klang fallenden Wassers. Neugierde rang mit Angst in mir. Ich ließ von dem Arm des Trolls ab und trat durch das Tor, hinaus auf einen Felsvorsprung. Die Höhle war riesig, und was in dem Tal unter uns lag, raubte mir den Atem.
Die verlorene Stadt Trollus.
»Felsen und Himmel«, flüsterte ich.
»Hier gibt es nur Felsen«, kommentierte Luc hinter uns. Der Troll ballte seine Hand zu einer Faust, doch Luc sprach die Wahrheit. Dunkelheit umgab die Höhle, und die Decke bestand aus undurchdringlichem Stein. Keine Sterne waren zu sehen, kein Mond.
»Hier entlang, Mademoiselle.« Er nahm meinen Arm und zog mich mit sich. Wir gingen eine Reihe von Granitstufen hinunter, die in regelmäßigem Abstand von silbernen Laternenmasten aus Kristall erleuchtet wurden. Die Seiten des Tals waren terrassenförmig angelegt, und jede Ebene wurde von weißen Steingebäuden gesäumt. Doch am beeindruckendsten war der Wasserfall, der sich aus der Finsternis ergoss und den rauschenden Fluss unter uns bildete. Das Tosen des Wassers hallte unaufhörlich durch die Höhle. Es war laut genug, um einem den Verstand zu rauben, und ich fragte mich, wie die Trolle diesen permanenten Lärm aushielten.
Dann begriff ich. »Das ist der Teufelskessel!«
»Wir nennen es Himmelspforte«, murmelte der Troll, und ich konnte die Ironie in seiner Stimme vernehmen. Ich hatte Legenden über den Kessel gehört. Es wurde erzählt, dass der Brûlé zwischen dem Verlassenen Berg und seinem südlichen Nachbar hindurchfloss, aber seit dem Erdrutsch verschwand der Fluss in einem Loch im Boden. Man sagte sich, dass ein früherer Herrscher einen Bettler dafür bezahlt hatte, sich in einem Holzfass in den Kessel zu stürzen, und über zehn Jahre später wäre er in Trianon wieder aufgetaucht, gesund und munter, aber nicht in der Lage zu berichten, wo er gewesen war.
»Guten Abend, Lord Marc.«
Die neue Stimme erschreckte mich, und ich zuckte zusammen, ehe ich in die Dunkelheit spähte. Eine glühende Kugel bewegte sich stetig auf uns zu – eine kaum erkennbare Gestalt schlurfte unbeholfen über den Boden. Dann rollte der Troll in unseren Lichtkegel, und ich musste mir auf die Zunge beißen, um bei dem Anblick seiner geschrumpften, nutzlosen Gliedmaßen, die an dem Torso der Kreatur hingen, nicht laut nach Luft zu schnappen. Er rollte sich auf seine verkrüppelten Füße und streckte seine Hand nach dem Laternenmast aus, der unter seiner Berührung hell aufflackerte.
»Guten Abend, Clarence«, sagte der Comte mit leiser Stimme, als er mich auf die nächste Stufe zog.
»Ist sie diejenige?«
»Ich nehme an, das werden wir bald herausfinden«, antwortete Marc. Sein Tonfall deutete an, dass er keine weiteren Fragen gestellt bekommen wollte.
Das Ding namens Clarence betrachtete mich mit seinen glühenden silberfarbenen Iriden, als fragte es sich, ob ich gut genug für eine Mahlzeit war. Unbehaglich wandte ich mich ab. Als ich den Mut aufbrachte, wieder nach vorn zu schauen, hatte der Troll seine rollende Reise erneut aufgenommen.
»Bin ich diejenige wofür?«, fragte ich und hob meinen Blick. Aber der Comte antwortete nicht. In meinem Kopf überschlugen sich die Möglichkeiten, aber keine von ihnen schien die Anstrengungen zu rechtfertigen, die sie investiert hatten, um mich hierherzubringen.
An der einen Seite des Tals schlängelte sich eine makellose gepflasterte Straße entlang, aber der Comte führte uns stattdessen über die lange Steintreppe dem Fluss entgegen. Das Mauerwerk wirkte anders als alles, was ich je erblickt hatte. Keine Oberfläche war unverziert geblieben. Das musste jahrzehntelange Arbeit gewesen sein, aber ich nahm an, dass sie diese Zeit gehabt hatten. Brunnen und Statuen säumten jede Ecke. Anstatt Pflanzen zierten Glasskulpturen in Form von Bäumen, Büschen und Blumen ihre Gärten. Diese empfindlichen Kunstwerke hätten an der Oberfläche, wo sie den Elementen schutzlos ausgeliefert wären, keinen Monat überstanden. Augenscheinlich schien Trollus sich keine Sorgen um Hagelschauer machen zu müssen.
Allerdings war es eine leere Schönheit. Mit Ausnahme von uns selbst und Clarence hatte ich kein einziges Anzeichen für Leben in der Stadt entdeckt. »Wo sind alle?«, wollte ich mit leiser Stimme wissen.
»Es herrscht bereits die Ausgangssperre«, antwortete der Comte. »Sie sind drinnen.« Er deutete auf ein Gebäude, und ich sah, wie ein Vorhang zugezogen wurde, jedoch hatte ich zuvor die leuchtenden Augen entdecken können, die mich angestarrt hatten.
»Das ist neu«, murmelte Luc, woraufhin ich mir die dunklen Fenster mit wachsendem Unbehagen ansah, die die Straße säumten. Jetzt, da ich wusste, wo sie sich aufhielten, spürte ich die Augen auf mir. Der Comte legte eine in Leder gehüllte Hand auf den Griff seines Schwertes, seine schattenhafte Gestalt strahlte Anspannung aus, als er unsere Umgebung absuchte. »Wir sollten nicht verweilen«, sagte er und verlängerte seine Schritte, sodass ich in einen leichten Lauf fallen musste, um mit ihm mitzuhalten.