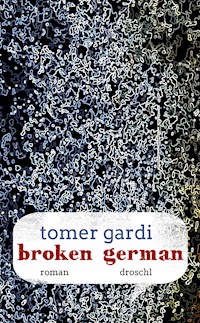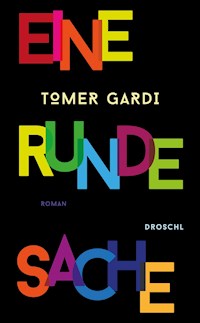16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Tomer Gardi schreibt eine moderne Scheherezade-Geschichte im heutigen Israel. Verspielt in Ton und Form, doch bitterernst im Kern. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Schriftsteller, der beim Arbeitsamt um Unterstützung ansucht. Bereits bei seiner Jobbezeichnung stößt er auf Widerstand: »So einen Beruf gibt es nicht, Schriftsteller.« Findig wie er ist, schlägt der Autor einen Deal vor: Er erzählt dem Mann hinterm Schreibtisch eine Geschichte und bei Gefallen erhält der Schriftsteller den Stempel. So beginnt das Erzählen ums Überleben, das zugleich treibende Kraft in dem von Volten und Verweisen wimmelnden Roman ist. Wie in einer Matrjoschka viele weitere Puppen stecken, so erzeugen die Handlungsstränge neue Erzählebenen und -welten. Mit Tolly Grotesky, Lea Agunis, Abu Adwan und anderen zeichnet Tomer Gardi unvergessliche Figuren, die im Alltag der Staatsgewalt ausgesetzt sind und sich auf die je eigene Weise ihre Wege bahnen müssen. Nach der Lektüre dieses Romans wissen wir: Ob Tomer Gardi nun Bücher in "Broken German" oder auf Hebräisch schreibt, er bleibt sich in seiner Verspieltheit und seinem stilistischen Eigensinn treu. Mit großer Leichtigkeit wechseln die verschiedenen Erzähler*innen zwischen märchenhaftem Ton und Umgangssprech.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Ähnliche
Die Zeichensetzung in diesem Buch folgt den rhythmischen Besonderheiten der Prosa Tomer Gardis.
© Literaturverlag Droschl Graz – Wien 2019 Leicht bearbeitete Fassung der Originalausgabeרזחוי ךפסכש וא© Tomer Gardi 2017 Umschlag: & Co www.und-co.at Satz: AD
ISBN 978-3-99059-031-7
Literaturverlag Droschl Stenggstraße 33 A-8043 Graz
www.droschl.com
Tomer Gardi
Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück
Roman
Aus dem Hebräischen
Die Geschichte beginnt so.
Ein arbeitsloser Mann geht zum Amt. Stempeln. Er durchläuft alle Kreise des Sicherheitschecks, der Kontrolle, der Überwachung, Piepsen, Gürtel abnehmen, Taschen leeren, alle Sachen hier hinein, jetzt durchgehn, Gürtel anziehn, alle Sachen wieder zurück, danke. Er geht zum Aufzug, fährt rauf zum Amt, zweiter Stock. Kriegt einen Zettel mit der Nummer des Schalters, wartet bis er drankommt, wartet bis er drankommt, wartet bis er drankommt, er ist dran.
Er ist dran, setzt sich, dem Beamten gegenüber. Der Beamte schaut ihn nicht an. Die Augen des Beamten ruhen konzentriert auf dem Bildschirm. Der Beamte fragt den Mann ihm gegenüber nach seinem Beruf. Der Mann ihm gegenüber sagt, ich bin Schriftsteller.
Der Beamte hält inne, spielt nicht mehr mit der Maus. Schaut nicht mehr auf den Bildschirm. Der Beamte wendet den Blick vom Bildschirm. Er schaut den Menschen gegenüber an. Er sagt, so einen Beruf gibt es nicht, Schriftsteller. Der Arbeitslose schaut ihm in die Augen, Auge in Auge schaut er ihn an, erwidert seinen Blick, sagt: Und ob es den gibt. Das ist mein Beruf, sagt er. Der Arbeitslose. Schriftsteller, sagt er. Der Beamte holt tief Luft, stößt sie ungeduldig aus der Nase. Ich sagte bereits, sagt er, das ist kein Beruf, Schriftsteller. Schriftsteller ist wohl ein Beruf, sagt der Arbeitslose, mein Beruf nämlich, beharrt er. Der Beamte streitet ab, der Arbeitslose beharrt und so weiter.
Und so fort, her und hin und hin und her, es hätte endlos weitergehen können, ziemlich festgefahrne Situation, doch dann schlägt der arbeitslose Mann dem Beamten eine Art Geschäft vor. Einen Deal. Ein Angebot. Ich, sagt er zu dem verblüfften, dem überraschten Beamten, ich, sagt er dem Beamten, erzähl Ihnen eine Geschichte. Und wenn Sie die gut finden, sagt er dem Beamten, und schön, und wenn Sie die mögen, dann stempeln Sie meine Karte. Arbeitslosengeld. Eine Art Bezahlung, sagt er. Ist ja Arbeit. Und wenn nicht, dann stempeln Sie eben nicht, sagt er, der arbeitslose Mann, wartet die Antwort nicht ab, fängt einfach an zu erzählen, füllt die Leere zwischen ihnen, zwischen sich und dem Beamten, mit Wörtern, noch bevor der Beamte vom Amt ihn stoppen kann, bevor er zuknallen, zuklappen kann. Dieser Morgen hatte überhaupt schon am Abend zuvor begonnen. Ich war von einem weiteren Tag auf der Straße nach Hause gekommen, einem weiteren Tag arbeitslos. Ohne Arbeit. Müd vom Müßiggang. Wollte endlich schlafen, abschließen mit diesem Tag, seinen letzten Stummel ausdrücken. Vom Tor führt zu dem Block, in dem ich wohne, ein Weg, erst am Haus lang und dann ins Treppenhaus. Entlang diesem Weg steht eine angepflanzte Reihe Büsche. Schön sind sie, die Büsche. Angenehm und schön anzusehn, sie bescheren den Augen einen Moment grüner Erholung, obschon sie auch Nachteile haben, ihre Wurzeln drücken die ohnehin überlasteten und vergammelnden Abwasserrohre nach oben, sodass sie bersten, und die Zweige der Büsche laden gradezu dazu ein, allerlei Gebrauchtes dort hinzuwerfen, Binden, Klopapier, Nadeln, Kondome.
Entlang dieser dubiosen, kurzen Allee, auf den schmalen Streifen Erde, dem entlang die Büsche gepflanzt sind, stellen die Bewohner des Blocks ihre Gasballons hin. Gelbe Leitungen führen über die Köpfe der Ein- und Ausgehenden von den Gasballons hinauf in die Wohnungen, wie ein riesiges Beatmungsgerät an einem siechen Haus. Als sei jede Wohnung ein Nasenloch, und der greise Sterbliche, das Gebäude, weilt, müde von all dem, noch immer hienieden, ein nur noch künstliches, erschöpftes Verweilen, das sich längst überholt hat. Ist vielleicht ein überflüssiges Bild, dieses Beatmungsgerät, aber so wirken diese Ballons mit ihren dünnen Leitungen auf mich. Entlang dem Weg, also zwischen dem Weg, der zum Treppenhaus führt und den angepflanzten Büschen, gibt es so eine horizontale rostige Stange, zugegeben, es ist lächerlich, in diesen aussichtslosen, rostig-muffigen Kontext einen Horizont reinzubringen. Hier ein Horizont?! Eine rostige Eisenstange jedenfalls, an welche die Hausbewohner mit Ketten und Schlössern ihre Gasballons anketten, kost ja ’ne Menge Geld so’n Gasballon, jeder Ballon hier, und steht ganz schutzlos da draußen und säuselt dem Dieb sein feines Säuseln zu, ein leises Wispern von Butan, na komm schon, Dieb, psss psssssssss.
Ich war durchs Tor gegangen, und auf dem Weg, schon dicht beim Eingang, blieb ich stehn, den Nachbarn Hallo sagen. Eine Frau mit schlafendem Kind im Tragetuch auf dem Rücken, neben ihr ein viel zu müder Mann. Gleichsam notin tune, nicht geeicht, nicht richtig gestimmt, orchestriert wie ein Chor, auf Hebräisch-Arabisch-Englisch, Zubin Mehta dirigiert mit Körperbewegungen und Gebärden, alle drei sind Flüchtlinge aus Eritrea, sie zeigten mir etwas, was ich, nachdem die Augen sich dran gewöhnt hatten, irgendwann im Dunkel auch sah: Man hatte ihren Gasballon geklaut. Das Schloss, das den Ballon mit einer Kette an der Stange befestigt hatte, aufgebrochen, die gelbe Leitung durchtrennt.
Der Weg war feucht vom Regen, wir redeten im Dunkel ein paar Minuten. Über die Diebe und wie schwer und ungerecht das Leben war, begleitet von kapitulierendem Schulterzucken, Gesten der Resignation, liegt doch alles in der Hand des Himmels und so weiter. Wir waren dermaßen damit beschäftigt, uns dem Urteil zu beugen, vielleicht nicht beschäftigt, das Wort ist zu geschäftig dafür, wir waren einfach so sehr dabei, uns zu fügen, dass ich sie noch nicht einmal gefragt habe, das kam mir erst später, als es natürlich zu spät war, ob sie ihr Essen vielleicht bei mir warmmachen wollen, auf dem Gas. Das war um neun Uhr abends gewesen. Dieser Gedanke keimte oder schlüpfte in meinem schläfrigen Hirn irgendwann später gegen zwei Uhr nachts. Lächerliche Zeit für einen großzügigen Vorschlag. Auch ich bin nicht richtig in tune, nicht geeicht, nicht richtig gestimmt. Immer entweder zu schlaff oder zu gespannt. Eine Stunde später fiel mir ein, dass auch dieser nachträgliche hypothetische Gedanke nichts geändert hätte, mein Ballon war überhaupt leer, ich musste einen neuen bestellen, ich schlief ein. Knackte weg. Beendete diesen Tag. Genug.
Am Morgen, der wie gesagt bereits am Abend zuvor begonnen hatte, rief ich unseren Piraten-Gaslieferant an, dass er meinen Ballon austauscht. Ein Palästinenser aus Hebron, der hier im Viertel wohnt, wenn er gefragt wird, erzählt er meistens, er sei aus Akko, vielleicht, damit er keine Schwierigkeiten kriegt, und vielleicht ist er auch wirklich von dort, er, seine Eltern, seine Großeltern. Binnen zwanzig Minuten war er da, den schweren Ballon in einer grünen Plastikkiste auf dem Gepäckträger seines Fahrrads. Wir schüttelten Hände, Hallo, verloren ein paar Worte übers Wetter, verfluchten den Ministerpräsidenten, einen Anlass gibt es immer, und dann öffnete ich das Schloss, das meinen Gasballon an die rostige Stange kettet, die den Weg entlang führt. Er hievte den vollen Ballon aus der grünen Kiste auf dem Gepäckträger seines Fahrrads und rollte ihn, ein schweres Fass voll Gas, bis dahin, wo mein Gasanschluss war. Er bückte sich, um den neuen Gasballon an die gelbe Leitung anzuschrauben, und dann hob er von der Erde unter einem der Büsche ein großes Messer auf.
Wir schauten einander an. Die gelbe Gasleitung der Nachbarn hing noch da, gekappt, tastete im Nichts wie der verwaiste Mund eines ausgesetzten Babys. Das weggeworfne billige Fahrradschloss lag auch noch da, aufgebrochen. Wir lächelten, beide. Klar, wozu man das Messer gebraucht hatte. Ein gutes Messer, sagte er zu mir. Siehst du, was für ein gutes Messer das ist. Er hat es liegen lassen, der, der das hier gemacht hat, sagte er. Ich trat näher heran, er trat näher heran. Er zeigte mir die Klinge. Siehst du die Schichten, sagte er. Die Stahlschichten? Ich sah sie, wie Baumringe, Spuren vom Schleifen. Ein gutes Messer, sagte er. Ich sagte zu ihm, nimm’s mit, es gehört dir, sagte ich ihm. Nimm’s mit, sagte ich ihm mit einer Großzügigkeit, obwohl es mir gar nicht gehörte. Er hatte es gefunden, nicht ich. Es war nicht an mir, es ihm zu überlassen. Trotzdem hab ich es so gesagt. Weiß nicht warum. Er lächelte. Als verstehe er etwas Verborgenes. Er schloss meinen Gasballon an die gelbe Leitung, und ich bezahlte ihn. Er nahm das Messer und ging.
Ich bückte mich, um meinen neuen, vollen Ballon an die Kette zu legen, an die Stange zu ketten, anzustangen. Ich war mit der rostigen Kette, dem Schloss, dem Schlüssel und der rostigen Stange beschäftigt, sie war das einzig Horizontale hier im Viertel, und ich klapperte so vor mich hin, kurz, als ich ihn hörte, genauer gesagt, als ich jemanden hinter mir hörte, wusste ich nicht, wer da kam. Ich drehte den Kopf, und es war Abu Amran, er kam zurück, das Messer in der Hand. Ich schaute ihn an, mit einem Blick wie: Was ist jetzt passiert? Vergiss es, sagte er zu mir, zu viel Polizei unterwegs. Mit so einem Messer in der Tasche bist du lieber kein Araber auf der Straße, sagte er. Besser, wenn mich niemand mit dem Messer erwischt. Ich lächelte. Bitter. Das war doch lachhaft. Abu Amran, den kenn ich schon seit Jahren. Er radelt im ganzen Süden der Stadt herum, mit seinen Gasballons auf dem Rad, und liefert sie aus. Ein Messer? Lächerlich. Die ganze Stadt könnt er hochjagen, wenn er nur wollte. Er beugte sich zu mir herunter, legte das Messer auf den Weg, nimm du es, sagte er zu mir, ist ein gutes Messer, sagte er, nimm du’s, und ging.
Ich schloss den Ballon ab und ging hoch in die Wohnung. Legte das Messer auf den Küchentisch, wusch mir den Rost von den Händen und ging, zum Amt.
Am Eingang zum Arbeitsamt haben sie ein Aquarium mit einem Fisch aufgestellt. Ein seltsamer rosa Fisch. Schwimmt in dem großen Aquarium aus gepanzertem Glas, ganz einsam, so eine umherirrende Seele. Genau neben den biometrischen Lesegeräten an einem strategischen Punkt des Amtes, jeder Arbeitslose muss zwangsläufig an ihm vorbei, um seinen bereits eingescannten und codierten Finger ins Gerät zu legen. Wenn jemand einmal alle Arbeitslosen unsres Landes in einen großen Zwinger einsammeln will, und der Tag ist nicht fern, denn Arbeitslose sind kein stabiles Kollektiv, sie sind gefährlich, dann ist alles dafür bereit. Die Daten, das Programm, die Polizei, die Zwinger. Es braucht nur noch den Befehl.
Ich stand dort, gegenüber dem Aquarium, betrachtete den merkwürdigen rosa Fisch, wie er da schwamm, so allein. Man sieht beim Arbeitsamt nicht wenige traurige Geschöpfe, dieser Fisch kann gewiss einen der ersten Plätze unter ihnen beanspruchen. Er, dieser rosa Fisch, so stand es auf einem Schildchen geschrieben, das an dem Aquarium klebte, ist nach dem kommerzialisierten Glauben aus irgendeinem Land des Fernen Ostens, hab schon vergessen, was genau da stand, in der Lage, seinen Besitzern wirtschaftliches Gedeih und Erwerb zu bringen. In der Vergangenheit, so stand da geschrieben, pflegte man einen solchen Fisch zu Hause zu halten, doch jetzt verbreitet sich dieser Brauch, und der Fisch wird in Banken gehalten, an Börsen und Investitionsunternehmen gehandelt. Es braucht mehr als nur bittren, im Grunde grausamen Humor, um so einen Fisch vor dieser Schlange im Arbeitsamt aufzustellen. Nichts wird euch retten, Arbeitslose. Haltet euch besser gleich an den schon hundertmal recycelten Glauben, an den rosa Fisch. Eine Frau kam näher und trat an das Aquarium. Berührte die dicke Scheibe, liebkoste, verfolgte mit dem Finger den Fisch, der da langsam, gefangen in seinem Aquarium schwamm. Bitten Sie ihn schon lange um Glück?, fragte ich sie. Schon ein paar Monate, sagte sie. Auskommen und Gesundheit brauch ich, und einen sicheren Ort, wo ich den Kopf hinlegen kann.
Wir verabschiedeten uns, ich wünschte ihr viel Erfolg dabei, stellte mich in die Schlange, durchlief dann die neun Kreise der Kontrolle, alles aus den Taschen raus, Gürtel abnehmen, durchs piepende graue Tor, alle Sachen zurück in die Taschen, den Gürtel wieder anziehn. Aufzug, ich fuhr hoch, zweiter Stock, zum Amt. Schalter 23, sagte der Wachmann am Eingang. Ich betrat das Arbeitsamt, ging tief hinein in den gleißend hellen Neonsaal. Eine Reihe von Schaltern, Beamte in Bürobüchsen, gegenüber jedem Schalter eine Reihe Stühle, arbeitslose Menschen sitzen da, warten, bis sie drankommen, bis sie dran sind. Ich ging mitten durch, durch diesen Neonsaal, zwischen den Wartenden und den Beamten, bis ich den Schalter 23 fand. Auf einem Zettel an einer gläsernen Trennwand trug ich meinen Namen ein und setzte mich dort hin, auf einen Stuhl in der Stuhlreihe, um zu warten. Der Saal länglich, neonerhellt, sagt ich schon, weiße Akustikdecke mit Rauchmeldern gespickt. Ich brachte meine Zeit rum. Schaute mich um. Die müde Frau mit dem kleinen Kind. Der verwitterte Mann. Die verknitterte Frau, die Studentin, die sich abseits hielt. Am Schalter vor mir begann eine Auseinandersetzung zwischen dem Beamten und der, die ihm gegenübersaß. Nachdem alles Gutzureden gescheitert war. Es wurde laut. Das Gegenteil ist der Fall, hörte ich die Stimme des Beamten donnern, zu der Frau ihm gegenüber. Er wies sie zurecht, schalt sie. Das Gegenteil ist der Fall!, schnauzte er. Da verfiel ich in einen langen Schlummer.
Aus ihm erwachte ich, perfektes Timing, wohldressiert, geradezu zirkusreif, kurz bevor ich drankam. Ich stand auf. Ging hin. Setzte mich ihm gegenüber. Hinter ihm an der Wand hängt ein Farbfoto aus einem Lifestyle-Magazin. Auf dem Fensterbrett stehen reihenweise Metall- und Pappkartons, Rollen, dreieckige, viereckige Verpackungen renommierter Whiskyflaschen. Wie Modelle von Wolkenkratzern. Eine Art Skyline von Alkoholcity. Im staubigen Fensterrahmen hinter dem Beamten schwankt draußen der Zweig eines Eukalyptusbaumes im Wind, wie betrunken in einem Strudel von Staub. Name?, fragte er. Den Blick auf dem Bildschirm. Schaute mich gar nicht an. Ich schwieg. Name?, sagte er noch einmal. Den Blick noch immer auf dem Bildschirm. Ich sagte nichts. Nun, wie heißen Sie?! Er hob die Stimme. Schaute mich nicht an. Machte mit der Maus rum. Mit der Tastatur. Den Blick noch auf dem Bildschirm. Tolli Grotesky, sagte ich zu ihm.
Und siehe da, sie funktionierte, die List. Er sah zu mir auf. Wandte den Blick mir zu. Schaute mich an. Es hatte funktioniert. Oho, die Art, wie die Augen vom Bildschirm zum Gesicht wanderten. Oho, die Art, wie sie zurückwanderten vom Gesicht zum Bildschirm. Oho, dieses Pendeln. Wie sehr ich diese Bewegung kannte, diese verfluchte Bewegung. Tolli Grotesky?, fragte er. Tolli Grotesky, sagte ich.
Hinter ihm, draußen, auf der anderen Seite des dicken, schmutzigen Glases, wiegt sich der staubige Eukalyptuszweig müde im Wind, einsam betend. Auf dem Fensterbrett die Skyline von Alkoholcity, hingestreckt wie ein ausgestopftes Tier. Auf dem Farbfoto aus dem Lifestyle-Magazin schaut mir ein hochgewachsener Mann direkt in die Augen, Dreitagebart, der schwarze Anzug maßgeschneidert. Ein Strauß roter Rosen leuchtet in seiner Hand. Hochglanzmäßig. Tolli Grotesky?, fragte der Beamte. Tolli Grotesky, sagte ich. Ausweisnummer?, sagte er. Ich sagte ihm die Nummer. Beruf?, fragte er. Schriftstellerin, sagte ich ihm.
Die Hand auf der Maus hielt inne. Bewegte sich dann weiter. Das Gesicht vertiefte sich noch tiefer in den flachen Bildschirm. So einen Beruf gibt es nicht, murmelte er dort hinein. Als spräche er gar nicht mit mir. Als sagte er das nicht zu mir. Schriftstellerin, das ist kein Beruf, sagte er. Als sei es eine Selbstverständlichkeit.
Ich holte tief Luft. Brauchte eine Zigarette. Dringend. Ich sagte zu ihm, lesen Sie denn keine Bücher? Seine Hand hielt inne. Er ließ die Maus liegen. Wandte den Blick wieder mir zu, weg vom Bildschirm. Ich lese Bücher, sagte er. Ich lese durchaus. Na also, sagte ich. Und jemand schreibt ja diese Bücher, die Sie lesen, nicht wahr? Bestimmt nicht Sie, junge Frau. Tolli Grotesky. Sie bestimmt nicht.
Ich schluckte trocken. Seufzte. Ein flaches, leeres Ausatmen. Vermutlich stimmt das, sagte ich zu ihm. Leider stimmt das vermutlich. Ich bin nicht so eine Bestsellerin. Aber sagen Sie, sagte ich zu ihm, was haben Sie denn in letzter Zeit gelesen?
Er wartete. Verweilte. Ich sah ihn denken. Er schaute mich an. Dachte nach. Überlegte, ob er sich auf dieses Gespräch einlassen wollte. Zu persönlich. Unpassend. Er war kalt wie eine blanke Waffe. Glatt und steil wie ein Abhang. Ich sah, wie er sich entschied zu antworten. Er zählte auf, den und den und den und den. Ich sagte, das sind alles Pseudonyme von mir. Er lachte. Ich atmete auf.
Tolli, sagte er, Tolli Grotesky: Schriftstellerin. Nun gut, in Ordnung. Angenommen, es gibt so etwas. Sagen Sie mal, Tolli, was ist das letzte Buch, das Sie geschrieben haben? Vergessen Sie’s, sagte ich zu ihm, das tut nichts zur Sache. An der grauen Trennwand neben ihm getippte Listen von Telefonnummern, Memos, Zettelchen, Listen von Fortbildungskursen, und auf einem Blatt aus dem Drucker stand: Du möchtest ruhig und gelassen leben? Spare mit Worten. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Vergessen Sie’s, sagte ich zu ihm, ist nicht wichtig. Ich wollte jetzt nicht damit anfangen. Tolli, sagte er. Wenn Sie Schriftstellerin sind, sagte er, und Sie wollen, dass ich hier schreibe, Tolli Grotesky – Schriftstellerin, dann müssen Sie mir zumindest sagen, wie das letzte Buch hieß, das Sie geschrieben haben. Das Gegenteil ist der Fall, sagte ich zu ihm.
Jetzt spielen Sie hier mal nicht die Superschlaue, Tolli, blaffte er mich an. Das Gegenteil ist der Fall, sagte ich zu ihm. Tolli!, donnerte er. Ich schwieg. Das Gegenteil wovon?, fragte er. So hieß das Buch, sagte ich zu ihm. Das letzte Buch, das ich geschrieben habe. Er schaute mich an. In seinen Pupillen Entsetzen.
Sagen Sie, fragte ich ihn, die Verpackungen da hinter Ihnen, von den Whiskyflaschen, sind die vielleicht zufällig voll? Große Hoffnung schwang in meiner Stimme mit. Sehr große Hoffnung. Meine Seele lechzte danach. Nein, sagte er. Leer. Schade, sagte ich zu ihm. Sehr schade. Und wer, sagte ich zu ihm, schluckte meine Missgunst runter und nagelte ihn mit einem schmal zusammengekniffenen Auge fest, wer trinkt den ganzen Whisky, der einmal in diesen Flaschen war, Sie?
Tolli, sagte er. Dieser Name passt ganz gut zu Ihnen. Sagen Sie mir, Tolli, sagte er, Tolli Grotesky – Schriftstellerin, an was für einem Buch arbeiten Sie denn gerade, wenn ich fragen darf?
Ich lächelte. Sagte zu ihm, ich weiß nicht, weiß es wirklich nicht, ich bin noch auf der Suche. Noch am Anfang. Bisher hab ich nur den Titel und einige Seiten vom Anfang. Das ist alles, was ich bisher habe. Ich glaube an writing in progress. Ich fang an zu schreiben und seh, wohin es mich führt. Was sich entwickelt. Im Voraus weiß ich es nicht. Nie. Er schaute mich an. Ich hab’s gesehn. Ihm war die Kraft ausgegangen. Ich hab ihm zu viel rumphilosophiert. Er schaute mich noch eine letzte Sekunde lang an. Steckte den Kopf wieder in den Bildschirm. Begann wieder, mit dem Papierkram rumzumachen, mit dem Papierkram, der da auf seinem Tisch lag. Redete wieder zu ihm, wieder zu dem Bildschirm vor sich, nicht zu mir. Gut, Tolli, sagte er dann, ich danke Ihnen. Auf Wiedersehn, er heftete einige Blätter zusammen, danke, dann sind wir jetzt fertig mit Ihnen.
Ich stand auf, ging, ging raus. Nach Hause. Auf dem Tisch in der Küche lag das große Messer. Stahlklinge, der Holzgriff abgegriffen vom vielen Benutzen, die Geschichte einer Hand. Gewalt. Das machte mir Angst. Ich schaute es an, das Messer, wie ein verfluchtes Erbe. Eine dunkle, unzugängliche Vergangenheit eingeprägt in diese Klinge, eingedrückt in diesen Griff. Plötzlich zu Hause, bei mir. Ungerufen. Ungebeten.
Ich wollte es hier nicht.
Von wegen, wir sind jetzt fertig. Eine Minute noch!
Er schaute mich an. Ein kurzer Blick hinter dem Bildschirm hervor. Von den Papieren, mit denen er raschelte. Bewegungen der Augenlider, nervös wie eine Wespe. Als spritze er die Kugeln seiner Pupillen auf mich. Als werfe er mir einen erregten Blick zu, von irgendeinem Blatt, einem Formular. Von einer Liste. Als glaube er nicht, dass ich noch immer dort vor ihm saß. Ich schaute ihn nicht an. Machte auch nicht den Abflug, wie war es möglich, dass ich nicht längst den Abflug gemacht hatte. Hinter ihm im Fensterrahmen krümmt sich erschöpft der Eukalyptuszweig, zum Himmel. Will noch hoch hinaus.
Die Skyline von Alkoholcity blinkt. Blinzelt blaulichtblau. Eine Minute noch, bat ich ihn, flehte ihn an. Er setzte sich gerade hin, aufrecht, schaute mir in die Augen. Tolli, sagte er, Sie sind noch hier? Unerbittliche Erwartung. Zum Reißen gespannt. Ungeduld. Hören Sie, einen Moment, sagte ich. Ich weiß, was wir machen, sagte ich, ich hab eine Idee. Ich weiß, sagte ich zu ihm. Sie glauben nicht, dass ich Schriftstellerin bin, nicht wahr? Sie sagen zu mir, so einen Beruf gibt es nicht. Kein Problem! Nichts leichter als das. Wir sitzen hier zusammen, sagte ich zu ihm, wir beide, Sie und ich. Ein Stündchen. Bloß ein Stündchen. Und ich erzähle, sagte ich zu ihm. Ich erzähle Ihnen, sagte ich, eine kurze Geschichte. Eine Geschichte, sagte er. Eine kurze, sagte ich zu ihm. Sie erzählen mir eine Geschichte, sagte er. Wiederholte es. Wie ungläubig. Jetzt ging’s mit mir ab, ich war Feuer und Flamme. Schnaufte atemlos, Sie werden es nicht glauben! Erlösung! Rettung! Spannung! Aufregung! Herzschmerz! Selbstentdeckung! Sein geschwungenes Schwert! Ihre aufgerichteten Brüste! Geschichten, sagte ich zu ihm, in denen man Zeit verbringen kann. Ganze Wochen und Tage.
Hinter ihm lächelt von dem Foto aus dem Lifestyle-Magazin an der Wand ein blondes Mädchen, es hält ein weißes Kaninchen. Viel Fell. Erleuchtet im kuschligen Fuchsien-Rosa der untergehenden Sonne.
Hier, bei Ihnen auf dem Amt, fuhr ich fort. Tausendundeine Nacht!, sagte ich zu ihm. Sie sind der König und ich bin Ihre Scheherezade, eine Scheherezade des neoliberalen Zeitalters bin ich für Sie, eine Scheherezade des hyper-individualistischen Zeitalters, ultra-konsumistisch, techno-eskapistisch, psycho-anti-terroristisch, und Sie, Sie sind der King, soll ich Ihnen einen blasen?
Hinter ihm, hinter dem Fensterrahmen draußen bläst der Wind, als versuche er, als versuche er was? Zu schreiben? Auszublasen? Anzufachen? Die Flamme der Welt. Fffhhh.
Tolli, sagte er. Raus. Sie gehen jetzt. Sie verlassen jetzt diesen Ort. Ihre Zeit ist um. Da warten Leute in der Schlange. Nun gehn Sie endlich.
Ich schaute ihm geradewegs in die Augen, spielte die Mutige. Ich hörte einmal, sprach ich zu ihm, hochverehrter, einflussreicher König, ich hörte einmal, höchstglücklicher König, sprach ich zu ihm, dass einst in Eurem großen, guten Königreich eine Frau lebte. Eine Frau, großmächtiger König. Und diese Frau war arm. Und bejahrt. Also in die Jahre gekommen. Alt eben. Diese arme, bejahrte Frau aber musste ganz allein für ihr Auskommen sorgen.
Und diese Frau, großmächtiger König, fuhr ich fort, ich durfte ja keine Zeit verlieren, diese Frau, großmächtiger König, sprach ich zu ihm, pflegte jeden Tag ihr Haus zu verlassen und hinauszugehen auf die Straßen der Stadt. Jeden Morgen zog sie aus, mit einem Einkaufswagen aus dem Supermarkt, und verbrachte den ganzen Tag mit dem Durchstöbern von Mülltonnen. Sie schob ihren Wagen durch die Straßen und sammelte in ihm leere Flaschen, alte Kleider, kaputte Elektrogeräte, angeschlagene Teller, die bot sie dann auf einer Decke feil, die sie auf dem Gehweg ausbreitete. Und die Flaschen gab sie im Supermarkt gegen Pfand zurück. Sie stellte sich in die Schlange am Eingang zum Supermarkt, zu den anderen Armen Eurer Stadt, großmächtiger König, und jedes Mal, wenn die automatische Tür neben ihnen aufging, blies die Klimaanlage des Supermarktes Abrakadabra kalt-klimatisierte Luft hinaus in ihre Gesichter.
Und so zog, großmächtiger König, an dem Tag, an dem sich unsere Geschichte ereignete, wie an jedem anderen Tage auch, die arme bejahrte Heldin unserer Geschichte durch die Straßen, in den Mülltonnen zu kramen und zu sammeln. Sie stellte den Einkaufswagen neben die erste grüne Mülltonne, die sie sah, hob den grünen Plastikdeckel, hochverehrter König, und holte aus den vollen Müllbeuteln, aus denen die Säfte der Abfälle tropften, drei leere Flaschen Carlsberg und ein altes Sweatshirt von einer Oberstufenfahrt zu den Vernichtungslagern in Polen. Die Frau legte Flaschen und Sweatshirt in ihren Wagen und zog ihrer Wege.
So zog die müde Frau weiter zur nächsten Mülltonne, großmächtiger König, riss deren grünen Rachen weit auf, schob feuchte Müllsäcke zur Seite und förderte zwei leere Weinflaschen zutage, einen alten Toaster und ein paar zerrissene Schuhe. Das Gefundene legte sie in ihren Wagen und zog ihrer Wege.
Die arme und gute Frau ging weiter auf der Straße bis zur nächsten Mülltonne. Sie stellte ihren Einkaufswagen neben der Mülltonne ab, öffnete sie, hochverehrter König, und kramte aus ihrem Innern ein Nokia-Ladegerät hervor, ein feuchtes, zerknittertes Wörterbuch Hebräisch-Arabisch, einen zerrissenen Lampenschirm, und siehe da, zu ihrer Überraschung, während sie noch so kramte, zog sie aus dem Innern der Mülltonne auch eine volle Flasche Champagner.
Unsinn, sagte der mir gegenüber saß, wer wirft denn Champagner in den Müll.