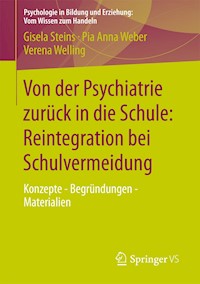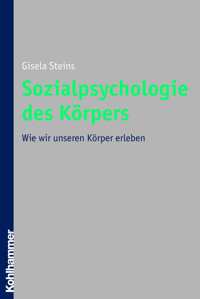
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wir unseren Körper erleben, bestimmt, wie wir uns in unserer sozialen Welt bewegen. So muss es alarmieren, dass viele Frauen und Männer mit ihrem Körper unzufrieden sind. Wie kommt es dazu? Diese Frage wird in diesem Band umfassend beantwortet, indem die Einflüsse unseres Alltags und unserer Kultur auf das Körpererleben aufgedeckt und diskutiert werden. Die Autorin beschreibt auch, wie gegen pathologische Formen von Körperunzufriedenheit und -modifikationen präventiv vorgegangen werden kann. Dabei wird der Bereich "Körper und Schule" vertieft behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie wir unseren Körper erleben, bestimmt, wie wir uns in unserer sozialen Welt bewegen. So muss es alarmieren, dass viele Frauen und Männer mit ihrem Körper unzufrieden sind. Wie kommt es dazu? Diese Frage wird in diesem Band umfassend beantwortet, indem die Einflüsse unseres Alltags und unserer Kultur auf das Körpererleben aufgedeckt und diskutiert werden. Die Autorin beschreibt auch, wie gegen pathologische Formen von Körperunzufriedenheit und -modifikationen präventiv vorgegangen werden kann. Dabei wird der Bereich 'Körper und Schule' vertieft behandelt.
Prof. Dr. Gisela Steins lehrt Allgemeine und Sozialpsychologie am Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
Gisela Steins
unter Mitarbeit von Julia Smaxwil
Sozialpsychologie des Körpers
Wie wir unseren Körper erleben
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2007 Alle Rechte vorbehalten © 2007 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN: 978-3-17-019661-2
E-Book-Formate
epub:
978-3-17-028080-9
mobi:
„Was ist denn eigentlich eine schlechte Figur? Das ist eine Figur, die bis in die einzelnen Glieder ängstlich ist.“
Widmungen
„Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken.“
Johann Wolfgang von Goethe
Für die, die stets an mich glauben, mich unterstützen und mir dies überhaupt ermöglicht haben: Für meine Mutter, für Klaus und Christel Müller, meinen Ruhepol Martin Lukas und Gisela Steins.
Bottrop, im Frühjahr 2007
Julia Smaxwil
Für meinen Vater Hermann Steins
Essen, im Frühjahr 2007
Gisela Steins
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1 Vorüberlegungen
1.1 Vorgehensweise
2 Begriffe rund um die Körperforschung
3 Das Selbstkonzept und unser Körper
3.1 Die Selbstdiskrepanztheorie
4 Das Konzept vom eigenen Körper
4.1 Die Entwicklung des Körperselbst
4.2 Körperkonzept und Bindungstheorie: Das Skizzieren eines Zusammenhangs
5 Zusammenfassung und Fazit
5.1 Fragen und Übungen
5.1.1 Fragen
5.1.2 Übungen
Teil I: Phänomene rund um das Körperbild
6 Körperunzufriedenheit
6.1 Zur Messung von Körperunzufriedenheit
6.2 Wer ist unzufrieden mit seinem Körper?
6.3 Womit hängt Körperunzufriedenheit zusammen?
6.4 Zusammenfassung und Fazit
6.4.1 Fragen und Übungen
7 Körpermodifikationen
7.1 Moden
7.2 Make-up
7.3 Diäten
7.4 Sport
7.5 Piercing
7.6 Operationen
7.7 Irreversible Modifikationen
7.8 Zusammenfassung und Fazit
7.8.1 Fragen und Übungen
8 Psychopathologie
8.1 Essstörungen
8.1.1 Bulimie und Anorexia nervosa
8.1.2 Adipositas
8.1.3 Der Adoniskomplex
8.2 Zusammenfassung und Fazit
8.2.1 Fragen und Übungen
Teil II: Kräfte auf den Körper
9 Biologische Kräfte
9.1 Individuelle Dispositionen
9.2 Die Zeit
9.3 Die existentielle Paradoxie
9.4 Die Terror-Management-Theorie
9.5 Zusammenfassung und Fazit
9.5.1 Fragen und Übungen
10 Soziokulturelle Kräfte
10.1 Rahmenbedingungen unserer Kultur
10.2 Kulturelle Standards an den Körper
10.2.1 Körper-Geist-Analogien
10.2.2 Standards an Schönheit
10.2.3 Standards an Geschlechtsspezifität
10.3 Übermittlung von Standards an physische Attraktivität
10.3.1 Effekte von Attraktivitätsstandards
10.3.2 Die Rolle von Familie und Peers
10.4 Zusammenfassung und Fazit
10.4.1 Fragen und Übungen
11 Individuelle Kräfte
11.1 Soziale Motivation
11.2 Zugehörigkeit über soziale Anerkennung
11.2.1 Soziale Erwünschtheit und Soziozentrismus
11.2.2 Soziale Anerkennung über die Erfüllung der Standards an Körper
11.2.3 Soziale Anerkennung durch die Erfüllung sozioemotionaler Bedürfnisse und aufgabenorientierter Bedürfnisse anderer
11.3 Woher kommt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung?
11.3.1 Elterlicher Erziehungsstil
11.3.2 Die Selbstaufmerksamkeitstheorie
11.4 Zusammenfassung und Fazit
11.4.1 Fragen und Übungen
Teil III: Schlussfolgerungen
12 Sozialpsychologie des Körpers
13 Implikationen für Interventionen und Präventionen
13.1 Interventionen: Eine Auswahl
13.1.1 Sport als Intervention
13.1.2 Selbstakzeptanz und Selbstbewusstsein als Intervention
13.1.3 Medienkompetenz als Intervention
13.2 Implikationen für Präventionen
13.2.1 Erziehung zur Selbstakzeptanz
13.2.2 Information als Prävention
13.2.3 Veränderte Medien als Prävention
13.2.4 Eine veränderte Kultur als Prävention
13.3 Zusammenfassung und Fazit
13.3.1 Fragen und Übungen
14 Körper und SchuleJulia Smaxwil
14.1 Es beginnt schon bei den Kleinen
14.2 Stars und Sternchen als Vorbilder
14.3 Schule als Disziplinierungsort
14.3.1 Veränderungen dank der Reformpädagogik
14.4 Prestigegewinn über den eigenen Körper
14.4.1 Gruppenzugehörigkeit durch Sport
14.4.2 Der Druck, „schön zu sein“
14.5 Körperliche Entwicklung in der Schulzeit
14.5.1 Neue Körper unerwünscht
14.5.2 Der Wackelgang
14.5.3 Innerliche Veränderungen
14.6 Schulische Gesundheitsförderung
14.6.1 Magersucht macht auch vor Schule nicht halt
14.6.2 Schwinden des Selbstwertgefühls
14.6.3 Kontrolle
14.6.4 Magersucht (Anorexia nervosa)
14.6.5 Auch Jungen haben Essstörungen
14.6.6 Der Adoniskomplex bei Jungen
14.6.7 Adipositas
14.7 Präventionsmaßnahmen auch in der Schule
14.7.1 Unterstützende Medien im Unterricht
14.7.2 Verschulte Körper
14.7.3 Alltag und Bewegungskultur in der Schule
14.8 Bewegte Schule oder die Vorantreibung von Unterrichts- und Schulentwicklung
14.8.1 Die Wichtigkeit von Unterrichtsmethoden (handlungsorientierter Unterricht)
14.8.2 Effektives Lernen durch Aktivität vs. altbekannte Belehrungskultur
14.9 Fazit
15 Zusammenfassung
Weiterführende Lektüre
Literatur
Stichwortverzeichnis
Einführung
Unser Körper blüht und gedeiht, verfällt und stirbt, wenn alles seinen natürlichen Gang geht. Wenn Sie sich also mit dem Körper und seiner Sozialpsychologie beschäftigen möchten, dann wird es nicht immer um Themen gehen, die Ihre Stimmung heben oder Ihnen wirklich gute Laune machen. Die Beschäftigung mit unserem Körper ist eine ambivalente Angelegenheit. Trotzdem müssen wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir einige wichtige Dinge in unserem Leben besser verstehen möchten. Deshalb haben Sie sich vielleicht entschlossen, das Folgende zu lesen.
Sollten Sie bei der Lektüre einiger der folgenden Kapitel merken, dass Ihre Stimmung sinkt und Sie vielleicht sogar in Depressionen verfallen, seien Sie versichert, es liegt am Thema! Das Thema Körper birgt so viele unschöne, auch unverständliche Aspekte, mit denen Sie sich vermutlich auch alltäglich herumschlagen müssen, dass es eine normale Reaktion ist, dass man sich danach mitunter unsicher, niedergeschlagen und vielleicht auch manchmal ratlos fühlt. Da es sich um eine Sozialpsychologie des Körpers handelt, wird es noch nicht einmal einige erhellende Kapitel geben, in denen Sie über schöne einfache Übungen informiert werden, mit denen Sie sich jung, schlank und schön bis an Ihr Lebensende halten können. Nein, vielleicht kommen Sie bei der ein oder anderen sozialpsychologischen Theorie, die auf unseren Körper bezogen wird, sogar so richtig schlecht drauf.
Vielleicht planen Sie, sich neben dieser Lektüre auch noch Gegenlektüre zu besorgen wie „Schlank und rank in einem Tag“ oder „Schlank durch essen“ oder „Aussehen mit 65 wie 34“ oder „Wie ich ewig leben kann“ und Sie denken, falls Sie die folgenden Überlegungen gar zu unerträglich finden, können Sie ja jederzeit wechseln und sich aufheitern bei: „Sich akzeptieren wie man wirklich ist“. Sollten Sie dieses planen, machen Sie bitte eines nicht: Kaufen Sie sich keine Schönheitsmagazine! Und wenn Sie es irgendwie aushalten, auch nicht eines der anderen gut gemeinten Ratgeberbücher zur Wiederherstellung und Erhalt von Schönheit, Jugend und ewigem Leben. Aber auf keinen Fall Schönheitsmagazine! Im Laufe der Lektüre werden Sie verstehen, warum. Sollten Sie all diese gut gemeinten Ratschläge unterlassen, behaupten Sie später bitte nicht, Sie seien nicht gewarnt worden!
1 Vorüberlegungen
Mit unserem Körper haben wir ein Leben lang zu tun. Mit ihm materialisieren wir unsere Person und nehmen unseren Platz in der Welt ein. Wir bewegen uns mit ihm durch Raum und Zeit. Mit unserem Körper sammeln und speichern wir Erfahrungen. Er ist der Ort, an dem wir notwendigerweise sind, solange wir leben.
Obwohl unser Körper uns begleitet, ist er uns nicht immer vertraut. Er kann sich auf eine Art und Weise entwickeln, die uns missfällt. Er kann in einem Maße unserem Innenleben widersprechen, dass wir seine Erscheinung akzeptieren lernen müssen. Wir können erstaunt sein, dass unser Aussehen andere Botschaften vermittelt als wir zu senden beabsichtigen. Wir können in uns selbst verliebt sein, weil unser Körper so gut geraten, aber wir können ihn auch hassen, weil er so missraten ist. Der Satz „Langes Vertrautsein macht uns zuletzt das Böse und das Gute gleich lieb“ von Seneca trifft nicht notwendigerweise auf unseren Umgang mit unserem Körper zu, denn unser Körper verändert sich oft anders, als wir es gerne hätten.
Gleichgültig, ob wir mit unserem Körper gut oder schlecht auskommen, ein Minimum an Aufmerksamkeit verlangt er uns ab. Wir müssen seinen biologischen Bedürfnissen wie atmen, trinken, essen, schlafen und sozialen Bindungen nachkommen, um ihn zu erhalten. Gleichgültig wie wir zu unserem Körper stehen, er ist unser Medium. Damit ist unser Körper das soziale Symbol schlechthin, durch das wir in Beziehung zur Welt stehen. Wir kommunizieren mit anderen Menschen durch unseren Körper. Die Darstellung des Körpers verrät vermeintlich einiges über uns und die Menschen um uns herum. Wir meinen Rückschlüsse über den Status, die Persönlichkeit und andere Merkmale einer Person ziehen zu können, je nachdem wie wir deren körperliche Präsenz wahrnehmen.
Auf einer weiteren Ebene mag der Umgang mit dem Körper die Werte von Gruppen offen legen. Welche Werte eine Gesellschaft für ihre Individuen bereithält, bestimmt ihren kulturellen Umgang mit Leben und Tod. Können wir „wie ein Fisch im Wasser“ in unserem Land leben oder müssen wir ständig „auf der Hut“ sein, „neben uns stehen“, wenn es um die Gestaltung unseres Alltags geht?
Körper ist am deutlichsten als bedeutsame Größe unseres Lebens in unserem Gesundheitssystem verankert. Dort ist der Bereich, mit dem Körper häufig in Verbindung gebracht wird: Mit dem Bereich des fließenden Übergangs zwischen Gesundheit und Krankheit, Wellness und Fitness, Vorsorge und Behandlung. Wie für unsere Psyche die Psychologie zuständig ist, so ist es für unseren Körper der medizinische Versorgungsapparat.
Unser Körper ist jedoch mit allen Bereichen unseres Lebens verbunden. Unser kultureller Kontext bestimmt unser Körpererleben als eine bestimmende Kraft bis in die privatesten Lebensbereiche hinein. Eigentlich ist die Identität von Personen nicht gleich der Identität von Körpern (vgl. Williams, 1973), aber in den nachfolgenden Ausführungen wird deutlich, dass viele Personen hier eine unzulässige Gleichsetzung von Person und Körper vornehmen.
Es ist die Absicht dieses Buches, die Komplexität des Themas darzustellen und anzuregen, unseren Körper aus der Perspektive sozialpsychologischer Prinzipien zu betrachten. So erfahren wir interessante Zusammenhänge, die unseren Alltag prägen. Diese Zusammenhänge sind vielen Menschen nicht unbekannt, sie werden aber selten formuliert und können deshalb nicht in unser Bewusstsein rücken. Formulieren wir sie und beschäftigen wir uns mit ihnen, dann lernen wir sie angemessen zu bewerten und mit ihnen umzugehen. In dem Ausmaß, indem wir eine differenzierte Perspektive auf das Kräftefeld einnehmen können, das mit unserem Körpererleben zusammenhängt, können wir aktiver unseren Körper erfahren. Damit können wir ihn gezielter einsetzen um das auszudrücken, was wir mit ihm ausdrücken wollen. So lautet die grundlegende These des Buches:
Mehr Wissen um die auf unseren Körper wirkenden Kräfte und ein konstruktiver Einsatz dieses Wissens führen zu einer gelassenen physischen Präsenz und einer selbstbewussten reflektierten Einnahme des Platzes in der Welt, den wir beanspruchen möchten.
1.1 Vorgehensweise
Die Einführung in das Thema beginnt mit einer Begriffsklärung. Diese ist notwendig, damit die Vielfalt der Begriffe rund um die Körperforschung besser eingeordnet werden kann. Auch wird in der Einführung thematisiert, inwieweit unser Konzept von unserem Körper ein Teil unseres Selbstkonzeptes ist und vor allem, wie dieses sich entwickelt. Hier ist eine bindungstheoretische Perspektive interessant, weil wir mit ihr genauer verstehen können, dass unser Körpererleben untrennbar mit unserem sozialen Umfeld verbunden ist.
In diesem Buch wird in der Hauptsache eine sozialpsychologische Perspektive auf das Phänomen des Körpers und dessen Erleben eingenommen. Viele andere Perspektiven sind genauso interessant und erhellend, werden aber hier vernachlässigt. Es handelt sich hier also um eine mögliche Perspektive unter vielen anderen.
Nachdem die Grundkenntnisse zum Körperbild und Körpererleben ausgeführt sind, beginnt der erste Teil der Ausführungen zum Thema „Phänomene rund um das Körperbild“. Dieser erste Teil ist, wie die Überschrift ankündigt, phänomenologisch. Körpererleben wird theoriefrei betrachtet. Wenn wir uns die Frage stellen, welche großen Themen wir in der Forschung entdecken können, die mit Körpererleben zu tun haben, stoßen wir auf mindestens drei Bereiche: Die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, die verschiedenen Maßnahmen der Körpermodifikationen und psychopathologische Phänomene, die sich besonders an unserem Umgang mit Körper manifestieren. Diese Phänomene werden detailliert beschrieben und es werden internationale Forschungsergebnisse hierzu zusammengetragen.
Daraus ergibt sich der zweite Teil des Buches, „Kräfte auf den Körper“. Die in Teil I dargestellten Phänomene werfen zahlreiche Fragen auf, vor allem die Frage, warum es diese Phänomene überhaupt gibt und wie sie zu erklären sind. Drei Einflussgrößen, als Kräfte bezeichnet, werden in Teil II näher ausgeführt:
Die biologischen Determinanten unseres Körpererlebens,
die soziokulturellen Kräfte und
die individuellen Kräfte.
Die Beschreibung dieser Kraftfelder birgt eine Fülle relevanter Theorien in sich, mit denen Körpererleben in seiner Vielfalt besser verstanden werden kann.
In Teil III werden die Theorien zu den Phänomenen rund um den Körper in eine Sozialpsychologie des Körpers integriert. Aus diesem Modell lassen sich Implikationen für aktuelle Interventionen und Präventionen ziehen. Diese werden ebenfalls ausgeführt. Auch sind die Überlegungen dieses Buches ein spannendes Anwendungsfeld für den Schulalltag. Julia Smaxwil hat eine Reihe interessanter Transfermöglichkeiten der hier dargestellten Inhalte für den Kontext Schule zusammengetragen. Eine Zusammenfassung als letztes Kapitel führt uns in eine mögliche Zukunft des Körpererlebens.
Die Ausführungen in diesem Buch werden durch eigene Befunde illustriert. Diese Befunde wurden durch Befragungen von Lehramtsstudierenden gewonnen: 20 Männer und 78 Frauen zwischen 20 und 34 Jahre alt, also durchschnittlich 23,62 Jahre, wurden regelmäßig über einen Zeitraum von vier Monaten zu allen möglichen Aspekten ihres Körpers befragt. Die hier dargestellten Ergebnisse sind sicherlich aufgrund der nicht repräsentativen Stichprobe lediglich als Illustration bereits publizierter Forschung auf der Basis größerer und repräsentativerer Stichproben zu interpretieren. Dennoch ist es erstaunlich – um den Ergebnissen zusammenfassend vorzugreifen – dass, obwohl die sich über vier Monate hinziehende Befragung vielen Störfaktoren und Einschränkungen ausgesetzt war, in einer solch kleinen und selektiven Stichprobe viele der Zusammenhänge zu finden sind, welche wir aus der vielfältigen Forschung zu diesem interessanten Bereich zusammentragen können.
Dadurch wird eine wichtige Erkenntnis dieser Forschung deutlich: Es ist wichtig zu lernen und ein essentieller Bestandteil von allen Erziehungs- und Sozialisationsprozessen, für sich selbst die Sorge zu tragen, zu sich selbst ein positives und kritisches Grundgefühl zugleich zu entwickeln, welches Selbstkonzept und Körperkonzept als untrennbare Aspekte einer Person mit einschließt.
2 Begriffe rund um die Körperforschung
Die Art und Weise, wie wir unseren Körper erleben wird in der psychologischen Forschung rund um den Körper durch unterschiedliche Begriffe zu beschreiben versucht. Es kristallisieren sich zwei hauptsächliche Forschungsfelder heraus, die jeweils unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden, nämlich Körperbild und Körperschema. Zentral für die hier aufgeführten Betrachtungen ist das Konzept des Körperbilds, also die Art und Weise wie wir uns mit unserem Körper fühlen.
Körperbild
Die Forschung zum Begriff des Körperbilds bezieht sich nach Nutzinger und Slunecko (1991) auf die emotionale Ebene der Körpererfahrung. Die Autoren verstehen die Forschung hierzu als persönlichkeitspsychologisch. Die subjektive Einordnung und Bewertung der Körpererfahrungen und die mit dem Körper verbundenen Einstellungen stehen im Mittelpunkt des Interesses. Diese werden wiederum durch soziokulturell vermittelte Erfahrungen beeinflusst, so dass Körpererfahrung aus dieser Perspektive heraus eine konstruktive Leistung der Persönlichkeit darstellt. Schilder (1935, S. 11) definiert Körperbild folgendermaßen:
„The image of the human body means the picture of our own body which we form in our mind, that is to say the way in which the body appears to ourselves.“
Oder wie Krueger es 2002 formuliert:
„… is the cumulative set of images, fantasies, and meanings about the body and its parts and functions; it is an integral component of self-image and the basis of selfrepresentation“ (S. 31).
Körperschema
Die perzeptive Ebene, Struktur und Prozess, wird durch diesen Begriff zu erfassen versucht (Nutzinger & Slunecko, 1991). Die Forschung zum Körperschema ist somit eine eher neuropsychologisch orientierte (Nutzinger & Slunecko, 1991), im weitesten Sinne, wahrnehmungspsychologische Forschung.
Body self
„… refers to a combination of the psychic experience of body sensation, body functioning, and body image. Thus body image is the dynamically and developmentally evolving mental representation of the body self“ (Krueger, 2002, S. 30).
Demnach stellt das Körperbild einen Aspekt des sogenannten Körperselbst dar. Das Körperselbst wiederum ist ein Aspekt des Selbstkonzepts einer Person und entwickelt sich ein Leben lang.
Weitere Begriffe
Den Begriffen „Körperbild“ und „Körperschema“ können nun weitere Konzepte zugeordnet werden. So beschreibt der Begriff „Körper-Ich“ die Art und Weise, sich zu fühlen, den eigenen Körper wahrzunehmen (Galli, 1997, S. 18) und stellt damit eine Variante des Begriffs „Körperbild“ dar. Dem Körper-Ich stellt Galli die Bezeichnung Körper-Organismus gegenüber. Damit ist die eher anatomische Betrachtungsweise des Körpers gemeint. Die Forschungsinhalte, die mit diesem Begriff gemeint sind, überlappen teilweise diejenigen zum Körperschema, umfassen aber noch weitere, humanbiologische Fragestellungen.
Mit „Konzept vom eigenen Körper“ ist ein subjektiv interpretiertes Abbild körperlicher und auf den Körper bezogener Gegebenheiten gemeint. Die Funktion dieses Konzeptes liegt in der Bewältigung der Realität und der Stabilisation des Selbst. Dieser Begriff umfasst eher Aspekte des Körperbilds, denn es geht um die subjektive Repräsentation selbstkonzeptrelevanter Körperaspekte. Die Forschungsdisziplin, die hinter diesem Begriff steht, ist mehr sozialpsychologisch als persönlichkeitstheoretisch geprägt. Eng mit dieser Sichtweise verbunden ist der Begriff der „Körpererfahrung“. Damit ist nach Paulus (1982, S. 1) gemeint:
„… wie Individuen ihren eigenen Körper erleben, welche Beziehung sie zu ihm haben, wie sie mit ihm umgehen. (…) sowohl die unmittelbar konkrete, singuläre Erfahrung, wie auch die Organisation vieler einzelner Erfahrungen, die den Moment überdauern.“
Paulus sieht Körpererfahrung als einen integralen Bestandteil einer Theorie über die eigene Person an (S. 75). Auch hier klingt wieder die Verbindung zur Selbstkonzeptforschung, somit zur Sozialpsychologie, an.
In der Forschungsliteratur werden je nach fachlichem Hintergrund diese Begriffe verwendet. Es wird deutlich, dass damit nicht immer notwendigerweise unterschiedliche Inhalte gemeint sind.
Wir selbst verbinden mit dem Begriff „Körper“ sicherlich ganz andere Begriffe und Definitionen. So zeigt sich in Tabelle 2.1 das Ergebnis des ersten Begriffs, den die befragten Studierenden mit „Körper“ assoziieren.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der äußere Eindruck mit 17,2 % der gesamten Nennungen die häufigste Assoziation mit dem Begriff „Körper“ ist. Auch die Bewertung dieses Aussehens scheint bei vielen ein wichtiger Aspekt zu sein. Aber auch einzelne Körperteile und Eigenschaften des Körpers, Tätigkeiten, die man mit dem Körper machen kann und psychologische Assoziationen werden genannt. Die Unterschiedlichkeit der Begriffe zeigt, wie verwoben unser Körper mit unserem Leben und vor allem mit uns selbst ist. Allerdings, und das wird insbesondere Thema des ersten Teils sein, wird auch deutlich, dass unser Körper im sozialen Kontext eine wichtige Größe darstellt. Kaum anders ist der Schwerpunkt der Nennungen auf Aspekten wie Aussehen und Bewertung zu erklären.
Tab. 2.1: Was wird mit Körper assoziiert?
Begriff
Unterbegriffe
% der Männer
% der Frauen
Gesamt in %
Aussehen
Figur, Äußerlichkeiten, äußeres Erscheinungsbild, Eindruck, Aushängeschild, Kleidung
3
14,2
17,2
Körperteile
Arme, Glieder, Haut, Kopf, Beine, Muskeln, Organe, Schweiß
4
10
14
Psychologische Assoziationen
Selbstbewusstsein, innerer Körper, Körper und Geist, Körperbild, Körperkult, Körpergefühl, Körperzufriedenheit, Lebensgefühl, Selbstkonzept
1
11
12
Eigenschaften
Fest, fett, dick, klein, schön, hässlich, weiblich, geometrisch, Quader, mathematisch
4
7
11
Bewertung
Ästhetik, Schönheitsideal, Attraktivität, Schönheit
1
7
8
Tätigkeiten
Bewegung, Ausdrucksmöglichkeit, Sexualität, Sport
1
6
7
Anderes
Schwieriges Thema, Gleichgewicht, Lebewesen, Lehrkörper, Leonardo da Vinci, Medien, Unterschiedlichkeit
1
6
7
Biologische Aspekte
Biologie, Vergänglichkeit, Materie
2
3
5
Ich
Eigener Körper
0
3
3
3 Das Selbstkonzept und unser Körper
Wir nehmen nicht nur andere Menschen wahr und machen uns von ihnen ein Bild, sondern sind als reflektierende Wesen in der Lage, uns auch von uns selbst ein Bild zu machen. Wir können uns selbst in den verschiedensten Situationen beobachten und bewerten und entwickeln über die Zeit und durch die Summe der Erfahrungen und Rückmeldungen aus unserer sozialen Umwelt ein Konzept von uns selbst.
Das Erleben des eigenen Körpers wird von einigen Autoren als ein integraler Bestandteil dieses Selbstkonzepts angesehen. So gehören nach Rosenberg (1986) unsere physischen Charakteristika zu unserem äußeren Selbst, aber auch unsere soziale Identität und unsere Dispositionen. Es kommt auf unseren Entwicklungsstand an, wie wir dieses äußere Selbst nach außen hin darstellen. Werden Kinder danach gefragt, wer sie selbst sind, dann nennen sie überwiegend körperliche Merkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße und -gewicht oder Körperstärke (Livesley & Bromley, 1973). Dieses Erleben des Selbst über eine körperliche Dimension tritt zugunsten einer psychologischen Definition und Darstellung immer mehr in den Hintergrund. Am Ende dieser Entwicklung denken wir, nur noch wir selbst wissen, wer wir wirklich sind: Wir sind Experten unserer selbst geworden. Der Körper als soziales Medium und damit für alle sichtbar und zuzuordnen verliert für unsere Selbstdarstellung an Bedeutung.
Aber gilt dies auch für unsere Selbstdefinition, für das Erleben von uns selbst? Welche Rolle spielt hier der Körper über eine menschliche Biographie hinweg?
3.1 Die Selbstdiskrepanztheorie
Wenden wir uns einem Modell des Selbst von Higgins zu (1987; s. Kasten 3.1), dann wird deutlich, dass unser Selbstkonzept nicht einfach eindimensional zu betrachten ist. Es wird am besten als ein Bündel von Perspektiven auf uns selbst beschrieben. Das Ergebnis kann dann je nach Perspektive und Thema des Selbstkonzepts sehr unterschiedlich aussehen. Wie aus der tabellarischen Darstellung der Annahmen zum Selbstkonzept von Higgins zu entnehmen ist (Kasten 3.1), können zwei grundsätzlich verschiedene Standpunkte zum Selbstkonzept eingenommen werden:
Wir können uns selbst betrachten oder
wir können uns „durch die Augen einer anderen Person“ sehen wie innerhalb des symbolischen Interaktionismus formuliert (Mead, 1934), also uns so sehen, wie andere uns vermutlich wahrnehmen.
Damit aber nicht genug: Je nach den Kriterien, die wir selbst oder andere Personen an bestimmte Seiten von uns stellen, kommen wir zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. So unterscheidet Higgins tatsächliches Selbst, ideales Selbst und gefordertes Selbst. Je nachdem ob wir uns unter dem Aspekt der Realität, des Wunschdenkens oder der Anforderungen – jeweils unserer eigenen oder den vermeintlichen der anderen Personen – betrachten, können wir negative oder positive Diskrepanzen erleben. Wir können in einem bestimmten Bereich genau so sein wie wir das gerne hätten, aber es ist dann vielleicht nicht so, wie eine andere Person das gerne hätte.
Auch umgekehrt: Wir entsprechen sowohl unseren eigenen Wünschen wie den Wünschen einer anderen Person, aber eigentlich verstößt unser Verhalten gegen die Forderungen, die wir von einer anderen Person gestellt bekommen. Da unser Selbstkonzept nach dieser Auffassung eine derartige Perspektivenvielfalt enthält, ist es schwierig, in einem Bereich keine Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Standards zu erleben und wir müssen lernen, „dass man es nicht allen recht machen kann“. Dies ist ein schwieriger Lernprozess. So nimmt Higgins im Rahmen seiner Selbstdiskrepanztheorie auch an, dass jede Art der Selbstdiskrepanz für Menschen unangenehm ist. Je größer die Diskrepanz zwischen Real- und Idealbild, zwischen Ist und Sollen und Ist und Wollen, als desto unangenehmer wird dies empfunden. Deshalb neigen wir dazu, Diskrepanzen jeder Art zu reduzieren. Besonders das Auseinanderklaffen zwischen eigenem Anspruch und den geforderten Standards wird als unangenehm erlebt. Hier sind wir besonders motiviert, die Diskrepanzen zu reduzieren.
Unser Körperbild, das Konzept von unserem Körper, kann in seiner Komplexität nur nachvollzogen werden, wenn wir es als Bündel von Perspektiven betrachten. Wollen wir also Körpererleben verstehen, müssen wir eine Vielzahl von Perspektiven genauer untersuchen, die für ein Individuum relevant sind.
Kasten 3.1: Das Selbstkonzept als ein Bündel von Perspektiven nach Higgins (1987)
Selbstbilder
Tatsächliches Selbst Wie man ist
Ideales Selbst
Wie man sein möchte
Gefordertes Selbst
Wie man sein sollte
Standpunkt:
SelbstwahrnehmungTatsächlich/Selbst
Wie man sich selbst sieht.
Ideal/Selbst
wie man selbst sein möchte
Gefordert/Selbst
Wie man nach den eigenen Ansprüchen sein sollte.
FremdwahrnehmungTatsächlich/Fremd
Wie man glaubt, von anderen Personen wahrgenommen zu werden.
Ideal/Fremd
Wie andere Menschen vermeintlich möchten, dass man ist.
Gefordert/Fremd
Wie man nach den Ansprüchen anderer Menschen sein sollte.
Bezug zum Selbskonzept
Eigentliches Selbstkonzept
Standards oder Leitbilder
Standards oder Leitbilder
Hypothesen:
MotivationshypothesenSelbstdisrepanzen jeder Art sind unangenehm.Man ist bestrebt, Diskrepanzen zu reduzieren, vor allem zwischen eigentlichem Selbstkonzept und Standards.Informationsbezogene HypothesenJe größer das Ausmaß einer Selbstdiskrepanz ist, desto unangenehmer sind ihre Folgen.Je größer die Zugänglichkeit einer Selbstdiskrepanz ist, desto mehr wird man darunter leiden.Dieser Punkt kann an einem weiteren Ergebnis aus der Befragung der Studierenden verdeutlicht werden. Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen in unterschiedlichen Situationen. Eine Beispielfrage lautet: „Wie zufrieden sind Sie durchschnittlich mit Ihrer äußeren Erscheinung, wenn Sie alleine sind?“ Maximale Zufriedenheit konnte durch 100 %, maximale Unzufriedenheit durch 0 % angegeben werden.
Wie aus Abbildung 3.1 hervorgeht, sind die Befragten am zufriedensten, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind, aber am unzufriedensten, wenn sie im Schwimmbad sind oder sich nackt in einem Spiegel anschauen. Interessanterweise erreicht selbst der höchste Zufriedenheitswert nicht einmal 80 %.
Abb. 3.1: Zufriedenheit mit seinem Erscheinungsbild: Auf die Perspektive kommt es an
4 Das Konzept vom eigenen Körper
Wie wichtig dieses Konzept von der Perspektivenvielfalt auf das Selbst für ein Verständnis des Körperbildes und des Körpererlebens ist, wird deutlich werden, wenn wir uns über die Entwicklung des Körperselbst Gedanken machen.
4.1 Die Entwicklung des Körperselbst
Der Anthropologe Edward T. Hall (1966) war davon überzeugt, dass ein Großteil unseres Verhaltens durch eine „verborgene Dimension“ bestimmt wird, die dazu führt, dass wir mit unserem Körper unbewusst die soziale Qualität einer Situation ausdrücken und auch bestimmen. Das Konzept, welches er zur Beschreibung und Erforschung dieses Grundgedankens formulierte, nannte er „personal space“. Demnach ziehen Menschen es vor, zwischen sich und anderen einen bestimmten Raum aufrechtzuerhalten. Dieser persönliche Raum beschreibt eine Grenze, die das Ausmaß des physischen Kontaktes zwischen Menschen bestimmt. Diese implizite Grenze ist nach vorne weiter als hinter unserer Person: Rückt von hinten jemand an uns heran, dann empfinden wir dies schneller als zu nah als wenn diese Annäherung von vorne geschieht. Das erlebende Individuum ist immer ungefähr in der Mitte dieses persönlichen Raumes lokalisiert.
Dass eine Annäherung von vorne von uns nicht so schnell als zu nahe empfunden wird, zeigt deutlich die Funktion des Schutzes, die unser individueller persönlicher Raum übernimmt. Deshalb wird unser persönlicher Raum, sobald jemand unerlaubterweise in ihn einzudringen versucht, auch verteidigt (Aiello, 1987). Wenn wir jemandem aus Versehen auf den Fuß treten, dann gehört es mit zur sozialen Konvention, dass man sich dafür entschuldigt. Solche Konventionen sind zahlreich in unserer Kultur zu finden und verhindern, dass Personen sich fälschlicherweise angegriffen fühlen könnten.
Den Schutz unseres persönlichen Raumes können wir in intimeren Situationen, in denen wir mit uns vertrauten und zugewandten Personen interagieren, aufgeben. Der Bedarf an persönlichem Raum ist in solchen Kontexten relativ gering und nimmt mit zunehmender Distanziertheit zu den anderen Personen einer Situation wieder zu.
Bedeutsamkeit enger Beziehungen für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit
Intimere Beziehungen, in denen wir unseren persönlichen Raum mit dem einer anderen Person überlappen, sind für die Entwicklung eines physisch wie psychisch stabilen Menschen bedeutsam. Neugeborene haben in der Regel kein großes Bedürfnis nach einem persönlichen Raum: Dieses Bedürfnis entwickelt sich allmählich und wird sich in Abhängigkeit von den sozialen Erfahrungen, die eine Person im Laufe ihrer Entwicklung macht, gestalten. Gerade in der frühen Kindheit ist es wichtig, dass Kinder ein tragfähiges „bodyself“ entwickeln, also ein Gefühl zu ihrem Körper entwickeln, das eine positive Qualität für das sich daraus ergebende Körperbild hat. Krueger (2002) hebt für die Entwicklung des Körperselbst hervor, dass das Körperbild selbst sich auf einer positiven Grundlage graduell lebenslang entwickelt. Abrupte Veränderungen in dieser Entwicklung deuten auf einen pathologischen Prozess hin.
Krueger (2002) beschreibt die Entwicklung des Körperselbst als drei fließend ineinander übergehende Entwicklungsstadien. Das erste Stadium – frühe Erfahrungen mit dem Körper – ist dadurch charakterisiert, dass dem inneren Zustand von innerkörperlichen Empfindungen und den äußeren Reizen, welche durch unsere Sinnesorgane wahrgenommen werden, nur allmählich eine Form gegeben werden kann. Dabei sind die anderen Personen wichtig: Ihre Berührungen formen den Sinn für Körpergrenzen, der innere Zustand kann nur geformt werden, wenn empathische Zuwendung vorhanden ist. In diesem ersten Stadium gibt es also bereits soziale Voraussetzungen, die, sind sie nicht gegeben, es schwer für einen neugeborenen Menschen machen, zu bestimmen, was von innen kommt, was von außen kommt, wo der Körper beginnt und wo er aufhört.
Genau dieser Lernprozess wird dann im zweiten Stadium abgeschlossen: Es geht hier um das Definieren der äußerlichen Körpergrenzen und die Unterscheidung von körperlichen internalen Zuständen. Dieses neue Wissen wird in ein Körperselbst integriert. So entsteht ein rudimentäres Verständnis der sozialen Welt, es gibt Ich und Nicht-Ich. Unsere Körpererfahrungen werden runder und mehr und mehr in Beziehung zu uns selbst gesetzt.
Während des dritten Stadiums wird die Definition des Körperselbst durch die Fähigkeit zur Selbstaufmerksamkeit weiterentwickelt. Die Differenzierung zwischen Fremd und Selbst geht einher mit einem wachsend akkurateren Körperbild. Krueger betont, dass diese Entwicklung eine lebenslange Entwicklung ist, die normalerweise harmonisch verläuft, wenn es nicht zu gravierenden Störungen in den Lebenszusammenhängen eines Individuums kommt.
4.2 Körperkonzept und Bindungstheorie: Das Skizzieren eines Zusammenhangs
Aus diesen Überlegungen zur Entwicklung des Körperselbst geht hervor, dass unser Körpererleben, genauso wie unser Selbstkonzept, untrennbar verbunden ist mit dem sozialen Gefüge, in dem wir heranwachsen. Die sozialen und körperlichen Erfahrungen, die wir sammeln, bilden die Informationen aus den unterschiedlichen Perspektiven ab, die auf uns eingenommen werden und die wir übernehmen.
Eine Theorie, die den frühen Kindheitserfahrungen mit den relevanten Bezugspersonen für die Lebensqualität der Gesamtbiographie eine enorme Wichtigkeit beimisst, ist die Bindungstheorie. So schreibt Bowlby 1973:
„From not only young children, it is now clear, but human beings of all ages are found to be at their happiest and to be able to deploy their talents to best advantages when they are confident that, standing behind them, there are one or more trusted persons who will come to their aid should difficulties arise. The person trusted provides a secure base from which his (or her) companion can operate“ (S. 359).
Bowlby interessierte sich dafür, wie und warum Kinder eine emotionale Bindung an ihre hauptsächlichen Bezugspersonen entwickeln und warum sie häufig emotionalen Stress entwickeln, wenn sie physisch von ihnen getrennt werden. Dieser emotionale Stress nach einer Trennung weist dabei einen universellen Ablauf auf. Zunächst löst die Trennung von einer wichtigen Bezugsperson Protest aus, führt dann zur Verzweiflung und endet im Falle länger andauernder Trennung mit der Lockerung der Bindung.
Möglicherweise liegt der Motivation, sich an eine enge Bezugsperson zu binden, ein evolutionäres Prinzip zugrunde: Wenn Kinder physische Nähe zu ihrer primären Bezugsperson wahren, dann sichert das in einem höheren Ausmaße ihre Versorgung, aber auch Schutz vor Gefahren. Es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit zu überleben. Insbesondere in als bedrohlich wahrgenommenen Situationen wird das sogenannte Bindungssystem aktiviert und die Bezugsperson als sichere Basis aufgesucht, um Unterstützung und Zuwendung zu erfahren. Dieses Muster impliziert jedoch auch, dass ohne sichere Basis, also ohne eine Bindung an mindestens eine Bezugsperson, die Exploration der Welt schwer fallen dürfte. Dieser Gedanke ist ein Ausgangspunkt für die weiterführenden Überlegungen und Beobachtungen von Ainsworth und Mitarbeitern/-innen.
Beobachtungen an kleinen Kindern
Ainsworth et al. (1978) gehen davon aus, dass in dem Maß, in dem eine Bindung als sicher erlebt wird, die Umwelt auch exploriert werden kann. Wenn wir uns geborgen und sicher aufgehoben fühlen, wissen wir, wohin wir uns wenden können, wenn Gefahr in Verzug ist. Haben wir eine solche sichere Bindung nicht, müssen wir weitaus vorsichtiger in unserer Exploration vorgehen.
Die Beobachtungen von Ainsworth et al. zeigen, dass Kinder sehr unterschiedlich auf eine Trennung von ihren primären Bezugspersonen reagieren. Ausgehend von Feldbeobachtungen (Ainsworth, 1967; Ainsworth & Wittig, 1969) entwickelten Ainsworth et al. eine „Fremde Situation“. Mütter kamen mit ihren Kleinkindern in ein Labor, in dem Spielzeug herumlag und eine fremde Person anwesend war. Sie ließen das Kind allein und kamen nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zurück. Das Verhalten der Kinder wurde durch einen Einwegspiegel beobachtet. Die dabei beobachteten Reaktionen der Kinder wiesen zwar alle einen Ablauf von Protest, Verzweiflung und Lockerung der Bindung auf. Die Ausprägung hinsichtlich der einzelnen Phasen war jedoch so unterschiedlich, dass drei Stile herausgearbeitet wurden (vgl. auch Weinfield, Sroufe & Egeland, 1999).
Als „sicher gebunden“ wurden die Kinder bezeichnet, die zwar zunächst mit Protest auf die Trennung von der Mutter reagierten, dann aber mit den Spielsachen spielten, Kontakt mit der anderen Person aufnahmen und die Mutter nach deren Rückkehr begrüßten und aktiv deren Nähe und Zuwendung aufsuchten, wenn sie sich sehr gestresst durch die Trennung gefühlt hatten. Die Mutter als Bezugsperson kann also als sichere Basis für eine weitere Exploration genutzt werden. Als „ängstlich-ambivalent“ gebunden wurden die Kinder bezeichnet, welche bereits vor der Trennung ein anklammerndes Verhalten an die Mutter zeigten und deutliche Angst aufwiesen, mit der fremden Person allein zu bleiben. Nach der Trennung verhielten sich die Kinder passiv, ließen sich nicht von der fremden Person trösten und weinten unaufhörlich. Protest und Verzweiflung – auch bei den sicheren Kindern zu beobachten – waren hier sehr deutlich ausgeprägt. Nach der Rückkehr der Bezugsperson zeigten sie ein ambivalentes Verhalten: Zunächst wird der Kontakt aufgesucht, um dann ärgerlich wieder unterbrochen zu werden. Auch lassen sie sich selbst durch die Mutter nur schwer wieder beruhigen. Diese kann nicht als Basis benutzt werden, um Nähe, Trost und Zuwendung zu erhalten. Schließlich wird eine dritte Gruppe von Kindern als „vermeidend gebunden“ bezeichnet. Vermeidung und die Lockerung der Beziehung stehen hier als Reaktionen im Vordergrund. Protest und Verzweiflung als Anzeichen von Stress ist bei diesen Kindern nur in geringem Ausmaß zu beobachten. Auf den ersten Blick wirken diese Kinder völlig autonom. Sie spielen mit den im Labor vorhandenen Spielsachen, nehmen aber keinen Kontakt zu der anderen Person auf. Kehrt die Mutter zurück, zeigen sich die Anzeichen von der gelockerten Bindung: Die Nähe zur Mutter wird gemieden, ebenso eine Interaktion mit ihr. Die Vermeidung wird mimisch durch ein weggedrehtes Blickfeld und eine Wegbewegung von der Bezugsperson sichtbar. Das Interesse für das Spielzeug oder die andere Person scheint plötzlich größer zu sein als für die zurückgekehrte Mutter. Die zu beobachtenden verlangsamten Bewegungen, Stereotypien und ein leerer Gesichtsausdruck weisen darauf hin, dass die Kinder mehr Stress erleben, als sie nach außen hin zeigen.
Main und Solomon (1986, 1991) untersuchten eine vierte Gruppe von Kindern genauer, deren Reaktionen sich nicht eine der drei von Ainsworth et al. beobachteten Mustern zuwiesen ließen. Hierzu reanalysierten sie zahlreiche Videoaufnahmen (n < 400). Das Verhaltensmuster dieser Kinder war unsystematisch. Die Autoren schlugen vor, diese als „desorientiert gebunden“ bzw. desorganisiert gebunden zu bezeichnen („defended/coercive“ nach Crittenden, 1992). Das Verhalten der Kinder weist starke Widersprüche auf. Zwar sind solche Widersprüche auch bei ängstlich-ambivalent gebundenen Kindern zu beobachten, der Wechsel von Anklammern zu Ablehnung und Ärger ist jedoch bei desorganisiert gebundenen Kindern noch wesentlich stärker ausgeprägt. So unterschiedlich die qualitative Ausgestaltung dieser Widersprüche auch bei diesen Kindern zutage tritt (Anzeichen von Furcht und Schrecken bei der Rückkehr der Mutter, Erstarren, tranceähnliche Zustände), so ist doch bei allen Kindern ein starker Gemütswechsel zu beobachten.
Diese Beobachtungen machen deutlich, dass eine enge, unterstützende Bindung bereits im Kleinkindalter nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Sie machen aber auch deutlich, dass der Terminus „sichere Bindung“ nicht die Abwesenheit negativer Emotionen oder Erlebnisse bezeichnet, sondern dass eine sicher gebundene Person zumindest eine sichere soziale Basis hat, die sie in gefahrvollen Situationen aufsuchen kann, um Nähe und Zuwendung zu bekommen.
Woher kommen diese Unterschiedlichkeiten im Bindungsverhalten? Bowlby machte frühkindliche Bindungserfahrungen dafür verantwortlich. Die Qualität der primären Beziehung gilt als zentral für die sozioemotionale Entwicklung, denn sie stellt die erste Erfahrung mit menschlicher Intimität dar. Auch bildet sie die Grundlage der erst später zunehmend internalisierten Affektregulation (Isabella, 1993), da bis dahin die Reaktionen der Bezugspersonen auf die Bedürfnisse des Kindes eine externale Emotionsregulation darstellten. Diese Reaktionen stellen Vorbilder des späteren eigenen Umgangs mit Emotionen dar. Und natürlich beeinflussen diese Erfahrungen in den ersten Beziehungen was das Kind darüber lernt, wie in Beziehungen Verhalten aufeinander abgestimmt wird (Elicker, Egeland & Sroufe, 1992).
Die Auswirkungen frühkindlicher Bindungserfahrungen können, müssen aber nicht bis in das Erwachsenenalter reichen (Larose & Boivin, 1998), wo sie sich in den Bereichen Elternschaft und intimen Beziehungen zeigen (s. weiter unten).
Bindung und das Konzept von sich selbst und den anderen
In den internal repräsentierten Arbeitsmodellen sind sowohl Konzeptionen von sich selbst als auch von anderen abgebildet. Die Grundlage dieser Modelle sind stets die Interaktionsmuster mit den relevanten Bezugspersonen. Nach Main, Kaplan und Cassidy (1985) organisieren diese Modelle nun die weitere Persönlichkeitsentwicklung und leiten das Sozialverhalten. Demnach halten sich sichere Personen für freundlich und sympathisch, andere Personen werden von ihnen als vertrauenswürdig und zuverlässig eingeschätzt. Ängstlich-ambivalent gebundene Personen bewerten sich selbst als verkannt, unvertrauenswürdig und unterschätzt, sie bewerten andere Personen als unzuverlässig, unwillig und unfähig, eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Vermeidend gebundene Personen nehmen sich selbst als misstrauisch und skeptisch wahr, andere Personen sind für sie grundsätzlich unzuverlässig oder aber zu eifrig im Einlassen auf intime Beziehungen (s. hierzu auch Collins & Read, 1990).
Bartholomew (1990) und Bartholomew und Horowitz (1991) erweiterten entlang der Arbeitsmodelle von sich selbst und derjenigen von anderen das Klassifikationssystem von Bindungsstilen. Wie aus Abbildung 4.1 hervorgeht, gehen die Autoren von einem zweidimensionalen Ansatz aus: Abhängigkeit und Vermeidung. Hiermit beschreiben und erklären sie die unterschiedlichen Haltungen zur Intimität, also zu einer sehr engen Bindung:
„Fearful“ (ängstlich), eine ängstliche Form der Vermeidung, ist charakterisiert durch einerseits einen bewussten Wunsch nach Kontakt mit den als positiv wahrgenommenen Anderen, andererseits aber auch durch Angst vor antizipierten negativen Folgen wie Ablehnung und Zurückweisung durch andere. Dieser Angst liegt ein negatives Selbstbild zugrunde.