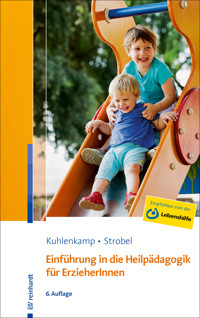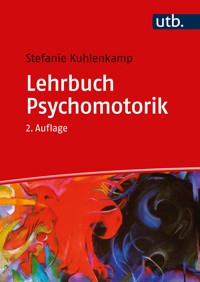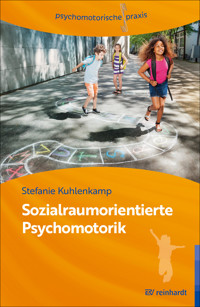
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie können psychomotorische Angebote sozial benachteiligte Menschen erreichen? Was bedeutet es, armutssensibel in der Psychomotorik zu arbeiten? Und welche Chancen bietet psychomotorisches Handeln speziell für die Gesundheitsförderung in prekären Lebenslagen? Diese Fragen werden anhand von Praxisbeispielen aus verschiedenen Settings beleuchtet - von Kindertagesstätten, offenen Ganztagsgrundschulen, Vereinen bis hin zu Präventionsketten und Service Learning. Zudem wird auf wichtige Grundbegriffe wie Gesundheitsförderung, Sozialraumorientierung und Armutslagen Bezug genommen und ihre Bedeutung für psychomotorisches Handeln aufgezeigt. Ein kompaktes Grundlagenwerk für alle pädagogischen, sozialen und motologischen Fachkräfte, die mit sozial benachteiligten Menschen arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefanie Kuhlenkamp
Sozialraumorientierte Psychomotorik
Psychomotorische Arbeit im Kontext sozialer Benachteiligung
Mit 21 Abbildungen und 4 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof.in Dr. Stefanie Kuhlenkamp lehrt Inklusion und Soziale Teilhabe im Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund. Darüber hinaus forscht und lehrt sie zu frühkindlicher Bewegungsförderung und Psychomotorik. Sie leitet den Förderverein Bewegungsambulatorium an der Universität Dortmund e. V., in dem sie auch Kinder und Jugendliche psychomotorisch fördert. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift „motorik“ des Ernst Reinhardt Verlages.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Kuhlenkamp, S.: Lehrbuch Psychomotorik (2., überarbeitete Aufl.; ISBN 978-3-8252-8820-4)
Kuhlenkamp, S./Schlesinger, G.: Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Frühe Bildung in Bewegung (1. Aufl. 2021; ISBN 978-3-497-03033-0)
Kuhlenkamp, S./Strobel, B.: Einführung in die Heilpädagogik für ErzieherInnen (5., aktualisierte Aufl. 2021; ISBN 978-3-497-03039-2)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03171-9 (Print)
ISBN 978-3-497-61708-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61711-1 (EPUB)
© 2023 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Printed in EU
Covermotiv: Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com/SerrNovik (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: Bernd Burkart; www.form-und-produktion.de
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
I
Grundlagen sozialraumorientierter Psychomotorik
1
Psychomotorik
1.1
Psychomotorisches Grundverständnis
1.2
Gesundheitsförderung als Paradigma einer sozialraumorientierten Psychomotorik
2
Sozialraumorientierung
2.1
Begriff Sozialraum
2.2
Begriff Sozialraumorientierung
2.3
Sozialraumanalyse
3
Armutslagen
3.1
Begriffsklärung und aktuelle Daten zu Armutslagen
3.2
Armutskonzept Lebenslagenansatz
3.3
Dimensionen von Armutslagen
3.4
Kindliche Armutslagen
3.5
Stadt, Armut und Segregation
4
Perspektiven und Orientierungen einer sozialraumorientierten Psychomotorik
4.1
Gesundheitliche Chancengleichheit
4.2
Lebenswelt- und Alltagsorientierung – Settingansatz
4.3
Partizipation und Empowerment
4.4
Orientierung an Gesundheit –Salutogenese und Resilienz
4.5
Kindbezogene Armutsprävention
4.6
Armutssensibles Arbeiten
II
Praxis sozialraumorientierter Psychomotorik
5
Sozialraumorientierte Psychomotorik – Zugänge und Ansatzpunkte
5.1
Lokale AkteurInnen der Gesundheitsförderung
5.2
Soziale Netzwerkarbeit und Netzwerkorientierung
5.3
Finanzierung
5.4
Städtebauprogramm Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt
5.5
Quartiersmanagement
6
Psychomotorik im Kontext kommunaler Präventionsketten
7
Psychomotorik in den Frühen Hilfen
8
Psychomotorik im Kontext Primärprävention und Gesundheitsförderung
9
Mobile Angebote zur Förderung von Bewegung und Spiel
10
Psychomotorik in Kindertageseinrichtungen
11
Psychomotorik in der Offenen Ganztagsgrundschule
12
Psychomotorik im Kontext Service Learning an Hochschulen und Fachschulen
13
Psychomotorik im Verein
14
Psychomotorik in der Stadtplanung
Literatur
Sachregister
Vorwort
„Es reicht nicht aus, den Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit als ‚ganzheitliches Wesen‘ anzuerkennen, er muss auch wiederum als ‚Teil des Ganzen‘, als Teil sozialer und gesellschaftlicher Zusammenhänge begriffen werden“ (Esser 2020, 100).
Sag mir, wo Du wohnst, und ich sag Dir, wie gut bzw. schlecht deine Gesundheit, deine Teilhabemöglichkeiten an Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit etc. sind und wie andere über deinen Wohnort denken.
So lassen sich, stark verkürzt und zugespitzt, die Erkenntnisse der Armuts-, Gesundheits- und Bildungsforschung sowie der Stadtsoziologie zusammenfassen. Mit Begriffen wie benachteiligtes Quartier, Problemviertel, sozialer Brennpunkt, Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf wurden und werden Gebiete etikettiert, in denen Ressourcenmangel und Exklusion sowie Benachteiligungen unterschiedlichster Art kumulieren und interagieren. Unter der Perspektive der sozialraumorientierten Psychomotorik wird in diesem Buch eine Verortung und Fokussierung der psychomotorischen Praxis auf diese benachteiligten Quartiere und Bevölkerungsgruppen vorgenommen.
Eine sozialraumorientierte Psychomotorik setzt sich sowohl mit der Lebenslage dieser Menschen als auch mit dem sie umgebenden Sozialraum auseinander. Wie das Eingangszitat nahelegt, geht dabei der Blick über das einzelne Individuum hinaus, denn für die Praxis einer sozialraumorientierten Psychomotorik sind auch die Ressourcen und Begrenzungen des Sozialraums, in dem Individuen ihren Alltag gestalten, relevant.
Das vorliegende Buch wendet sich daher an psychomotorische Fachkräfte und Einrichtungen in Gebieten, die als benachteiligte Sozialräume betrachtet werden. Es möchte dazu anregen, nach Möglichkeiten und Chancen zu suchen, durch psychomotorisches Arbeiten einen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen und Leben unter erschwerten Bedingungen zu leisten.
Wie dies gelingen kann, welche Ansatzpunkte, Zugänge sowie Bezüge in Theorie und Praxis hierfür hilfreich sein können, wird in diesem Buch vorgestellt.
Hierfür erfolgt zunächst im Grundlagenteil eine Definition der sozialraumorientierten Psychomotorik und deren Fundierung anhand von Erkenntnissen und Methoden der Gesundheitsförderung, der Sozialen Arbeit sowie der interdisziplinären Armutsforschung. Entlang dieser Grundlagen werden die im zweiten Teil dargestellten Praxisbeispiele entwickelt. Diese verstehen sich als Anregungen dafür, wie psychomotorisches Arbeiten in benachteiligten Sozialräumen realisiert werden kann. Es geht dabei weniger um die konkrete Ausgestaltung einzelner Angebote, sondern vielmehr um Zugänge, Finanzierung, Organisationsformen und armutssensibles Arbeiten.
Dabei stehen die Inhalte des Buchs exemplarisch für die Wechselwirkung von Praxis und Theorie in der Psychomotorik, denn das Buch ist das vorläufige Ergebnis der eigenen langjährigen Arbeit in der psychomotorischen Praxis in verschiedenen Sozialräumen, als Vorsitzende eines Psychomotorikvereins, als Hochschullehrerin, als Forschende, als Bürgerin einer Stadt, in der sich über die Jahre tragfähige Netzwerke gebildet haben, in denen auch die Ideen der Psychomotorik ihren Platz gefunden haben.
Dieses Buch versteht sich auch als ein Plädoyer in dreifacher Hinsicht:
Erstens als ein Plädoyer für die Aufnahme der Sozialraumorientierung in das Theorie- und Praxisgebäude der Psychomotorik. Die Aufnahme der Sozialraumorientierung als Fachkonzept und Arbeitsprinzip der Sozialen Arbeit in das psychomotorische Theoriefundament bietet Anhaltspunkte für die Etablierung psychomotorischen Arbeitens in sozial benachteiligten Quartieren. Diese Anhaltspunkte sind relevant, da die Erkenntnisse der Teilhabe- und Armutsforschung verdeutlichen, dass die soziale Herkunft maßgeblich und lebenslang auf Gesundheitsstatus und Bildungsbeteiligung wirkt. Unter dem Paradigma der Gesundheitsförderung kann Psychomotorik hier einen Beitrag zur Armutsfolgenprävention leisten. Fokussiert wird dabei die Gestaltung des Lebensumfelds für die Zielgruppe Kinder und ihre Familien, die die größte Gruppe der armutsgefährdeten Personen bilden.
Zweitens als ein Plädoyer dafür, psychomotorisches Arbeiten dorthin zu bringen, wo es benachteiligte Menschen erreicht, denn Menschen, die in benachteiligten Quartieren leben, verfügen über eine geringere räumliche Mobilität. Sie können sich daher nur begrenzt Möglichkeitsräume außerhalb ihrer Wohnumgebung erschließen. Gleichzeitig weisen benachteiligte Quartiere, im Vergleich zur Gesamtstadt, einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen auf (Herrmann 2019, 23). Neben der psychomotorischen Förderung als solcher besteht aber auch der Auftrag, sich im Sozialraum zu engagieren, um diesen mitzugestalten und sich bestenfalls auch politisch einzubringen.
Drittens als ein Plädoyer für die Integration der Psychomotorik in die Methoden der Sozialen Arbeit. Soziale Arbeit zeichnet sich in ihrem Kern durch die unmittelbare Begegnung mit Menschen in unterschiedlichsten (prekären) Lebenslagen aus. Zur Gestaltung der professionellen Begegnung greift sie auf zahlreiche Handlungsmethoden zurück. Diese können durch die Psychomotorik um einen leib-/körper- und bewegungsorientierten Zugang erweitert werden, denn dem Körper kommt „als soziale Realität eine grundlegende Bedeutung zu, [da] über ihn und durch ihn sämtliche Akte sozialen Handelns vollzogen werden und in ihm soziale wie gesundheitliche Ungleichheit eingeschrieben sind“ (Homfeldt/Sting 2018, 575). Beispielsweise zeigt sich diese Integration bereits am Studiengang Soziale Arbeit plus Psychomotorik an der Hochschule Darmstadt oder an der Gründung der Fachgruppe Bewegung, Sport & Körper der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit im Jahr 2019.
Abschließend wird angemerkt, dass in diesem Buch aufgrund der in Deutschland fehlenden einheitlichen Bezeichnungen für die Personen, die in unterschiedlichen Settings, mit verschiedenen Personengruppen und Ausbildungen psychomotorisch arbeiten, alle Personen, die professionell in der psychomotorischen Praxis tätig sind, als psychomotorische Fachkräfte bezeichnet werden. Die unterschiedlichen psychomotorischen Formate, die von psychomotorischen Fachkräften durchgeführt werden, werden zusammengefasst als psychomotorische Angebote oder psychomotorische Praxis bezeichnet.
Dortmund im Frühjahr 2023,Stefanie Kuhlenkamp
IGrundlagen sozialraumorientierter Psychomotorik
1Psychomotorik
Unter dem Begriff Psychomotorik werden in Deutschland Ansätze einer ganzheitlichen Persönlichkeitsförderung und Entwicklungsbegleitung über die Lebensspanne gefasst, die die Wechselwirkung von Bewegen, Wahrnehmen, Denken und Erleben in sozialen Bezügen in den Mittelpunkt der Arbeit stellen (Kuhlenkamp 2022, 21ff).
Die deutsche Psychomotorik hat sich seit den 1950er Jahren kontinuierlich entwickelt und ausdifferenziert. Dies hat zur Folge, dass unter dem Begriff Psychomotorik verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen/Praktiken gefasst werden, die unterschiedliche Schwerpunkte in Theorie und Praxis setzen.
Als Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Ansätze können das humanistische Menschenbild sowie die Grundannahme der Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen angenommen werden. Psychomotorische Ansätze betrachten „den Menschen ganzheitlich als Wesen, dessen Emotionen, Kognitionen, sinnliche Wahrnehmung, Bewegungen und soziale Kommunikation in enger Wechselbeziehung geschehen“ (Haas 2014, 11).
In der Psychomotorik wird Bewegung als Ausgangs- und Ansatzpunkt für soziales, emotionales und kognitives Handeln betrachtet. Das Bewegungsverständnis geht über die reine körperliche Aktivität und ein Beüben motorischer Funktionen hinaus. Bewegung dient vielmehr dem Ausdruck, der Mitteilung und dem Erfahrungsgewinn und erhält damit eine kontextbezogene, individuelle, sinngebende Bedeutung (Kuhlenkamp 2022, 121).
Die grundlegenden Handlungsprinzipien der Psychomotorik werden unter anderem von Ernst J. Kiphard (1989, 50) mit folgenden Begriffen umrissen und kontrastiert:
■Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung anstelle von Leistungsorientierung
■Individuumsorientierung anstelle einer Normorientierung
■Prozessorientierung anstelle von Produktorientierung
■freie Handlungsmöglichkeiten in offenen Bewegungssituationen anstelle des ausschließlichen Nachvollziehens genormter Bewegungsabläufe
■Selbstbestimmung und Freiwilligkeit anstelle von Fremdbestimmung
Ergänzt werden diese Handlungsprinzipien um folgende Aspekte (Kuhlenkamp 2022, 124 – 149):
■Beziehungs- und Dialogorientierung
■Spielorientierung
■Gruppenorientierung
■Ressourcenorientierung und Resilienzförderung
■Entwicklungsorientierung
In diesem Buch werden diese Handlungsprinzipien um die Sozialraumorientierung erweitert (ausführlich dazu Kap. 2).
Entlang der Handlungsprinzipien kann die konkrete psychomotorische Praxis je nach eingenommener psychomotorischer Perspektive unterschiedlich begründet und gestaltet werden. Die einzelnen psychomotorischen Perspektiven unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Grundannahmen über Entwicklungsprozesse, ihres Störungsverständnisses und des davon abzuleitenden Vorgehens in der Förderung. Sie dienen als Basis der Planung und Reflexion psychomotorischer Praxis. In der Praxis ergänzen und überschneiden sich in der Regel einzelne Perspektiven. Die einzelnen Perspektiven können jeweils zwei grundlegenden Kategorien zugeordnet werden (ausführlich dazu Kuhlenkamp 2022, 24–34):
1.Erklärende Ansätze, unter die die funktional-physiologische und die erkenntnisstrukturierende Perspektive gefasst werden
2.Verstehende Ansätze, unter die die identitätsbildende / sinnverstehende und ökologisch-systemische Perspektive fallen
Da es in der sozialraumorientierten Psychomotorik weniger um eine konkrete psychomotorische Praxis im Sinne der Gestaltung einzelner Angebote im Detail geht, sondern vielmehr um eine sozialräumliche Verortung und Fokussierung auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wird an dieser Stelle auf eine differenzierte Darstellung psychomotorischer Perspektiven verzichtet. Stattdessen wird im folgenden Kapitel das für eine sozialraumorientierte Psychomotorik relevante psychomotorische Grundverständnis vorgestellt.
1.1Psychomotorisches Grundverständnis
Psychomotorik als „eine entwicklungstheoriegeleitete Handlungswissenschaft mit Ausrichtung auf die Erforschung der dynamischen Personen-Umwelt-Interaktion“ (Fischer 2019, 113) muss die Lebenslage ihrer AdressatInnen berücksichtigen. Eine sozialraumorientierte Psychomotorik geht daher über die individuumszentrierten Ansätze der psychomotorischen Arbeit hinaus, da in ihr sowohl das Individuum als auch dessen lebensweltlicher Kontext adressiert werden.
Damit orientiert sie sich an einer sozial-ökologischen Entwicklungsperspektive nach Urie Bronfenbrenner (1993), in der die Entwicklungskontexte (= soziale Wirklichkeit) in ihrer Bedeutung für menschliche Entwicklung betont werden. Bronfenbrenner verweist in seiner Studie „Wie wirksam ist kompensatorische Erziehung?“ darauf, dass Fördermaßnahmen nur dann deutlich nachhaltig wirken, wenn sie möglichst in der frühen Kindheit und mit einer möglichst dauerhaften Veränderung des unmittelbaren kindlichen Umfelds einhergehen (Bronfenbrenner 1974). Da gerade Eltern in der frühen Kindheit den unmittelbaren Entwicklungskontext bilden, sollte die familiäre Lebenswelt stärker in den Blick genommen werden, wie dies zum Beispiel im Kontext der Frühen Hilfen geschieht (Kap. 8). Eine Auseinandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit führt insgesamt zu einer notwendigen Rahmenerweiterung des psychomotorischen Wirkens sowie zu einem Verständnis für Entwicklungsspielräume. Dabei sind
„Menschen […] weder ferngesteuerte Roboter einer sie gängelnden und steuernden Umwelt, noch sind sie völlig frei von dieser Umwelt. Ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Begrenzungen hinsichtlich ihrer Lebensführung hängen eng mit den Möglichkeiten und Begrenzungen der Umwelt zusammen“ (Röh 2013, 61).
Eine sozialraumorientierte Psychomotorik zielt daher, neben den individuellen Förderzielen für einzelne TeilnehmerInnen, sowohl auf die Erweiterung von Ressourcen im Sozialraum als auch auf eine Kompensierung und ggf. auch Minimierung der dort vorhandenen Probleme/Einschränkungen. Sie fragt deshalb unter anderem danach: Welche Bewegungs- und Spielmöglichleiten bietet der Sozialraum, welche (noch) nicht, welche Strukturen, Einrichtungen, Settings (Kap. 4.2) bietet der Sozialraum, wie und von wem werden sie genutzt?
Hierfür werden die psychomotorischen Bezugsdisziplinen (zum Beispiel Entwicklungspsychologie, Erziehungswissenschaften, Heilpädagogik, Sportwissenschaft) um die Perspektiven der Sozialen Arbeit und der Gesundheitswissenschaften erweitert.
Unter Berücksichtigung des Paradigmas der Gesundheitsförderung (Kap. 1.2), der Definition des Begriffs Sozialraumorientierung nach Becker (2020b, 19) (Kap. 2.1) sowie unter Einbezug der Psychomotorik-Definition von Krus (2015, 53) wird sozialraumorientierte Psychomotorik daher wie folgt definiert:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – DEFINITION –
Sozialraumorientierte Psychomotorik ist ein Konzept der ganzheitlichen Gesundheitsförderung über die Lebensspanne durch Bewegung und Körperlichkeit. Ihr liegt ein Verständnis der Einheit von Bewegen, Wahrnehmen, Erleben und Handeln in bedeutungsvollen sozialen Kontexten zu Grunde. Neben individuellen Zielsetzungen wird die Entwicklung sozialer und räumlich strukturierter Kontexte angestrebt.
Sozialraumorientierte Psychomotorik betrachtet auf der individuellen Ebene Bewegungs- und Körpererfahrungen als fundamentale Bausteine für Lernprozesse, Identitätsbildung, Beziehungsgestaltung sowie für das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden.
Sie geht jedoch in ihrer Zielsetzung über die psychomotorische Arbeit mit Individuen/Gruppen hinaus, indem sie größere soziale Einheiten miteinbezieht und darauf zielt, aus der Bewegungs- und Körperperspektive gesundheitsförderliche gesellschaftliche Strukturen zu schaffen bzw. bestehende (sozialräumliche) Strukturen zu beeinflussen.
!
Das basale Anliegen der sozialraumorientierten Psychomotorik besteht darin, eine Praxis zu schaffen, in der Menschen auf ihrem Weg zu einem selbstverantwortlichen und bewussten Umgang mit ihrer Gesundheit über Bewegung und Körperlichkeit angeregt und begleitet werden.
Damit soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung einer lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung in sozialräumlichen Settings wie Stadtteilen oder Quartieren geleistet werden. Kapitel 2 und 4.2 beschäftigen sich daher ausführlich mit den Begriffen Sozialraum und Settingansatz der Gesundheitsförderung.
1.2Gesundheitsförderung als Paradigma einer sozialraumorientierten Psychomotorik
Die sozialraumorientierte Psychomotorik folgt dem psychomotorischen Paradigma der Gesundheitsförderung (Seewald 2012; Kuhlenkamp 2022, 38ff), das die enge Verflechtung von Gesundheit, Bewegung und Leiblichkeit in den Mittelpunkt stellt.
Gesundheit wird analog der Gesundheitsdefinition aus der Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verstanden:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – DEFINITION –
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung“ (WHO 1948, 1).
„Für die WHO wird Wohlbefinden (im englischen Original: ‚well-being‘) zur Fähigkeit, eigene persönliche, soziale und ökonomische Ziele umzusetzen. Dadurch können kritische Lebensereignisse bewältigt, ein gemeinschaftlich angelegter Lebensweg beschritten und die dafür notwendigen Lebensverhältnisse gepflegt werden. Damit sind sowohl subjektive wie objektive Anteile von Gesundheit angesprochen, und zugleich wird eine ganzheitliche Sicht einer bio-psychosozialen Gesundheit festgelegt“ (Röhrle 2018, o. S.).
Die wertorientierte Gesundheitsdefinition der WHO ist von besonderer Relevanz für den Kontext Gesundheitsförderung, da sie über eine rein medizinische Definition hinausgeht. Gleichzeitig betrachtet diese Definition Gesundheit multidimensional, denn sie umfasst sowohl körperliche als auch seelisch-geistige und soziale Dimensionen, die sich wechselseitig beeinflussen. Damit erfolgt die Abkehr von einem medizinischen Gesundheitsmodell hin zu einem sozialen Modell (Tab. 1).
Tab. 1: Gegenüberstellung medizinisches und soziales Gesundheitsmodell (Naidoo/Wills 2019, 38)
medizinisches Modell
soziales Modell
Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit.
Gesundheit ist das Ergebnis sozialer, biologischer und physischer Umweltfaktoren.
Gesundheitsdienste sind ausgerichtet auf die Behandlung von kranken Menschen und Menschen mit Behinderung.
Die Gesundheitsdienste betonen alle Stufen der Prävention und Behandlung.
Hoher Wert wird auf die fachärztliche Versorgung gelegt.
Die fachärztliche Versorgung wird weniger betont, mehr Beachtung wird dagegen den Selbsthilfegruppen und gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsaktionen geschenkt.
Die Gesundheitsberufe diagnostizieren, behandeln und legitimieren die „Krankenrolle“ ihrer Patienten und Patientinnen.
Die Gesundheitsberufe ermöglichen ihren Klienten und Klientinnen, mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu erlangen.
Die pathogenetische Fokussierung betont das Auffinden biologischer Krankheitsursachen.
Die salutogenetische Fokussierung betont mehr die Frage, wie die Gesundheit der Menschen gestärkt werden kann.
Die Jakarta-Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert der WHO gilt als eines der zentralen Dokumente der Gesundheitsförderung. Hier werden Gesundheitsförderung und deren Ziele wie folgt definiert:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – DEFINITION –
„Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der Menschen befähigen soll, mehr Kontrolle über ihre Gesundheit zu erlangen und sie zu verbessern. Durch Investitionen und Maßnahmen kann Gesundheitsförderung einen entscheidenden Einfluss auf Determinanten für Gesundheit ausüben. Ziel ist es, den größtmöglichen Gesundheitsgewinn für die Bevölkerung zu erreichen, maßgeblich zur Verringerung der bestehenden gesundheitlichen Ungleichheiten beizutragen, die Menschenrechte zu stärken und soziale Ressourcen aufzubauen. Letztendlich gilt es, die Gesundheitserwartung zu vergrößern und die diesbezügliche Kluft zwischen den Ländern und zwischen Bevölkerungsgruppen zu verringern“ (WHO 1997, 1f).
Die Gesundheitsförderung basiert auf den Kernideen der Salutogenese, die sich damit beschäftigt, was den Menschen gesund erhält, wie und wo Gesundheit entsteht (ausführlich Kap. 4.4).
Als Determinanten/Grundvoraussetzungen für Gesundheit werden benannt: „Frieden, Unterkunft, Bildung, soziale Sicherheit, soziale Beziehungen, Nahrung, Einkommen, Handlungskompetenzen (Empowerment) von Frauen, ein stabiles Ökosystem, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, soziale Gerechtigkeit, die Achtung der Menschenrechte und die Chancengleichheit“ (WHO 1997, 2).
!
Gesundheitsförderung stellt insgesamt einen komplexen sozialen und gesundheitspolitischen Ansatz dar, der zum einen am Individuum an-setzt und zum anderen auf die Beeinflussung ökonomischer, sozialer, ökologischer und kultureller Faktoren zielt sowie auf (gesundheits)politische Maßnahmen, die auf diese Faktoren einwirken (
Kaba-Schönstein 2018
, o. S.).
Abb. 1 gibt einen Überblick über die beiden grundlegenden Strategien der Gesundheitsförderung, die sich prinzipiell an Menschen in allen Lebenslagen und Lebensphasen sowie deren Lebenskontexte richtet.
Abb. 1: Strategien der Gesundheitsförderung (eigene Darstellung nach Kaba-Schönstein 2018, o. S.)
In der Ottawa-Charta der WHO werden folgende Handlungsstrategien der Gesundheitsförderung formuliert (Kaba-Schönstein 2018, o. S.):
■Anwaltschaft für Gesundheit, verstanden als aktives Eintreten für Gesundheit durch Beeinflussung politischer, ökonomischer, sozialer, kultureller, biologischer Faktoren, von Umwelt- sowie Verhaltensfaktoren.