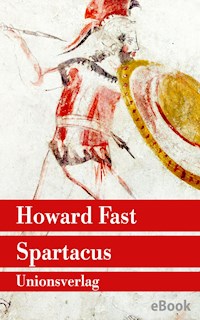
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rom, im Jahr 73 vor unserer Zeitrechnung. Besonderer Beliebtheit beim Publikum erfreuen sich die Gladiatorenspiele auf Leben und Tod. Auch der Sklave Spartacus ist von den Bergwerken der nubischen Wüste in die Gladiatorenschule von Capua verschleppt worden. Als er und seine Mitgefangenen rebellieren, wird aus der lokalen Revolte ein Flächenbrand: Spartacus führt den größten Sklavenaufstand der Geschichte an und erschüttert das Römische Reich in seinen Grundfesten. Howard Fast erzählt Spartacus’ Leben in einem eindringlichen historischen Roman, der zugleich ein Panorama der römischen Gesellschaft entwirft. 1960 wurde Spartacus, von Stanley Kubrick in Starbesetzung verfilmt und mit vier Oscars ausgezeichnet, zum Welterfolg: »Spartacus ist der bewegendste, intelligenteste und beste Sandalenfilm aller Zeiten.« (FAZ)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Rom, im Jahr 73 v. u. Z. Besonderer Beliebtheit beim Publikum erfreuen sich die Gladiatorenspiele. Als Spartacus und seine Mitgefangenen rebellieren, wird aus der lokalen Revolte ein Flächenbrand. Howard Fast erzählt Spartacus’ Leben in einem eindringlichen historischen Roman, der zugleich ein Panorama der römischen Gesellschaft entwirft.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Howard Melvin Fast (1914–2003) veröffentlichte mit neunzehn Jahren seinen ersten Roman, der sogleich zum Bestseller avancierte. Von 1943 bis 1957 war er Mitglied der Kommunistischen Partei der USA und saß 1950 deswegen drei Monate im Gefängnis, wo er sein berühmtestes Buch Spartacus schrieb.
Zur Webseite von Howard Fast.
Liselotte Julius ist Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen.
Zur Webseite von Liselotte Julius.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Howard Fast
Spartacus
Roman
Aus dem Englischen von Liselotte Julius
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1951 in New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien in der Übersetzung von Günther Baganz 1953 im Dietz Verlag, Berlin (Ost).
Die Neuübersetzung von Liselotte Julius erschien 1959 in der Rheinischen Verlagsanstalt, Wiesbaden.
Die Übersetzung wurde für die vorliegende Ausgabe, im Unionsverlag erstmals 2005 erschienen, überarbeitet und ergänzt.
Originaltitel: Spartacus (1951)
© by Howard Fast 1951
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Azoor Photo (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30393-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 23:25h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SPARTACUS
Spartacus und die schwarze ListeErster Teil — Wie Gaius Crassus im Mai auf der Heerstraße von Rom nach Capua reisteI – Es wird berichtet, dass die Heerstraße, die von …II – Im März war die Straße freigegeben worden …III – Rom war in jenen Tagen wie ein Herz …IV – Der Morgen wurde wärmer, als Gaius erwartet hatte …V – Am frühen Nachmittag zogen sie weiter die Straße …VI – Kurz bevor sie am späteren Nachmittag von der …VII – Der Name Villa Salaria hatte einen ziemlich ironischen …VIII – Gaius ging mit Licinius Crassus ins Bad …IX – Während Gaius und Crassus im Bad waren und …X – Gaius hatte sein Bad beendet, war rasiert …XI – Im Abendessen in der Villa Salaria zeigte sich …XII – Gaius entschuldigte sich, während die anderen noch tranken …XIII – Der Mondstrahl war weitergewandert. Gaius war müde …Zweiter Teil — Crassus, der große General, erzählt Gaius Crassus, wie Lentulus Batiatus, der eine Gladiatorenschule in Capua unterhielt, ihn in seinem Feldlager besuchteI – Das war«, erzählte Crassus, als er neben dem …II – Sie waren mit dem gebratenen Fisch und den …III – Bevor es eine christliche Hölle in Büchern und …IV – So beendet Batiatus seine Schilderung, wie Spartacus und …V – Dein fetter Freund Lentulus Batiatus«, hatte der General …Dritter Teil — Die Geschichte der ersten Reise nach Capua, die Marius Bracus und Gaius Crassus etwa vier Jahre vor dem Abend in der Villa Salaria unternahmen, und des Kampfes von zwei GladiatorenpaarenI – An einem schönen Frühlingstag saß Lentulus Batiatus …II – Varinia liegt wach in der Dunkelheit. Sie hat …III – Der Morgen bringt den Kampf. Er liegt in …IV – Die vier gingen zuerst schweigend zum Bad …V – Lentulus Batiatus dachte in den folgenden Jahren häufig …VI – Damals bestand das Gesetz noch nicht, dass Thrakern …VII – Im Haus der Erwartung, einem kleinen Schuppen neben …VIII – Batiatus war in die Loge seiner Gäste geeilt …IX – Die Steine weinen«, sagte der Schwarze. »Der Sand …X – Gaius konnte sich in späteren Jahren nicht mehr …Vierter Teil — Marcus Tullius Cicero interessiert sich für den Ursprung des großen SklavenkriegesI – Wenn in der Villa Salaria immer wieder von …II – Schließlich schlief Helena aus Müdigkeit und seelischer Erschöpfung …III – Von seinem eigenen Buchhalter ermordet zu werden wie …IV – Das morgendliche Trommelschlagen rief sie zum Drill …V – Später erklärte Batiatus vor einem Untersuchungsausschuss des Senats …VI – Das traf jedoch nicht ganz zu. Kein Mensch …VII – Was im Essraum geschah, wo sich die Gladiatoren …VIII – Versammelt euch um mich«, sagte erIX – Zuerst die Soldaten«, sagte SpartacusX – Viel später fragte Spartacus sich: Wer wird über …XI – In Capua sah man den Rauch des ersten …Fünfter Teil — Lentelus Gracchus schildert einige seiner Erinnerungen sowie Einzelheiten über seinen Aufenthalt in der Villa SalariaI – Lentelus Gracchus pflegte gern von sich zu sagen …II – Wie Cicero hatte Gracchus einen Sinn für Geschichte …III – Das Tageslicht lindert die Ängste und Nöte des …IV – Anfangs hatte der Senat entschieden, sechs Stadtkohorten nach …V – So lernte der Senat den Namen Spartacus kennen …VI – Der Senat tagte vollzählig hinter verschlossenen Türen …VII – Seht euch den alten Gracchus an«, sagte Antonius …Sechster Teil — Wie ein Teil der Gäste aus der Villa Salaria nach Capua reiste und dort die Kreuzigung des letzten Gladiators mit ansah, sowie einige Einzelheiten über die StadtI – Am gleichen Tage verabschiedeten sich Cicero und Gracchus …II – In Capua herrschte Feststimmung. Die Stadt hatte den …III – Im Grunde genommen war es Crassus ziemlich gleichgültig …IV – Es dauerte fast eine Stunde, bis der Gladiator …V – Hätte man auf irgendeine wunderbare Weise die Hirne …VI – Lange danach wurde einmal ein römischer Sklave gekreuzigt …VII – Als bekannt wurde, dass der Gladiator im Sterben …VIII – Im Leben des Gladiators hatte es vier Zeiten …IX – Ehe der Gladiator starb, lichtete sich sein Geist …X – An jenem Abend speiste Crassus allein. Er war …Siebter Teil — Wie Cicero und Gracchus nach Rom zurückreisten, von ihren Gesprächen sowie von Spartacus’ Traum und wie er Gracchus berichtet wurdeI – Als Gaius, Crassus und die beiden jungen Frauen …II – All dies machte Gracchus für Cicero keineswegs liebenswerter …III – Es vergingen keine drei Wochen, als Flavius bei …IV – Am folgenden Nachmittag begab sich Gracchus zu den …V – Du musst dich anziehen, Varinia. Wir müssen dich …VI – Gracchus ließ Flavius abermals kommen. Die beiden Männer …VII – Varinia hatte einen Traum. Sie träumte, dass sie …VIII – Am nächsten Tag ging Crassus aufs Land …IX – Flavius kehrte in der Stunde vor Tagesanbruch zurück …Achter Teil — Varinias Weg in die FreiheitI – Flavius erfüllte sein Abkommen mit Gracchus. Ausgestattet mit …II – Und so verlief Varinias SchicksalSpurensuche nach Spartacus — Nachwort von RAPHAEL ZEHNDERMehr über dieses Buch
Über Howard Fast
Über Liselotte Julius
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Rom
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Sklaverei
Zum Thema Italien
Spartacus und die schwarze Liste
Als ich mich vor mehr als vierzig Jahren daranmachte, die erste Fassung von Spartacus zu schreiben, hatte ich gerade meine Haftstrafe verbüßt. Teile des Romans hatte ich noch im Gefängnis skizziert, das eine ausgezeichnete Umgebung war für diese Aufgabe. Mein Verbrechen hatte darin bestanden, dass ich mich geweigert hatte, dem Senatsausschuss für unamerikanische Umtriebe die Namen derjenigen Personen zu nennen, die das Joint Antifascist Refugee Committee unterstützten.
Nach Francos Sieg über die rechtmäßige spanische Republik waren Tausende von Republikanern, Soldaten und ihre Familien über die Pyrenäen nach Frankreich geflohen. Viele von ihnen hatten sich in Toulouse niedergelassen und waren krank oder verwundet. Ihre Situation war verzweifelt. Eine Gruppe von Antifaschisten sammelte Geld und erwarb ein altes Kloster, um darin ein Krankenhaus einzurichten. Die Hilfsorganisation Quaker’s Relief erklärte sich bereit, das Krankenhaus zu führen, falls wir genug Geld auftreiben konnten, um den Betrieb zu sichern. Damals gab es in der Öffentlichkeit breite Unterstützung für die Sache der spanischen Republik. Viele der Spender waren prominent. Diese Liste war es, die wir uns weigerten, an den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe weiterzugeben – und so kam es, dass alle Mitglieder unserer Gruppe für schuldig befunden und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.
Es war eine schlimme Zeit damals, die schlimmste Zeit, die meine Frau und ich je erlebt haben. Das Land glich mehr denn je einem Polizeistaat. J. Edgar Hoover, der Direktor des FBI, führte sich auf wie ein kleiner Diktator und sammelte Informationen über Tausende von Liberalen. Hoovers Ängste erfassten das ganze Land. Niemand wagte es, sich gegen unsere Verurteilung zu äußern. Es war nicht der schlechteste Moment, um ein Buch wie Spartacus zu schreiben.
Als das Manuskript fertig war, schickte ich es an Angus Cameron bei meinem damaligen Verlag Little, Brown and Company. Er war begeistert von dem Roman und schrieb mir, es würde ihn mit Stolz und Freude erfüllen, ihn zu veröffentlichen. Daraufhin schaltete sich J. Edgar Hoover bei Little, Brown and Company ein und untersagte die Publikation des Buches. Angus Cameron kündigte aus Protest. Das Manuskript wurde sieben weiteren führenden Verlagen angeboten. Alle sagten ab. Der letzte der sieben Verlage war Doubleday, und deren Leiter der Buchhandelskette, George Hecht, verließ nach der Sitzung, in der gegen die Veröffentlichung entschieden wurde, wütend und empört den Raum. Er rief mich an und sagte, dass er noch nie so viel Feigheit in einer Sitzung bei Doubleday erlebt habe. Wenn ich das Buch selbst publizieren würde, könne er mir schon jetzt die Abnahme von sechshundert Exemplaren versprechen. Ich hatte noch nie ein Buch selbst veröffentlicht, aber einige Liberale unterstützten mich, und so nahm ich die Sache in Angriff, steckte das wenige Geld, das wir hatten, hinein, und irgendwie klappte es.
Zu meiner Überraschung wurden von der gebundenen Ausgabe über vierzigtausend Exemplare verkauft und mehrere Millionen einige Jahre später, als die Zeit des Schreckens vorüber war. Spartacus wurde in sechsundfünfzig Sprachen übersetzt, und zehn Jahre, nachdem ich den Roman geschrieben hatte, brachte Kirk Douglas die Universal Studios dazu, die Geschichte zu verfilmen. Der Film war über all die Jahre enorm erfolgreich und wird auch heute noch gezeigt.
Ich glaube, dass die Entstehung des Romans einiges meiner Zeit im Gefängnis verdankt. Krieg und Gefängnis sind für Autoren schwierig darzustellen, ohne sie selbst erlebt zu haben. Ich konnte vorher kein Latein, doch während des Schreibens lernte ich eine ganze Menge, die ich seither allerdings auch wieder vergessen habe. Ich bedaure die Vergangenheit nicht, und wenn mir diese schwere Prüfung geholfen hat, Spartacus zu schreiben, dann war sie es wert.
Howard Fast, 1996
Dieses Buch ist meiner Tochter Rachel und meinem Sohn Jonathan gewidmet. Es erzählt von tapferen Männern und Frauen, die vor langer Zeit lebten und deren Namen niemals vergessen worden sind. Die Helden dieser Geschichte hielten die Freiheit und Würde des Menschen hoch und lebten edel und gut. Ich habe dieses Buch geschrieben, damit alle, die es lesen, meine Kinder und andere, Kraft schöpfen für unsere ungewisse eigene Zukunft und gegen Unterdrückung und Unrecht kämpfen – auf dass der Traum des Spartacus sichin unserer Zeit verwirklichen möge.
Die Handlung beginnt im Jahr 71 vor unserer Zeitrechnung.
Erster Teil
Wie Gaius Crassus im Mai auf der Heerstraße von Rom nach Capua reiste
I
Es wird berichtet, dass die Heerstraße, die von der Ewigen Stadt Rom zu der etwas kleineren, jedoch kaum weniger schönen Stadt Capua führte, bereits Mitte März wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben wurde. Das heißt aber nicht, dass das Leben auf dieser Straße sofort wieder normal verlief. Denn während der letzten vier Jahre hatte keine Straße der Republik den friedlichen, stetigen Strom von Waren und Menschen erlebt, den man auf einer römischen Straße erwarten konnte. Es hatte überall mehr oder minder Unruhe gegeben, sodass man beinahe behaupten könnte, die Straße zwischen Rom und Capua sei zum Symbol dieser Unruhe geworden. Wie es auf den Straßen ist, so ist es in Rom. Dieser Satz hatte durchaus seine Richtigkeit. Wenn auf den Straßen Friede und Wohlstand herrschen, so herrschen sie auch in der Stadt.
In Rom verkündeten Anschläge, dass jeder freie Bürger, der Geschäfte in Capua habe, dorthin reisen könne, um sie zu erledigen. Von Vergnügungsreisen in den schönen Kurort sei jedoch zunächst noch abzuraten. Als dann aber der sonnige und sanfte Frühling ins Land zog, hob man die Einschränkungen auf, und die Römer wurden wieder von den prächtigen Bauten und der bezaubernden Landschaft Capuas angelockt.
Neben der reizvollen Natur Kampaniens fanden diejenigen, die gutes Parfüm schätzten, sich jedoch an den Wucherpreisen stießen, in Capua sowohl Gewinn als auch Vergnügen. Hier gab es die großen Parfümfabriken, die in der ganzen Welt unerreicht waren. Von überallher wurden seltene Essenzen und Öle nach Capua verschifft, erlesene exotische Duftstoffe, ägyptisches Rosenöl, Lilienessenz aus Saba, galiläischer Mohn, Öl aus Ambra und aus Zitronen- und Orangenschalen, Salbei- und Minzblätter, Rosen- und Sandelholz – eine schier endlose Menge. In Capua war Parfüm für weniger als die Hälfte des in Rom geforderten Preises zu kaufen. Bedenkt man, wie beliebt und auch wie notwendig Wohlgerüche zu jener Zeit bei Männern und Frauen waren, so kann man verstehen, dass eine Reise nach Capua schon aus diesem Grund unternommen wurde.
II
Im März war die Straße freigegeben worden. Zwei Monate später, Mitte Mai, machten sich Gaius Crassus, seine Schwester Helena und deren Freundin Claudia Marius auf, um eine Woche bei Verwandten in Capua zu verbringen. Sie verließen Rom an einem hellen, klaren und kühlen Morgen, einem idealen Reisetag. Alle drei waren jung, helläugig und voller Vorfreude auf die Reise und die Abenteuer, die sie zweifellos erwarteten. Gaius Crassus, ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, dessen dunkles Haar in vollen, weichen Locken herabfiel und dessen ebenmäßige Züge ihm den Ruf von Schönheit und vornehmer Herkunft eingebracht hatten, ritt einen herrlichen Araberschimmel, das vorjährige Geburtstagsgeschenk seines Vaters. Die beiden jungen Damen reisten in offenen Sänften. Jede Sänfte wurde von vier Sklaven getragen, die ohne Ruhepause zehn Meilen in leichtem Trab zurücklegen konnten. Fünf Tage hatten sie für die Reise angesetzt, wobei sie in den Landhäusern von Freunden oder Verwandten übernachten wollten, um so in bequemen, angenehmen Etappen nach Capua zu gelangen. Sie wussten im Vorhinein, dass es an der Straße Strafmale gab, hielten diese jedoch nicht für störend. Freilich waren die jungen Frauen bei den Schilderungen, die sie gehört hatten, ziemlich aufgeregt. Gaius fühlte sich von derartigen Dingen stets angenehm und gewissermaßen sinnlich berührt. Außerdem war er stolz auf seinen Magen und auf die Tatsache, dass ein solcher Anblick ihm kaum etwas anhaben konnte.
»Schließlich ist es besser, ein Kreuz anzublicken, als daran zu hängen«, erklärte er den beiden jungen Frauen.
»Wir werden geradeaus blicken«, erwiderte Helena.
Sie war hübscher als Claudia. Diese war eine farblose Blondine mit blasser Haut, blassen Augen und einem müden Aussehen, das sie noch betonte. Ihr Körper war üppig und reizvoll, doch Gaius fand sie ziemlich dumm und fragte sich, was seine Schwester wohl in ihr sah. Er war entschlossen, auf der Reise eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bereits mehrfach hatte er sich vorgenommen, die Freundin seiner Schwester zu verführen, dieser Vorsatz war jedoch stets an ihrer trägen Gleichgültigkeit gescheitert, einer Gleichgültigkeit, die nicht ihm direkt galt, sondern allgemein zu sein schien. Sie langweilte sich, und Gaius war davon überzeugt, dass nur diese Langeweile sie davor bewahrte, selbst höchst langweilig zu sein. Seine Schwester war anders. Sie erregte ihn auf verwirrende Weise. Sie war so groß wie er und ihm sehr ähnlich, nur hübscher. Männer, die sich nicht von ihrer Willensstärke abstoßen ließen, fanden sie schön. Seine Schwester erregte ihn, und er war sich durchaus bewusst, dass er sich eine Befreiung von diesem Zustand erhoffte, als er die Reise nach Capua plante. Seine Schwester und Claudia bildeten ein ungleiches, aber trotzdem angenehmes Paar, und Gaius freute sich auf das, was ihm diese Reise verhieß.
Wenige Meilen außerhalb Roms tauchten die ersten Strafmale auf. Die Straße führte hier durch eine steinige, sandige Einöde von einigen Morgen Ausmaß. Der mit der Errichtung Beauftragte hatte ein gutes Auge für Wirkung bewiesen, als er gerade diese Stelle für das erste Kreuz wählte. Das Kruzifix war aus frischem, harzigem Pinienholz gehauen. Der Boden dahinter fiel ab, und so stand es starr, kahl und kantig vor dem morgendlichen Himmel – übergroß, denn es war das erste –, sodass man den nackten Körper des Mannes, der daran hing, kaum sah. Es war leicht vornübergeneigt, wie es bei einem überlasteten Kreuz häufig der Fall ist, und dadurch wurde der bizarre, beinahe menschliche Eindruck noch verstärkt. Gaius zügelte sein Pferd, das nunmehr auf das Kreuz zuschritt. Helena wies die Sänftensklaven mit einem leichten Peitschenhieb an, ihm zu folgen.
»Dürfen wir ausruhen, Herrin?«, flüsterte der Schrittmacher von Helenas Sänfte, als sie vor dem Kreuz anhielten. Er war Spanier und sprach ein gebrochenes, zögerliches Latein.
»Natürlich«, erwiderte Helena. Sie war erst dreiundzwanzig, jedoch willensstark wie alle Frauen ihrer Familie und verabscheute sinnlose Grausamkeit gegen Tiere, seien es Sklaven oder Vieh. Die Träger ließen die Sänften behutsam zu Boden gleiten und kauerten sich dankbar daneben.
Wenige Schritte vor dem Kreuz saß auf einem Strohschemel, der von einer Zeltplane überdacht war, ein fetter, freundlicher Mann. Er war ebenso würdevoll wie arm. Seine Würde zeigte sich in jeder seiner zahlreichen Kinnfalten und seinem gewaltigen Bauch; seine Armut, nicht frei von Faulheit, wurde deutlich sichtbar an seinen zerlumpten, schmutzigen Kleidern, den schwarzen Fingernägeln und den Bartstoppeln. Seine Freundlichkeit war die lässig getragene Maske des Berufspolitikers. Man konnte auf den ersten Blick erkennen, dass er jahrelang die Luft des Forums und des Senats, aber ebenso der Gefängnisse geatmet hatte. Hier saß er nun, auf der letzten Stufe, bevor er zum Bettler wurde, der auf einer Matte in einem römischen Mietshaus sein Dasein fristete. Noch erscholl seine Stimme mit der durchdringenden Lautstärke eines Marktschreiers. Dies seien die Wechselfälle des Krieges, erklärte er den Reisenden. Einige wählten mit untrüglicher Sicherheit die richtige Partei. Er habe stets die falsche gewählt, und man brauche nicht eigens zu erwähnen, dass zwischen beiden kein wesentlicher Unterschied bestehe. Das habe ihn hierhergebracht, doch gehe es besseren Menschen weniger gut.
»Verzeiht mir, edler Herr und edle Damen, wenn ich nicht aufstehe, aber das Herz – das Herz.« Er legte die Hand irgendwo auf seinen mächtigen Bauch. »Wie ich sehe, seid ihr frühzeitig unterwegs, und das sollte man auch, denn es ist die rechte Zeit zum Reisen. Capua?«
»Capua«, bestätigte Gaius.
»Capua also – eine schöne Stadt, eine herrliche Stadt, eine glückliche Stadt – eine wahre Perle von einer Stadt. Ihr wollt ohne Zweifel Verwandte besuchen?« – »Ohne Zweifel«, erwiderte Gaius. Die jungen Frauen lächelten. Er war ein liebenswerter großer Narr. Seine Würde schwand dahin. Lieber ein Narr für diese jungen Leute sein. Gaius erkannte, dass es irgendwie um Geld ging, kümmerte sich aber nicht darum. Zum einen hatte es ihm nie an Geld für seine Bedürfnisse und Launen gefehlt, und dann wollte er die beiden jungen Damen durch seine Weltgewandtheit beeindrucken. Wer wäre dafür besser geeignet als dieser abgebrühte fette Narr?
»Ihr seht in mir einen Führer, einen Geschichtenerzähler, einen Hausierer in Recht und Strafe. Doch tut ein Richter mehr? Die Stellung ist zwar eine andere, aber man nimmt besser einen Denar und die damit verbundene Scham in Kauf, als zu betteln …«
Die jungen Frauen konnten die Augen nicht von dem Toten abwenden, der am Kreuz hing. Er war jetzt unmittelbar über ihnen, und sie blickten unverwandt auf den nackten, sonnenverbrannten, von Vögeln zerhackten Leichnam. Krähen stießen herab, seine Haut wimmelte von Fliegen. Indem der hängende Leichnam sich leicht vom Kreuz wegneigte, erweckte er den Eindruck, als sei er ständig im Fallen, ständig in Bewegung – in den grotesken Bewegungen eines Toten. Sein Kopf hing vornüber, und das lange sandfarbene Haar verbarg das Grauen, das in seinem Gesicht stehen mochte.
Gaius gab dem fetten Mann eine Münze. Der Dank war nicht überschwänglich. Die Träger hockten schweigend da. Sie hielten die Augen starr auf den Boden gerichtet und warfen keinen Blick auf das Kreuz. Sie waren wohl abgerichtet.
»Dieser hier ist sozusagen symbolisch«, erklärte der Dicke. »Betrachte es nicht als menschlich oder grausam, Herrin. Rom gibt und Rom nimmt, und mehr oder minder entspricht die Strafe dem Verbrechen. Dieser eine hier hängt allein und lenkt eure Aufmerksamkeit auf die Folgenden. Wisst ihr, wie viele es sind von hier bis Capua?«
Sie wussten es, aber sie warteten, bis er es ihnen sagte. Dieser fette, leutselige Mann, der sie mit dem Unaussprechlichen konfrontierte, war genau. Er war der Beweis dafür, dass es gar nicht unaussprechlich, sondern gewöhnlich und natürlich war. Er würde ihnen eine exakte Zahl nennen, die nicht stimmen mochte, dafür aber genau war. »Sechstausendvierhundertzweiundsiebzig«, sagte er. Einige der Sänftenträger gerieten in Bewegung. Sie ruhten sich nicht aus, sondern saßen starr da. Wenn sie jemand beachtet hätte, wäre es ihm aufgefallen. Aber niemand beachtete sie.
»Sechstausendvierhundertzweiundsiebzig«, wiederholte der Dicke. Gaius machte die passende Bemerkung: »So viel Holz!« Helena wusste, dass es Schwindel war, aber der fette Mann nickte zustimmend. Jetzt hatten sie angebissen. Der Dicke zog einen Rohrstock aus den Falten seines Gewandes und deutete auf das Kreuz. »Dieser hier – nur ein Symbol. Gewissermaßen das Symbol eines Symbols.«
Claudia kicherte nervös.
»Trotzdem interessant und bedeutsam. Mit Vernunft hier aufgestellt. Vernunft ist Rom, und Rom ist vernünftig.« Er hatte eine Vorliebe für knappe Weisheiten.
»Ist das Spartacus?«, fragte Claudia töricht, doch der Dicke hatte Geduld mit ihr. Die Art, wie er sich die Lippen leckte, verriet, dass sein väterliches Gebaren nicht frei von Hintergedanken war.
Dieser geile alte Bock, dachte Gaius.
»Spartacus? Wohl kaum, meine Liebe.«
»Sein Leichnam ist nie gefunden worden«, erklärte Gaius ungeduldig.
»In Stücke gerissen«, sagte der Dicke großtuerisch. »In Stücke gerissen, mein liebes Kind. Eine grässliche Vorstellung für zartbesaitete Gemüter, aber es ist die Wahrheit …«
Claudia überlief ein angenehm prickelndes Schaudern. Gaius sah ein Leuchten in ihren Augen, das er nie zuvor bemerkt hatte. »Nimm dich in Acht vor oberflächlichen Urteilen«, hatte sein Vater einmal zu ihm gesagt. Er hatte dabei zwar an Wichtigeres gedacht als an Frauen, aber es traf dennoch zu. Noch nie hatte Claudia ihn so angesehen wie jetzt den Dicken, der fortfuhr: »… die reine Wahrheit. Und jetzt erzählen sie, Spartacus habe nie gelebt. Ha! Lebe ich? Lebt ihr? Hängen von hier bis Capua an der Via Appia sechstausendvierhundertundzweiundsiebzig Leichen am Kreuz oder nicht? Ja oder nein? Sie hängen sehr wohl da. Und lasst mich euch noch etwas fragen, meine lieben jungen Leute – weshalb sind es so viele? Ein Strafmal ist ein Strafmal. Doch warum sechstausendvierhundertundzweiundsiebzig?«
»Die Hunde haben es verdient«, erwiderte Helena gelassen.
»Wirklich?« Der Dicke runzelte nachdenklich die Stirn. Er sei ein Mann von Welt, erklärte er ihnen, und trotz ihres höheren gesellschaftlichen Ranges waren sie doch jung genug, um davon beeindruckt zu sein. »Vielleicht haben sie es verdient, aber warum schlachtet man so viel Fleisch, wenn man es nicht essen kann? Ich werde es euch sagen. Es hält die Preise hoch und stabilisiert die Verhältnisse. Vor allem aber entscheidet es einige sehr knifflige Eigentumsfragen. Das ist die ganze Antwort in wenigen Worten. Und dieser hier«, er fuchtelte mit seinem Rohrstock, »seht ihn euch gut an. Fairtrax, der Gallier, höchst wichtig, höchst wichtig! Er stand Spartacus sehr nahe. Und ich sah ihn sterben. Hier habe ich gesessen und ihn sterben sehen. Vier Tage lang. Er war stark wie ein Ochse. Wahrhaftig, ihr würdet solche Stärke kaum für möglich halten. Unglaublich. Sextus aus dem Dritten Bezirk hat mir den Schemel hier gegeben. Kennt ihr ihn? Ein Herr, ein großer Herr, und mir sehr wohlgesinnt. Ihr würdet staunen, wie viele Leute herkamen, um zuzusehen, und es war auch ein lohnendes Schauspiel. Ich konnte zwar keine Eintrittsgebühr von ihnen fordern, doch die Menschen geben, wenn man ihnen etwas dafür wiedergibt. Eine Hand wäscht die andere. Ich machte mir die Mühe, mich zu unterrichten. Ihr wärt überrascht, wie wenig man überall von den Spartacuskriegen weiß. Nehmt nur diese junge Dame – sie fragt mich, ob das Spartacus sei. Eine durchaus natürliche Frage, aber es wäre dennoch unnatürlich, wenn er dort hinge. Ihr vornehmen Leute lebt sehr zurückgezogen, sehr behütet, sonst wüsste die junge Dame, dass Spartacus zerstückelt wurde und dass man weder Haut noch Haar von ihm gefunden hat. Mit diesem hier war es anders – er wurde gefangen genommen. Ein wenig aufgeschlitzt, seht ihr …«
Er zeigte mit dem Rohr auf eine lange Wunde, die der über ihm hängende Leichnam an der Seite aufwies. »Zahlreiche Narben – höchst aufschlussreich. Seitlich oder vorn. Keine einzige im Rücken. Solche Einzelheiten sind nichts für den Pöbel, doch euch will ich erzählen …«
Die Sänftenträger beobachteten ihn jetzt und lauschten. Ihre Augen leuchteten unter den langen, verfilzten Haaren.
»… dass dies die besten Soldaten waren, die je über römischen Boden marschiert sind. Doch zurück zu unserem Freund hier oben. Vier Tage hat er gebraucht, um zu sterben, und es hätte noch viel länger gedauert, wenn man ihn nicht ein wenig zur Ader gelassen hätte. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber man muss es tun, wenn man sie kreuzigt. Entweder man zapft ihnen Blut ab, oder sie quellen auf wie ein Schwamm. Wenn man sie richtig zur Ader lässt, trocknen sie auch richtig und können einen Monat hängen bleiben, ohne mehr Unannehmlichkeiten zu verursachen als ein bisschen Gestank. Dasselbe, wie wenn man Fleisch dörrt, man braucht nur viel Sonne dazu. Dies hier war ein wilder, trotziger Mann – aber er verlor. Am ersten Tag hing er da oben und beschimpfte jeden anständigen Bürger, der zum Zuschauen gekommen war. In einer abscheulichen, unanständigen Sprache, die man keiner Dame zumuten möchte. Ohne jede Bildung, aber Sklave bleibt Sklave, ich habe es ihm nicht übel genommen. Hier war ich, und dort war er, und mitunter sagte ich zu ihm: ›Dein Unglück ist mein Glück. Mag es für dich auch nicht gerade die angenehmste Art zu sterben sein, so ist es für mich ebenso wenig die angenehmste Art, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich werde verdammt wenig verdienen, wenn du weiterhin solche Reden führst.‹ Ihn schien das nicht sonderlich zu berühren, aber am Abend des zweiten Tages verstummte er. Sein Mund schnappte zu wie eine Falle. Wisst ihr, welches seine letzten Worte waren?«
»Was?«, flüsterte Claudia.
»›Ich werde wiederkommen, und aus mir werden Millionen geworden sein.‹ Das waren genau seine Worte. Fantastisch, nicht wahr?«
»Was meinte er damit?«, überlegte Gaius. Gegen seinen Willen hatte der Dicke ihn in seinen Bann gezogen.
»Was mag er wohl gemeint haben, junger Herr? Ich ahne es ebenso wenig wie du, und er hat auch kein Wort mehr gesagt. Am nächsten Tag habe ich ihn ein wenig gepikt, aber er blieb stumm und sah mich nur aus seinen blutunterlaufenen Augen an, als wollte er mich umbringen, doch der konnte niemanden mehr umbringen.« Er wandte sich wieder an Claudia. »Du siehst, meine Liebe, es war nicht Spartacus, aber einer seiner Hauptleute. Ein harter Mann, beinahe wie Spartacus, doch nicht ganz so hart. Man möchte ihm nicht auf dieser Straße begegnen und wird es ja auch nicht, denn er ist tot und verfault. Was wollt ihr noch wissen?«
»Ich glaube, wir haben genug gehört«, sagte Gaius, dem jetzt der Denar leidtat. »Wir müssen weiter.«
III
Rom war in jenen Tagen wie ein Herz, das sein Blut durch die römischen Straßen in jede Ecke der Welt pumpte. Ein anderes Volk hätte vielleicht in tausend Jahren eine drittklassige Straße gebaut, um seine größeren Städte miteinander zu verbinden. Nicht so Rom. »Baut eine Straße!«, befahl der Senat. Die Baumeister entwarfen die Pläne. Aufträge wurden ausgegeben, die Bauleute gingen ans Werk, und die Arbeitskolonnen trieben die Straße ins Land. Stand ein Berg im Weg, wurde er abgetragen. Tiefe Täler wurden mit Viadukten, Flüsse mit Brücken überwunden. Nichts vermochte Rom aufzuhalten, und nichts die römischen Straßen.
Die Straße, auf der die drei unbeschwerten jungen Leute von Rom südwärts nach Capua zogen, wurde Via Appia genannt. Sie war gut gebaut, breit, gepflastert und auf Schichten von vulkanischer Asche und Kies errichtet. Sie war für die Dauer bestimmt. Wenn die Römer eine Straße bauten, so geschah dies nicht für ein oder zwei Jahre, sondern für Jahrhunderte. Auf diese Weise war die Via Appia entstanden. Sie war ein Symbol für den Fortschritt der Menschheit, für die Leistungsfähigkeit Roms und das unermüdliche Organisationstalent seiner Bewohner. In ihr manifestierte sich eindeutig, dass das römische System das beste war, das die Menschheit je ersonnen hatte, ein System der Ordnung, Gerechtigkeit und Klugheit. Überall fanden sich Zeugnisse dieser Klugheit und Ordnung. Den Menschen, welche die Straße entlangzogen, waren sie so selbstverständlich geworden, dass sie sie kaum noch bemerkten.
So waren die Entfernungen zum Beispiel gemessen und nicht geschätzt. Jede Meile war mit einem Meilenstein gekennzeichnet. Und jeder Meilenstein wiederum enthielt sämtliche Auskünfte, die ein Reisender brauchte. An jeder Stelle wusste man genau, wie weit man von Rom, von Formia und von Capua entfernt war. Alle fünf Meilen gab es ein Rasthaus und Ställe, wo man Pferde, Erfrischungen und notfalls ein Nachtquartier bekommen konnte. Viele dieser Häuser waren sehr schön. Sie besaßen breite Veranden, auf denen Speisen und Getränke serviert wurden. Einige hatten Bäder, wo die müden Reisenden sich erfrischen konnten, andere wiederum gute, bequeme Schlafräume. Die neueren Rasthäuser waren im Stil griechischer Tempel gebaut; die natürliche Schönheit der Landschaft beiderseits der Straße wurde dadurch noch hervorgehoben.
In Niederungen und Sümpfen war die Straße terrassenförmig angelegt, wobei die rechte Seite sich drei bis fünf Meter über dem Boden befand. In zerklüftetem oder hügeligem Gelände führte sie entweder gerade hindurch oder spannte sich in Viadukten über die Schluchten.
Die Straße war ein Sinnbild der Beständigkeit, und auf ihr bewegte sich alles, was Roms Beständigkeit ausmachte. Soldaten konnten hier dreißig Meilen an einem Tag marschieren, und dies Tag für Tag. Lastzüge rollten über sie hin. Sie waren beladen mit Erzeugnissen der Republik, mit Weizen und Gerste, Roheisen und Nutzholz, Leinen und Wolle, Öl und Früchten, Käse und Rauchfleisch. Auf dieser Straße betrieben die Bürger ihren Handel, die vornehmen Römer begaben sich zu ihren Landsitzen, Geschäfts- und Vergnügungsreisende, Sklavenkarawanen zogen zum Markt, Menschen aus allen Ländern und Völkern – sie alle spürten die Festigkeit und Ordnung der römischen Herrschaft.
Und zu jener Zeit erhob sich alle paar Schritte ein Kreuz an der Straße, und an jedem hing ein Toter.
IV
Der Morgen wurde wärmer, als Gaius erwartet hatte, und nach einiger Zeit wurde der Leichengeruch recht unangenehm. Die jungen Frauen tränkten ihre Taschentücher mit Parfüm und hielten sie ständig vor die Nase. Das konnte jedoch den süßlichen, ekelerregenden Geruch, der plötzlich die Straße überflutete, nicht abhalten und ebenso wenig seine Wirkung verhindern. Den jungen Frauen war übel, und schließlich musste auch Gaius zurückbleiben und sich am Wegrand erbrechen. Der Morgen wurde ihnen dadurch beinahe verdorben.
Zum Glück gab es im Umkreis einer halben Meile von dem Rasthaus, in dem sie zu Mittag einkehrten, keine Kreuze. Sie hatten zwar nur noch wenig Appetit, aber die Übelkeit verschwand. Das Haus war in griechischem Stil erbaut, ein lang gestrecktes einstöckiges Gebäude mit einer hübschen Veranda, auf der Tische standen und die über einer Bachrinne lag. Sie blickte auf eine Grotte, die von grünen, duftenden Pinienhainen umgeben war. Hier gab es nur den Duft der Pinien, den feuchten, süßen Duft der Wälder, und kein anderes Geräusch als die gedämpfte Unterhaltung der Gäste und das Murmeln des Baches. »Was für ein bezaubernder Ort«, sagte Claudia. Gaius, der schon früher hier eingekehrt war, suchte einen Tisch aus und begann, sachkundig das Mahl zu bestellen. Der Wein des Hauses wurde sofort aufgetragen. Er war bernsteinfarben, herb und erfrischend, und als sie davon tranken, kehrte ihr Appetit zurück. Sie saßen im hinteren Teil des Hauses, der von dem vorne gelegenen Lokal getrennt war, wo Soldaten, Fuhrleute und Fremde aßen. Es war schattig und kühl hier, und man sah, dass nur Kaufleute und Patrizier bedient wurden. Das bedeutete keineswegs eine besondere Exklusivität, denn viele Kaufleute waren Handelsreisende, Geschäftsleute, Fabrikanten, Agenten und Sklavenhändler; doch es war ja auch eine öffentliche Gaststätte und keine private Villa. Außerdem ahmten die Kaufleute in letzter Zeit die Sitten der Patrizier nach und wurden weniger laut, aufdringlich und unangenehm.
Gaius bestellte kalte Räucherente und kandierte Orangen. Bis das Essen kam, plauderte er über das neueste Schauspiel, das in Rom aufgeführt worden war, eine der zahlreichen gekünstelten Komödien in schlecht imitiertem griechischem Stil.
Es drehte sich um eine hässliche, gewöhnliche Frau, die mit den Göttern ein Abkommen schloss. Gegen einen Tag Anmut und Schönheit versprach sie ihnen das Herz ihres Mannes. Der Ehemann hatte mit der Geliebten eines Gottes geschlafen, und die verwickelte, dürftige Handlung beruhte lediglich auf dem Rachemotiv. Das war zumindest Helenas Ansicht, doch Gaius protestierte. Trotz der Oberflächlichkeit enthalte das Stück viele gescheite Stellen.
»Mir hat es gefallen«, erklärte Claudia.
»Ich glaube, uns geht es zu sehr darum, was gesagt wird, statt darum, wie es gesagt wird«, meinte Gaius lächelnd. »Ich gehe ins Theater, um mich über geistreiche Dinge zu amüsieren. Wer ein Drama auf Leben und Tod will, soll in die Arena gehen und zusehen, wie die Gladiatoren einander totschlagen. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass nicht gerade die brillanten, tiefgründigen Geister bei den Spielen zu finden sind.«
»Du entschuldigst schlechte Schreiber«, widersprach Helena.
»Durchaus nicht. Ich halte nur die Qualität des Schreibens im Theater nicht für so wichtig. Ein griechischer Schreiber ist billiger als ein Sänftenträger. Ich gehöre nicht zu denen, die einen Kult mit den Griechen treiben.«
Bei den letzten Worten bemerkte Gaius einen Mann, der neben ihrem Tisch stand. Die übrigen waren inzwischen besetzt, und der Mann, irgendein Geschäftsreisender, fragte, ob er Platz nehmen dürfe.
»Ich esse nur einen Bissen und gehe dann gleich wieder«, sagte er. »Hoffentlich störe ich euch nicht.«
Er war ein großer, kräftiger Mann, offensichtlich wohlhabend und kostbar gekleidet. Seine Ehrerbietung galt lediglich der vornehmen Herkunft der jungen Leute. Früher hatten die Handelsreisenden dem Landadel gegenüber nicht diese Haltung eingenommen. Erst als sie sehr reich wurden, entdeckten sie, dass ein Stammbaum zu den am schwersten käuflichen Dingen gehörte, und damit stieg er im Wert. Wie viele seiner Freunde stellte Gaius häufig fest, welcher Widerspruch zwischen den laut bekundeten demokratischen Gefühlen dieser Leute und ihrem starken gesellschaftlichen Ehrgeiz bestand.
»Mein Name ist Gaius Marcus Senvius«, sagte der Handelsreisende. »Zögert nicht, mich zurückzuweisen.«
»Bitte nimm Platz«, erwiderte Helena. Gaius stellte sich und die beiden jungen Frauen vor. Die Reaktion des anderen freute ihn.
»Ich habe einige Geschäfte mit Angehörigen eurer Familie gemacht«, erzählte der Handelsreisende.
»Geschäfte?«
»In Vieh. Ich bin Wurstmacher. Ich habe einen Betrieb in Rom und einen in Tarracina, von wo ich jetzt komme. Wenn ihr Wurst gegessen habt, so stammte sie von mir.«
»Gewiss.« Gaius lächelte. Er hasst mich bis aufs Blut, dachte er. Man braucht ihn nur anzusehen. Er hasst mich, und doch ist er glücklich, hier sitzen zu dürfen. Was sind das doch für Schweine!
»Geschäfte in Schweinen«, sagte Senvius, als habe er die Gedanken des anderen gelesen.
»Wir haben uns sehr gefreut, dich kennenzulernen, und werden unserem Vater deine besten Wünsche übermitteln«, erklärte Helena höflich. Sie lächelte ihn kokett an, und er betrachtete sie erneut, als wolle er sagen: Patrizierin oder nicht, du bist eine Frau, meine Liebe. Gaius übersetzte es sich so: Wie würde es dir gefallen, mit mir ins Bett zu steigen, du kleine Hure? Sie lächelten einander zu. In diesem Augenblick hätte Gaius ihn umbringen können, aber mehr noch hasste er seine Schwester.
»Ich wollte euer Gespräch nicht unterbrechen«, sagte Senvius. »Lasst euch bitte nicht stören.«
»Wir haben langweiliges Zeug über ein langweiliges Stück geredet.«
Die Speisen wurden aufgetragen, und sie begannen zu essen. Plötzlich hielt Claudia, die gerade ein Stück Ente zum Mund führen wollte, inne und sagte etwas, das Gaius später höchst erstaunlich fand: »Die Male müssen dich sehr geärgert haben.«
»Welche Male?«
»Die Kreuzigungen.«
»Geärgert?«
»Weil so viel frisches Fleisch verdirbt«, erklärte Claudia gelassen. Sie wollte keineswegs geistreich sein, sondern war ganz ruhig und beschäftigte sich wieder mit ihrer Ente. Gaius musste sich zusammenreißen, um nicht in lautes Lachen auszubrechen, und Senvius wurde abwechselnd rot und blass. Claudia jedoch hatte keine Ahnung, was sie getan hatte, und aß weiter. Nur Helena spürte die außergewöhnliche Skrupellosigkeit des Wurstmachers und war voll prickelnder Erwartung. Sie wollte, dass er zurückschlüge, und freute sich, als er es tat.
»Geärgert ist nicht das richtige Wort«, sagte Senvius schließlich. »Ich kann Vergeudung nicht leiden.«
»Vergeudung?«, fragte Claudia. Sie zerteilte die kandierte Orange in kleine Stücke, die sie sich genüsslich zwischen die Lippen schob. »Vergeudung?« Bei manchen Männern erregte Claudia Mitleid, bei einigen Wut. Nur ein besonderer Mensch vermochte sie zu durchschauen.
»Die Männer von Spartacus waren kräftig«, erklärte Marcus Senvius. »Und gut genährt. Schätzungsweise wog jeder durchschnittlich hundertfünfzig Pfund. Über sechstausend hängen jetzt da draußen wie ausgestopfte Vögel. Das bedeutet neunhunderttausend Pfund Frischfleisch – jedenfalls war es frisch.«
Nein, er kann es nicht so meinen, dachte Helena. Ihr ganzer Körper brannte jetzt vor Erwartung. Claudia aber, die ihre kandierte Orange weiter verzehrte, wusste, dass er es so meinte, und Gaius fragte: »Warum hast du kein Angebot gemacht?«
»Das habe ich getan.«
»Aber sie wollten nicht verkaufen?«
»Es ist mir gelungen, eine Viertelmillion Pfund zu kaufen.«
Worauf will er hinaus?, fragte sich Gaius. Er versucht, uns einen Schreck einzujagen, dachte er. Auf seine gemeine, schmutzige Art will er uns Claudias Worte heimzahlen. Helena jedoch erkannte den Kern Wahrheit, der darin steckte, und Gaius sah mit Befriedigung, dass ihr endlich einmal etwas unter die Haut ging.
»Fleisch – von Menschen?«, flüsterte Claudia.
»Von Werkzeugen«, erklärte der Wurstmacher bestimmt. »Um den bewundernswürdigen jungen Philosophen Cicero zu zitieren. Wertlose Werkzeuge. Ich habe sie geräuchert, klein gehackt und mit Schweinefleisch, Gewürzen und Salz vermischt. Die Hälfte geht nach Gallien, die andere nach Ägypten. Und der Preis ist gerade richtig.«
»Ich finde deinen Scherz geschmacklos«, murmelte Gaius. Er war noch sehr jung und hatte es schwer, gegen die reife Bitterkeit des Wurstmachers anzukommen. Der Handelsreisende würde Claudias Beleidigung sein Leben lang nicht vergessen und sie stets gegen Gaius ins Feld führen, weil dieser den Fehler begangen hatte, dabei zu sein.
»Das war kein Scherz«, erwiderte Senvius sachlich. »Die junge Dame hat etwas gefragt, und ich habe geantwortet. Ich habe eine Viertelmillion Pfund Sklaven gekauft, um daraus Wurst zu machen.«
»Das ist das Grässlichste, Abscheulichste, was ich je gehört habe«, sagte Helena. »Deine angeborene Ungeschliffenheit treibt sonderbare Blüten.«
Der Handelsreisende erhob sich und sah von einem zum anderen. »Verzeiht!«, sagte er und wandte sich an Gaius. »Frage deinen Onkel Sillius. Er hat das Geschäft vermittelt und dabei schön verdient.«
Dann ging er. Claudia aß ruhig weiter ihre kandierte Orange und hielt nur inne, um festzustellen: »Ein unmöglicher Mensch!«
»Immerhin hat er die Wahrheit gesagt«, meinte Helena.
»Was?«
»Aber natürlich. Warum regt dich das so auf?«
»Es war eine ganz gemeine Lüge«, erklärte Gaius. »Er hat sie sich eigens für uns ausgedacht.«
»Der Unterschied zwischen uns, mein Lieber, ist der, dass ich weiß, wenn jemand die Wahrheit sagt«, erwiderte Helena.
Claudia wurde noch blasser als gewöhnlich. Sie stand auf, entschuldigte sich und ging würdevoll zum Ruheraum. Helena lächelte leise vor sich hin, und Gaius sagte: »Dich kann wohl nichts wirklich erschüttern, Helena.«
»Weshalb auch?«
»Zumindest werde ich nie wieder Wurst essen.«
»Ich habe nie welche gegessen«, sagte Helena.
V
Am frühen Nachmittag zogen sie weiter die Straße entlang. Sie begegneten einem syrischen Bernsteinhändler namens Musel Schabaal. Sein sorgfältig gelockter Bart glänzte von duftendem Öl, das lange, bestickte Gewand fiel zu beiden Seiten des prachtvollen Schimmels herab, den er ritt, und an seinen Fingern funkelten kostbare Edelsteine. Hinter ihm trabten zwölf Sklaven, Ägypter und Beduinen, die große Bündel auf dem Kopf trugen. Überall im römischen Machtbereich machte die Straße die Menschen gleich, und so fand Gaius sich bald in ein einigermaßen einseitiges Gespräch mit dem weltläufigen Kaufmann verwickelt, zu dem der junge Mann kaum mehr als ein gelegentliches Kopfnicken beitrug. Schabaal fühlte sich höchst geehrt, einen Römer zu treffen, denn er empfand größte Bewunderung für die Römer, insbesondere aber für jene gebildeten, wohlhabenden, zu denen Gaius zweifellos zählte. Unter den Orientalen gab es einige, die manches an den Römern nicht begriffen, zum Beispiel die Freiheit, die deren Frauen genossen. Schabaal jedoch gehörte nicht zu dieser Sorte. Wenn man einem Römer etwas anhaben wollte, biss man auf Granit, davon zeugten die Strafmale an der Straße – und Schabaal freute sich über die Lehre, die seine Sklaven aus dem bloßen Anblick dieser eindrucksvollen Kreuze zogen.
»Du wirst es kaum glauben, junger Herr«, sagte er. Er sprach fließend lateinisch, jedoch mit fremdländischem Akzent. »Aber es gab Menschen in meiner Heimat, die fest damit rechneten, dass Rom von Spartacus besiegt würde. Es kam sogar zu einem kleinen Aufstand unter unseren eigenen Sklaven, den wir mit scharfen Maßnahmen ersticken mussten. ›Wie wenig begreift ihr doch Rom‹, erklärte ich ihnen. ›Für euch ist Rom das, was ihr aus der Vergangenheit kennt oder was ihr in eurer Umgebung seht. Ihr vergesst, dass Rom für diese Welt etwas Neues darstellt.‹ Wie soll ich ihnen Rom beschreiben? Zum Beispiel der Begriff gravitas. Was bedeutet er für sie? Was sagt er all denen, die Rom nicht selber gesehen, die keine römischen Bürger kennengelernt und mit ihnen gesprochen haben? Gravitas – das heißt Aufrichtigkeit, Verantwortungsgefühl, Ernsthaftigkeit in Denken und Handeln. Levitas, das verstehen wir, sie ist unser Fluch. Wir spielen mit den Dingen, wir sind genusssüchtig. Der Römer spielt nicht, er ist ein Anhänger der Tugend. Industria, disciplina, frugalitas, clementia – für mich sind diese großartigen Worte Rom. In ihnen liegt das Geheimnis begründet, dass Frieden herrscht auf den römischen Straßen und im römischen Machtbereich. Doch wie soll man das erklären, junger Herr? Ich betrachte diese Strafmale mit aufrichtiger Befriedigung. Rom spielt nicht. Die Strafe ist dem Verbrechen angemessen, und hierin liegt die Gerechtigkeit Roms. Spartacus maßte sich an, das, was das Beste ist, zu verwerfen und zu bekämpfen. Er bot dafür Raub, Mord und Unordnung. Rom aber ist Ordnung – und so stieß Rom ihn zurück …« Gaius ließ den Redeschwall stumm über sich ergehen. Schließlich konnte er seine Langeweile und seinen Abscheu nicht mehr ganz verbergen. Daraufhin schenkte der Syrer unter zahlreichen Verbeugungen und Entschuldigungen Helena und Claudia zwei Bernsteinhalsbänder. Er empfahl sich ihnen, ihren Familien sowie sämtlichen Geschäftsfreunden und zog davon.
»Den Göttern sei Dank«, sagte Gaius.
»Mein ernsthafter Bruder«, erwiderte Helena lächelnd.
VI
Kurz bevor sie am späteren Nachmittag von der Via Appia in die kleine Seitenstraße einbogen, die zu dem Landhaus führte, in dem sie übernachten wollten, wurde die eintönige Reise durch einen Zwischenfall unterbrochen. An einer Raststätte hielt ein Manipel der dritten Legion, das sich auf Straßenpatrouille befand. Ihre Speere, Schilde und Helme hatten die Soldaten in Form dreiseitiger Zelte zusammengestellt und in Reihen ausgerichtet. Die langen Schilde lehnten gegen die kurzen Speere, und auf jedem dieser Zelte wippten drei Helme, sodass die Waffen aussahen wie ein dichtes Feld von Garben. Die Soldaten drängten sich auf dem Vorplatz und unter dem schattigen Sonnendach. Sie verlangten ungestüm nach Bier, das sie aus hölzernen Schalen tranken, die auch Fußbäder genannt wurden. Es waren zähe bronzefarbene Männer mit harten Gesichtern, deren schweißgetränkte Lederhosen und Koller einen scharfen Geruch ausströmten. Sie führten lärmende, ungehobelte Reden und waren sich durchaus bewusst, dass die Strafmale an der Heerstraße ihr jüngstes Werk waren.
Als Gaius und die jungen Frauen anhielten, um ihnen zuzusehen, trat der Hauptmann aus dem Pavillon. In der einen Hand hielt er einen Becher Wein, mit der anderen winkte er Gaius einen Gruß zu, der besonders herzlich ausfiel, weil dieser zwei schöne junge Frauen bei sich hatte.
Der junge Mann war ein alter Freund von Gaius und hieß Sellus Quintus Brutas. Er war Berufssoldat, sehr forsch und gut aussehend. Helena kannte er bereits und war hocherfreut, nun auch Claudia zu begegnen. Dann fragte er sie kurz und sachlich, was sie von seinen Leuten hielten.
»Ein lauter, dreckiger Haufen«, meinte Gaius.
»Das stimmt – aber in Ordnung.«
»Wenn sie dabei sind, fürchte ich mich vor gar nichts«, erklärte Claudia. »Außer vor ihnen selber«, fügte sie hinzu.
»Sie sind jetzt deine Sklaven und werden dich beschützen«, erwiderte Brutas höflich. »Wohin geht ihr?«
»Wir übernachten in der Villa Salaria. Du erinnerst dich wohl, dass die Straße dorthin etwa zwei Meilen von hier abzweigt«, sagte Gaius.
»Dann sollt ihr zwei Meilen lang nichts auf der Welt fürchten!«, rief Brutas und fragte Helena: »Bist du schon einmal mit einer Ehrengarde von Legionären gereist?«
»Nein, dazu war ich bisher nicht wichtig genug«, gab diese zur Antwort.
»Für mich bist du aber so wichtig«, erklärte der junge Offizier. »Gib mir nur die Gelegenheit. Du wirst schon sehen. Ich lege sie dir zu Füßen. Die Truppe gehört dir.«
»Sie ist das Letzte, was ich mir zu Füßen liegen sehen möchte«, widersprach Helena.
Er trank den Wein aus, warf den Becher dem Türsklaven zu und pfiff auf der kleinen silbernen Pfeife, die er um den Hals trug. Ein merkwürdig gebieterischer Triller von vier hohen und vier tiefen Tönen erklang. Die Legionäre stürzten daraufhin ihr Bier hinunter, fluchten vor sich hin und eilten zu ihren Speeren, Schilden und Helmen. Brutas pfiff wieder und wieder, die Töne bildeten eine gebieterische Melodie, und der Manipel reagierte, als würde die Pfeife direkt auf seinem Nervensystem spielen. Die Soldaten traten an, formierten sich zu Zügen, machten kehrt, schwenkten und bildeten dann zwei Kolonnen auf beiden Seiten der Straße. Es war ein wahrhaft erstaunliches Schauspiel eiserner Disziplin. Die beiden jungen Frauen applaudierten, und selbst Gaius, den die Possen seines Freundes etwas verärgert hatten, konnte nicht umhin, die Präzision der Truppe zu bewundern.
»Kämpfen sie ebenso gut?«, erkundigte er sich.
»Frage Spartacus«, erwiderte Brutas, und Claudia rief: »Bravo!«
Brutas verbeugte sich und salutierte, worauf Claudia in Gelächter ausbrach, eine bei ihr ungewöhnliche Reaktion, aber heute war vieles an ihr für Gaius ungewöhnlich gewesen. Ihre Wangen waren gerötet, und ihre Augen funkelten erregt, als der Manipel exerzierte. Gaius fühlte sich weniger ausgeschlossen als vielmehr verblüfft durch die Art, wie sie mit Brutas zu plaudern begann. Dieser ging zwischen den beiden Sänften und hatte die Führung des Zuges übernommen.
»Was können sie außerdem?«, fragte Claudia.
»Marschieren, kämpfen, fluchen …«
»Und töten?«
»Töten – ja, sie sind Totschläger. Sehen sie nicht so aus?«
»Mir gefällt ihr Aussehen«, erklärte Claudia.
Brutas musterte sie kühl und entgegnete dann leise: »Das glaube ich dir, meine Liebe.«
»Was noch?«
»Was willst du denn noch?«, fragte Brutas. »Möchtest du sie hören? Marschieren – im Takt!«, rief er. Die tiefen Stimmen der Soldaten sangen im Marschtritt: »Himmel, Erde, Straße, Stein! Erz schlägt alles kurz und klein!«
Die Worte kamen heiser und undeutlich aus ihren Kehlen und waren nur schwer verständlich.
»Was bedeutet das?«, wollte Helena wissen.
»Genau genommen gar nichts. Nur ein Marschlied. Es gibt sie zu Hunderten, und sie haben keinerlei Sinn. ›Himmel, Erde, Straße, Stein‹ – das heißt so viel wie nichts, aber sie marschieren dabei besser. Dieser Vers stammt aus dem Sklavenkrieg. Manche sind nichts für die Ohren einer Dame.«
»Für mich aber doch«, sagte Claudia.
»Ich flüstere sie dir ins Ohr«, erwiderte er lächelnd und beugte sich zu ihr. Dann richtete er sich wieder auf. Claudia wandte ihm den Kopf zu und starrte ihn an. Am Straßenrand standen wiederum Kreuze, und die Leichname hingen wie Schnüre daran herab. Brutas deutete auf sie. »Das ist ihre Arbeit. Mein Manipel hat allein achthundert ans Kreuz geschlagen. Es sind keine feinen Leute. Sie sind zäh, hart und mordlustig.«
»Und das macht sie zu besseren Soldaten?«, fragte Helena.
»Man vermutet es.«
»Lass einen herüberkommen!«, bat Claudia.
»Weshalb?«
»Weil ich es möchte.«
»Gut.« Er zuckte die Achseln und rief: »Sextus! Heraustreten und melden!«
Ein Soldat trat aus den Reihen, eilte im Laufschritt zwischen die beiden Sänften und marschierte dann vor dem Offizier weiter. Claudia setzte sich auf, verschränkte die Arme und musterte ihn eingehend. Es war ein mittelgroßer, dunkelhäutiger, muskulöser Mann. Seine nackten Unterarme, der Nacken, Hals und Gesicht waren fast mahagonibraun gegerbt. Er hatte scharfe, kantige Züge, die Haut glänzte vor Schweiß. Er trug einen Metallhelm und auf dem Rücken über dem Tornister einen großen Schild. In der einen Hand hielt er das pilum, einen dicken Speer aus Hartholz, dessen eines Ende aus einer schweren dreieckigen Eisenspitze bestand. Außerdem war er mit einem kurzen spanischen Schwert ausgerüstet; auf seinem Lederkoller waren über der Brust drei Eisenplatten befestigt und drei weitere auf beiden Schultern. Am Gürtel hingen abermals drei Eisenplatten, die beim Marschieren gegen seine Schenkel schlugen. Er trug eine lederne Hose und hohe Stiefel und marschierte unter dieser gewaltigen Last von Metall und Holz leicht und anscheinend mühelos. Das Metall war geölt. Öl, Schweiß und Leder verbanden sich zu dem eigentümlichen Geruch eines Handwerks, einer Kraft, einer Maschine.
Gaius ritt hinter ihnen. Er konnte Claudias Gesicht im Profil sehen, die Zunge zwischen den leicht geöffneten Lippen, die Augen, die nicht von dem Soldaten abließen.
»Ich möchte ihn neben der Sänfte haben«, flüsterte sie Brutas zu.
Er zuckte die Achseln und gab dem Soldaten einen Befehl. Dessen Lippen umspielte ein leises Lächeln, als er neben der Sänfte marschierte. Er warf ihr nur einen einzigen Blick zu, dann sah er wieder starr geradeaus. Sie streckte die Hand aus und berührte seinen Oberschenkel an der Stelle, wo die Muskeln sich unter dem Leder spannten. Dann sagte sie zu Brutas: »Sag ihm, er soll weggehen! Er stinkt und ist schmutzig.«
Helena verzog keine Miene. Brutas zuckte abermals die Achseln und befahl dem Soldaten, wieder in die Reihe zu treten.
VII
Der Name Villa Salaria hatte einen ziemlich ironischen Beiklang. Er erinnerte an die Zeit, da noch weite Landflächen südlich von Rom malariaverseuchte Sümpfe waren. Dieser Teil des Sumpfgebietes war jedoch bereits seit Langem urbar gemacht worden. Die Privatstraße, die von der Via Appia abzweigte und zur Villa Salaria führte, war kaum weniger gut gebaut als die Hauptstraße selbst. Antonius Gaius, der Besitzer, war mütterlicherseits mit Gaius und Helena verwandt. Sein Landsitz war zwar nicht so prächtig wie andere, da er in der Nähe der Stadt lag. Dennoch war es ein großes Gut, das zu den schönsten Latifundien gehörte.
Nachdem Gaius und die beiden jungen Frauen die Via Appia verlassen hatten, mussten sie noch vier Meilen auf der Privatstraße zurücklegen, bevor sie das Haus selbst erreichten. Der Unterschied machte sich sofort bemerkbar. Jeder Fußbreit Boden war sorgfältig gepflegt. Die Wälder wirkten parkähnlich. Auf den terrassenförmig angelegten Hügeln waren Weinstöcke gepflanzt, die gerade die ersten Triebe angesetzt hatten. Auf anderen Feldern baute man Gerste an – das wurde immer weniger gebräuchlich und einträglich, da die großen Latifundien die kleinen Höfe verdrängten –, und auf anderen wiederum standen endlose Reihen von Olivenbäumen. Überall zeigte sich die sorgfältige Landschaftspflege, die nur durch fast unbeschränkte Sklavenarbeit ermöglicht wurde. Die drei jungen Leute entdeckten ständig neue, hübsche Grotten, bemoost, grün und kühl, in denen es kleine Nachbildungen griechischer Tempel, Marmorbänke, Springbrunnen aus Alabaster und weiße Steinpfade gab, die durch die bewaldeten Schluchten führten. Als jetzt, am Spätnachmittag, die Sonne hinter den flachen Hügeln unterging und es kühler wurde, lag ein märchenhafter Zauber über der Landschaft. Claudia, die noch nie hier gewesen war, brach immer wieder in Ausrufe des Entzückens aus. Das passte zu der neuen Claudia. Gaius dachte darüber nach, wie eine zartbesaitete und recht vollblütige junge Dame derart unter der Reizwirkung der Strafmale aufblühen konnte.
Um diese Tageszeit wurde das Vieh heimgetrieben. Das Läuten der Kuhglocken sowie der melancholische Klang der Hirtenhörner waren unablässig zu hören. Die Ziegenhirten – es waren junge Thraker und Armenier – trugen nichts als einen Lendenschurz. Sie liefen durch die Wälder und riefen die herumjagenden Tiere zusammen. Gaius fragte sich, ob nun die Ziegen oder die Sklaven menschlicher aussahen. Wie schon so oft, dachte er auch jetzt über den Reichtum seines Onkels nach. Das Gesetz untersagte den alten vornehmen Familien jegliche kaufmännische Betätigung.
Antonius Gaius jedoch sah – wie viele seiner Zeitgenossen – in diesem Gesetz eher einen Deckmantel als eine Einschränkung.
Man sagte von ihm, er habe über seine Mittelsmänner über zehn Millionen Sesterze gegen Zinsen verliehen, und der Zinsfuß belaufe sich dabei oft auf hundert Prozent. Außerdem erzählte man, dass er über einen beherrschenden Anteil an vierzehn Fünfdeckern im Schifffahrtsverkehr mit Ägypten verfüge und dass ihm eine der bedeutendsten Silberminen Spaniens zur Hälfte gehöre. Die großen Handelsgesellschaften, die seit den Punischen Kriegen entstanden waren, wurden zwar ausschließlich von Kaufleuten geführt, erfüllten jedoch die Wünsche von Antonius Gaius bis ins Letzte.
Man konnte unmöglich sagen, wie reich er war. Die Villa Salaria gehörte dabei trotz allem Geschmack und aller Schönheit mit ihren über fünfzehntausend Morgen Acker- und Waldland noch nicht einmal zu den größten und prächtigsten Latifundien. Ebenso wenig entfaltete Antonius Gaius seinen ganzen Reichtum, wie es bei vielen adligen Familien seit Neuestem üblich geworden war, die große Gladiatorenkämpfe veranstalteten, unvorstellbaren kulinarischen Luxus trieben und Feste im orientalischen Stil gaben. Die Tafel von Antonius war gut und reichhaltig, aber Pfauenbrust, Kolibrizungen oder gefüllte Eingeweide libyscher Mäuse waren nicht darauf zu finden. Über einen derartigen Lebensstil runzelte man hier noch die Stirn, und Familienskandale wurden nicht an die Öffentlichkeit getragen. Antonius war ein Römer von althergebrachter Würde, und Gaius, der ihn zwar achtete, aber nicht sonderlich liebte, fühlte sich in seiner Gegenwart nie ganz wohl.
Dieses Unbehagen war teilweise auf Antonius selbst zurückzuführen, der keineswegs zu den sympathischsten Erscheinungen gehörte. Mehr noch lag es in der Tatsache begründet, dass Gaius das Gefühl nicht loswurde, sein Onkel ziehe einen Vergleich zwischen ihm, wie er wirklich war, und dem, was seiner Meinung nach alle jungen Römer sein sollten, und dieser Vergleich falle nicht gerade zu seinen Gunsten aus. Gaius argwöhnte, dass die Legende von dem tugendhaften, ernsten jungen Römer heute weniger denn je der Wirklichkeit entsprach. Dieser junge Römer stellte sich in den Dienst der Öffentlichkeit, bewährte sich zunächst als Soldat und wurde dann Offizier, heiratete eine rechtschaffene römische Frau und gründete mit ihr eine Familie wie die Gracchen. Er diente dem Staat selbstlos und treu, stieg von Posten zu Posten auf, um schließlich Konsul zu werden, er wurde geehrt und geachtet vom einfachen Volk sowie von den Reichen, Vornehmen und war in jeder Beziehung unantastbar. Einen solchen jungen Römer kannte Gaius nicht. Die jungen Männer, mit denen er gesellschaftlich zusammenkam, waren vielseitig interessiert. Einige beschäftigten sich damit, zahllose Eroberungen unter den jungen Frauen zu machen. Andere verfielen schon früh der Geldkrankheit und waren als Zwanzigjährige bereits in illegale Geschäfte verwickelt. Wieder andere lernten bald, Wählerstimmen zu kaufen und zu verkaufen, zu bestechen, zu schieben und beide Augen zuzudrücken, und erfuhren so eine gründliche Ausbildung in der schmutzigen politischen Kleinarbeit, die ihre Väter meisterhaft beherrschten. Manche wiederum entwickelten sich lediglich zu Feinschmeckern. Und sehr wenige nur gingen zum Heer, da die militärische Laufbahn bei den jungen Männern ständig an Beliebtheit verlor. So betrachtete sich Gaius, der als Mitglied der größten Gruppe sich der stumpfsinnigen Aufgabe widmete, seine Tage so müßig und angenehm wie möglich zu verbringen, als harmlosen, wenn auch nicht gerade unentbehrlichen Bürger der Republik. Den stillen Vorwurf, der häufig in den Reden seines Onkels Antonius mitklang, verübelte er diesem sehr. Leben und leben lassen war eine Devise, die er für anständig und praktisch hielt.
Diesen Gedanken hing er nach, als sie den riesigen Ziergarten und die Rasenfläche betraten, welche die Villa umgaben. Die ausgedehnten Stallungen, Hürden und Sklavenunterkünfte, welche die Erwerbsgrundlage der Besitzungen bildeten, waren von den Wohngebäuden getrennt, und keine Spur davon, nicht der leiseste Hauch von Mühsal und Arbeit durfte die klassische Ruhe und Heiterkeit des Hauses stören. Die Villa selbst stand auf einer kleinen Anhöhe: ein mächtiges, rechteckiges Gebäude, das um den Mittelhof, das Atrium mit Regenbecken, errichtet war. Sie hatte weiß gekalkte Wände, ein leicht abgeschrägtes rotes Ziegeldach und bot eigentlich kein unschönes Bild. Die Strenge der geraden Linien wurde durch die schlanken Zedern und Pappeln gemildert, die rundherum geschmackvoll angepflanzt worden waren. Die Gartenanlagen waren im sogenannten ionischen Stil gehalten. Es gab viele ungewöhnlich beschnittene blühende Sträucher, glatte Rasenflächen, Sommerhäuser in farbigem Marmor, Alabasterbassins für tropische Fische und zahlreiche herkömmliche Gartenstatuen, Nymphen und Panfiguren, Faune und Amoretten. Antonius Gaius hatte auf den römischen Märkten, wo die Werke griechischer Bildhauer und Landschaftsmaler gehandelt wurden, einen ständigen Kaufauftrag zu Höchstpreisen laufen. Er knauserte dabei nie, obwohl es hieß, dass er keinen Geschmack habe und lediglich dem Rat seiner Frau Julia folge. Gaius war davon überzeugt, da er selbst nicht ohne Geschmack war und bei seinem Onkel keine Spur davon entdecken konnte. Zwar gab es andere, prachtvollere Häuser als die Villa Salaria – manche glichen den Palästen orientalischer Herrscher –, doch konnte Gaius sich keines vorstellen, das geschmackvoller oder schöner in der Anlage gewesen wäre. Claudia war der gleichen Meinung. Als sie durch die Tore auf den Ziegelweg kamen, der zum Haus führte, sagte sie voller Überraschung zu Helena: »Das hätte ich mir niemals träumen lassen! Es ist wie ein Bild aus den griechischen Mythen.«





























